Peter K. Wehrli über Fotografien von Jürg Schoop
1. das Thema
das Thema ‘Schichten’, das in Jürgs Bildern abgehandelt wird, vom abblätternden Rost an den Eisenbahngüterwagen über die Plakatwandfetzen bis zu den Farbschichten, die sich von einer Geländerstange schälen, dieses Bildthema das nun über die Bilder hinaus zum Thema wird, wo ich feststellen muss, dass die Fotografie jeweils die letzte Schicht ist, in diesem jahrzehntelangen Häutungsprozess: Schicht ist sie.
2. die Fotografien
die frühe Collage von 1962, die seit mehr als drei Jahrzehnten an meiner Zimmerwand hängt und die mir deshalb wichtig ist, weil sie mich gelehrt hat, mit meinem Blick in Gros-Plans zu teilen oder in der Totalen zusammenzufassen, was ich nur dort tun will, wo Jürg die Fetzen aus vier übereinandergeschichteten Fotografien so herausgerissen hat, dass drei menschliche Köpfe unverhofft nach Aufmerksamkeit gieren, ganz als ob sie es müde wären Teil des Ganzen zu sein.

3. die Papierblätter
die Veränderungen, die der Wind auf den weissen Papierblättern von Jürgs „objets trouvés“, 1978, herbeiführt, die Blätter, Fetzen und Krumen, die er dauernd neu komponiert, dieses Nochnicht und Nichtwieder, das in fernen Kanälen meiner Erinnerung die verschollene Erkenntnis aufsteigen lässt: ‘Zwischen heute und gestern liegt nichts als ein Moment , – zwischen heute und morgen aber ein halbes Jahrhundert», diesen enigmatischen Satz, der wie kein zweiter den Gegensatz von Augenblick und Dauer trifft, dieses immerwährende Thema aller Fotographie..
4. die Passion
die Wirkung des Bildes, die wichtiger ist als das Bild, sogar als jede Form von Abbildung, und die Passion des Fotografen, die mitschwelt in seiner Fotografie, so heftig diesmal, dass ich den Totenkranz aus Katalonien von 1984 so sehe als hörte ich den Fotografen zu mir sagen: “Ich will nicht, dass wenn man fotografiert am Schluss dann doch nichts anderes als nur ein Bild übrigbleibt“.

5. die Mechanismen
das Erforschen der Mechanismen des Erinnerns, das Teil jeder Beschäftigung mit Fotografie ist, die Erfahrung also, dass ich, damit ich mich an die Porzellanrosen von São Tomé erinnern kann, diese Blume fotografiert haben müsste,
5a.
und die von den Gesichtern in Jürgs Pariser Photografie, 1998, geweckte Erinnerung an Renatos legendäre Behauptung, der Gewinn des Erinnerns liege nicht in der Erinnerung an ein Geschehnis, sondern in dem möglicherweise lebensverlängernden Wiedergewinn der Zeitspanne, in der es geschehen war.
6. der Film
der Herbststurm, der Berge welken Laubs in eine Mauerecke des „Bellevue“
in Kreuzlingen peitschte, und der Fotograf, der sich 1983 – so stelle ich mir das vor – aus diesem Sturm nach Hause gerettet hatte und sich eingestehen musste, dass er ihn, diesen Herbstwind, erst erlebte als er den Film entwickelt hatte.

7. der Umgang
mein Umgang mit Sprache, den ich mir mit der Feststellung erklärte: “Ich schreibe mir herbei was ich nicht habe“, den ich nach tagelangem Betrachten der Bilder dieses schoopschen Kataloges auf den Umgang des Fotografen mit dem Bild zu übertragen versuchte (Fotografiert sich der Fotograf herbei was es nicht hat ?), was mir erst gelang, als ich meine Feststellung übersetzte in den Satz: „Der Fotograf verleibt sich ein, was er fotografiert“.
8. die Pixels
die oft gemachte und doch jedesmal wieder abenteuerlich neue Erfahrung, dass eine gute Fotografie immer Gegenwart ist, auch wenn das Abgebildete längst vergangen ist, wie es in Jürgs Bild ‘Im Wald’ von 1987 der Fall sein müsste, dieses Verblassen, das mich nicht nur deshalb beschäftigt, weil als Motto „Vanishing Pixels“ darübersteht.

9. das Licht
der Gegensatz zwischen Bild und Text, der mir nie grösser erscheinen wollte als jetzt wo ich für diesen schoopschen Katalog, nach dem Licht suche, das auf den Fotoplatten das Bild erzeugt, weil es mir – und dies erst würde die erhoffte sinnliche Deckungsgleichkeit erzeugen – nicht gelingen will, herbeizuführen, dass der Gegenstand den Satz erzeugt, der ihn beschreibt.
10. die Gewaltsamkeit
das Durstlöschangebot, das ‘Coca-Cola’ in Jürgs Aufnahme des sienensischen Papierkorbes von 1998 unabsichtlich und doch so äufsässig heftig vor meine Augen hält, dass die Gewaltsamkeit dieses Angebots meine Sprechmuskeln veranlasst, die Frage halblaut vor mich hin zu sagen: ‘Das Wesentliche ist das, was verlangt würde, auch wenn es dies nicht gäbe’.

11. der Satz
die Frage, warum mir wohl dieser Satz immer nur auf Englisch einfallen will, obschon er doch schweizerdeutsch gedacht worden war, und der mir nach langem ausgerechnet jetzt wieder einfällt, wo mich Jürg Schoops „Founded Pictures“ zur Feststellung veranlassen: „Je mehr man schaut, umso mehr sieht man“.
12. das Erleben
die Gegenwart, die immer Teil des Kunstwerkes ist, – sonst ist es lediglich ein Bild oder eine Fotografie -, diese jedem Erleben innewohnende Zeitform, die mir deshalb ins Bewusstsein kam, weil Dieter unser Gespräch an der Schifflände nicht enden lassen wollte, bis er die Gelegenheit bekam zu sagen, auch der Fotokünstler müsse von Imperfekt und Futur, gerade so viel einfangen, dass es sich lohne, in unserem umstrittenen Praesens zu verweilen.»

13. die Decollage
der in Nr. 2 beschriebene widerspenstige Teil des Ganzen, der sich im Blick, der die Totale fasst, in der Bildebene verliert und genau jener Fleck ist, der bewirkt, dass die aus zufälligen Rissen entstandene Decollage sich die souveräne Stuktur gibt, die ein japanische Schriftzeichen aufbaut: für mich formuliert es: Feuerfunkeln.
14. das Niemandsland
die Beklemmung des messerscharfen Ungefähren, dieses besonnen erforschten Niemandslandes in den Bildern aus Frauenfeld,2000, diese verhaltene Atmosphäre, die mich irritiert als betrachte ich nicht einen Bildraum sondern den Schauplatz einer Tat.

15. die Erkennbarkeit
die abstrakten Strukturen, die Jürg in seiner Fotografie jahrelang aus allem Gegenständlichen herausgearbeitet hat und seine Rückkehr zur „gegenständlichen“ Fotografie (als ob es das gäbe !), die mich nun angesichts der wirklichen Bürste im Fahrhof 1999 derart irritiert, dass ich alle Erkennbarkeit der Dinge korrigieren muss indem ich mir einrede: ‘Wüsste man was man sieht, so sähe man es’.
16. der Gegenstand
die Vermutung, die sich allmählich zur Gewissheit klärt, dass es Fotografien gibt, die deshalb unwiderruflich sind, weil sich in ihnen nicht in erster Linie der abgebildete Gegenstand zeigt, sondern das Licht, das die fotografische Abbildung ebendieses Gegenstandes erzeugt hat.

17. das Ungewöhnliche
mein ebenso aufgeregtes wie neugieriges Blättern in den «clou»-Nummern von 1959 auf der Suche nach Malereien und Photogaphien von Jürg Schoop aus jener Zeit, die sich mit den Bildern dieser CD vergleichen liessen, damit deutlich werden könne, wie weit die Zeit an diesen Bildern mitarbeite, und mein Verzicht aufs Weiterblättern, als mir klar wurde, dass die Fünfzigerjahre jene Epoche waren, in der das Ungewöhnliche noch nicht etwas unter Vielem war.
18. die Quadrage
das Zurückfallen in frühere Bilder, von dem ich früher einmal reden zu müssen glaubte und das jetzt wieder virulent wird, wo mir Jürg mit ‘Escala’,1999, zeigt, dass die Wege der Erinnerung durch Schichten und Ebenen führen werden, die jedesmal von einer anders eingerichteten Quadrage begrenzt sind.

19. die Hingabe
der Zwang zum Photoapparat greifen zu müssen und mit ihm dann auch zu fotografieren, diese Passion, die in der Serie der Türen von marokkanischen Elektrokasten zu derart bestechenden Bildern führt, dass ich jetzt begreife wie der Fotograph Robert Weibel die bereitwillige Hingabe an den Zwang begründen konnte: „Ich fotografiere! Wie wüsste ich denn sonst, dass ich nicht träume ?“
20. der Sucher
die in eine endlich wohltuende Erschütterung mündende Ahnung, dass der im Sucher sich darbietende Ausschnitt aus dem Strom Leben nicht den Ausschnitt zeigt, sondern das Leben, weil in einer guten Fotografie auch der kleinste Ausschnitt immer das ganze Leben enthält.

21. die Komposition
die Entwürfe, die Skizzen von Künstlern aller Sparten, die das entstehende
Werk vorausahnen lassen und die Aufnahme der Blumen auf dem Miststock von 1986, die ebenso abgeschlossene Komposition ist wie verwegenes Formsuchen, dass sie mich zur bislang unbeantworteten Frage veranlasst, unter welchen Bedingungen (und ob überhaupt ?) Fotographie Entwurf sein könne.
22. der Lichtwechsel
das Ineinander von Kunstlicht und Naturlicht beim Tagesanbruch, den ich bislang als organischen Lichtwechsel erlebt habe, ganz anders als jetzt, wo ich fiebernd beobachte, wie die Morgendämmerung das Dunkel vertreibt, als schicke der Tag erste Schlieren seines Lichtes als Vorhut in die renitente Nacht hinein.

23. die Selbstverständlichkeit
die Fenster und die Türen, die – seien sie nun abgebildet oder nicht – Jürg Schoops immerwährendes Thema sind durch fünf Jahrzehnte hindurch, dieses Fenstersein und Türwerden, dieses Türsein und Fensterwerden, das mir jetzt plötzlich jene Frau im violetten Rock in Erinnerung ruft, die das Fenster auf die Rua do Carioca hinaus öffnete um auf den Balkon heraustreten zu können, mit jener Selbstverständlichkeit, als wolle sie uns beweisen, dass sich – vielen Ahnungen zum Trotz – überhaupt nichts ändere dadurch, dass hierzulande (also: dort) jedes Fenster eine Türe ist.
24. die Zeichen
die handschriftliche Angabe ‘Italien’ unter der Fotografie der verrammelten Türe von 1985 (und nicht etwa die Aufzählung der Städtenamen Rom, Florenz, Alba, Siena) die mich nun in das Reich aller jener
vielen Dinge, Gesten – und dazu gehört die Art, wie sich der alte Ezio auf den Kastanienstock stützt wenn er abends den Weg vom Dorf herunterkommt – Verhaltensweisen und Zeichen versetzt, die, obschon Carmine kaum eine Viertelstunde von der Schweizer Grenze entfernt liegt, doch so radikal Italien bedeuten, dass ich mich ertappe, wie ich carminensischsage wo ich italienisch sagen will, und dass ich deshalb versucht bin, Schoops Aufnahme der italienischen Tür als eine carminensiche zu bezeichnen, weil ich das carminensische Wesen als italienischer erlebe als das italienische.

25. die Unschärfe
die Brille, die ich nicht auf hatte als mein Blick zufällig die in Nr. 2. beschriebene Collage streifte, und die mir den Eindruck von formaler Grossartigkeit verschaffte, weil erst die Unschärfe alle Bildelemente ineinander verfliessen lässt und nicht mehr zulässt, dass sich ein Detail – die drei Gesichter – als aufsässiges Realitätspartikel meldet.
26. die Oberfäche
die Unentschiedenheit zwischen Interpretationssucht und ihrer Parodie, mit der ich die Oberfläche von Jürgs florentinischer Fotografie von 1998 absuche um den Gegenstand aufzuspüren, der das Bedürfnis in mir ausgelöst haben könnte, angesichts dieser Decollage den abstrus erscheinenden Satz zu formulieren: „Buchstaben werden Wörter werden, Bilder werden Gegenstand“.

27. die Unfähigkeit
die Unfähigkeit, angesichts meiner Lieblingstüre unter Schoops Türaufnahmen (jener von Rom 1978), den Eindruck in einen einzigen Satz zu fassen, wie es den eisernen Regeln der Katalogsprache entspräche, und mein Eingeständnis des Regelverstosses indem ich den verbotenen Abschnitt nun doch hinschreibe:
„Wo alle Türen Rahmen sind, die lebensgrosse Bilder halten, gibt es keine Zeichen unter Glas. Ins Bild hinein und aus dem Bild heraus: der Rand ist Rahmen und ist keine Grenze, es führen alle Wege durch ihn durch. Ein gutes Bild ist stets ein Bild von allem, und ein Bild gibt es nie allein: Vorlage und Abbildung, – der Rahmen hält sie gegengleich. Und nirgends spiegeln sich Betrachter, weil jeder Gast in beiden Bildern ist“.
28. die Konturen
die elf Gegenstände im Bild von Barcelona, 1999, die danach gieren, beschrieben zu sein mit Wörtern, die so dicht ihre Körper füllen und so satt alle Konturen fassen, dass meine Sprache wie das Echo wirkt, das ertönt, wenn der Blick die fotografierten Dinge streift.

29. die Welt
die Kratzer, Striche, Risse und Sprünge im bearbeiteten Negativ von 1958, die mich an die Kratzer, Striche, Risse und Sprünge an der Zellenwand erinnerten, in denen der Gefangene den Flusslauf des Amazonas erkannte, die Schlingen der Seine und des Brahmaputra, und dazu erklärte, wenn die Welt die Ausmasse seiner Zelle hätte, würde er sich frei fühlen wie noch nie.
30. die Notwendigkeit
die quälende Insistenz, mit der sich beim Anblick von Jürgs marokkanischen Schwemmgutbildern die beiden Schlüsselsätze in die Quere kommen, jener des Mannes im Markt von Caruarú, ein Bild sei auf jeden Fall besser als kein Bild, und Peter Rosei’s beeindruckend vorgebrachter Anspruch, Bilder müssten besser sein als ihre Vorlage, sonst seien sie unnötig,
30a.
und die Beruhigung, die auch gleich doppelt eintrat, als erstens die Bilder ihre Notwendigkeit zu erkennen gaben und ich zweitens erkennen musste, dass Rosei eigentlich doch nicht von Bildern gesprochen hatte, sondern von Beschreibungen, die übrigens ja immer Bilder fassen.

31. der Zufall
die Pariser Fotografie von 1958 mit der zerfetzten Plakatwand, von der ein einigermassen unversehrter W.C. Fields lacht, dieses BiId, das ich deshalb nicht vergessen kann (nicht etwa, weil ich W.C. Fields Komödiantik verehren würde, sondern:), weil es erläutert, dass es nie der Gegenstand sein kann, der Kunstwerk sein will, sondern mein Blick, der ein Ding (das der Zufall zur Collage gemacht hat ) als Kunstwerk erleben will.
32. die Zeit
die Anschläge des Zirkus Bramarbasani, die mich daran erinnern, dass in der Schweiz die Zirkusplakate von den Wänden entfernt werden , sobald der Zirkus weitergezogen ist, und dass in den Ländern, in denen Jürg Decollagen fotografieren konnte, die Anschläge – Respekt ist es vor dem Wirken der Zeit ! – erst dann nicht mehr sichtbar sind, wenn sie die Sonne ausgeglüht, der Regen verwaschen und der Wind zerzaust hat.
© Peter K. Wehrli & wiedingpress
„Der schoopsche Katalog“
Ja, Jürg Schoop ist Künstler. Und wenn ich sagen würde: Maler, Fotograf, Dichter, Objektkunstler, Komponist, so würde ich nur kleine Teile seines Tun nennen. Denn er ist Künstler. Als ich noch Teenager war, da war er viel mehr als das: Er war für mich der Inbegriff des Künstlers. Einer, der Kunst nicht nur machte, sondern sie auch lebte.
Und Ende der Fünfzigerjahre war er noch etwas mehr: Er war Chefredaktor der Zeitschrift „Clou“. Und weil ich damals gewagt hatte, eigene Gedichte einzusenden, wurde ich unverhofft zu einer Redaktionssitzung eingeladen. Dort habe ich Jürg Schoop kennengelernt. Und da zu jener Zeit Schoops erster Gedichtband erschien „So tanz ich den Tanz“, wurden einige Zeilen daraus für mich sozusagen zum Aufruf der Solidarität: „…wo sollen wir Almosen flehn, wir am Leben trunken gewordene Narren?“ Damit hatte Schoop auch mein damaliges Lebensgefühl formuliert, lange vor 1968 als die Narretei sich dann mit Wut bewaffnete. Für uns war damals schon das Durchbrechen der Grenzen zwischen den künstlerischen Gattungen ein strikter Mut- oder Wutakt. Und Jürg hat diesen Durchbruch auch mit Witz- durch Sinnschichtungen vollzogen.
Als ich 1968 meine Orientreise – weil ich den Fotoapparat vergessen hatte – mit Worten statt mit Bildern dokumentieren musste, (was als Initialzündung für den „Katalog von Allem“ wirkte) war das Tun und Lassen, die Ideen und die Haltung von Jürg Schoop noch so präsent in mir, dass sie sich in meiner Sehweise und meiner Auffassungsart niederschlugen, – mehr noch: Jetzt, wo der Katalog von Allem“ auf 2849 Katalognummern angewachsen ist, lassen sich 32 Nummern davon zum „Schoopschen Katalog“ zusammenfassen. Und damit sind nur jene Nummern gemeint, in denen Schoops Werke und sein Tun explizit genannt werden; wo Schoops Sichtweise und seine Art des Verarbeitens von Beobachtetem zum Zuge kommen, würde die Zahl der Nummern um ein Vielfaches zunehmen.
Nicht allein im Bildgegenstand in diesen „geschriebenen Fotografien“ steckt die Allusion an Jürgs sensibel wählenden Blick, auch im Rhythmus der Sprache, in ihrer Art von Farbigkeit, im Umgang mit Rhythmus und Klangstufe, in der Quadrage der Einstellungen (Totale oder Grossaufnahme) der geschriebenen Bilder, in möglichen Überblendungen und Einzelbildern, Zoom oder Schwenk oder Standbild, in allen diesen Erscheinungsformen liessen sich Nachwirkungen von Jürgs künstlerischen Taten aufspüren und von seiner Sensibilität, die er mir vor sechs Jahrzehnten zu injizieren begann. Und auch dem Zufall, der sich ins Bild drängt, gilt es seinen Platz zu lassen. So erst kann sich das Widerspiel von Natürlichkeit und Künstlichkeit entwickeln.
Und übrigens: Schoop festigte es, dieses Spiel, schon früh in seinem legendären Satz: „Wenn man künstlerisch tätig ist, überlegt man sich nicht, warum und wozu man etwas tut. Man gehorcht einfach dem Trieb.“
Auch dies hatte mich Jürg damals gelehrt.
Peter K. Wehrli, geboren 1939, Studium der Kunstgeschichte in Zürich und Paris. Reisen durch die Sahara und zur Piratenküste. Längere Aufenthalte in Südamerika. Redaktor beim Schweizer Fernsehen DRS. Tätigkeit als Herausgeber. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. «Zelluloid-Paradies» (1978), «Eigentlich Xurumbambo» (1992), «Katalog von Allem» (1999).
Webseite von Peter K. Wehrli
Jürg Schoop, Ex-Maler, Collagist, Literat, Fotograf und Filmer seit 1952. Vorwiegend Autodidakt. Geboren 1934 in St.Gallen, aufgewachsen in Romanshorn. Lehre als Schaufenstergestalter in Arbon mit Besuch der Gewerbeschule St.Gallen (Lehrer Baus + Nüesch). Ab 1972 10 Jahre Aufenthalt in Zürich. Anschliessend Rückkehr in den Thurgau. Um die Unabhängigkeit sicher zu stellen, arbeitete der Künstler meist teilzeitlich in vielen Nebenberufen und schlug diverse Karrierenangebote aus. 1998 Kulturpreis des Kantons Thurgau. Letzte Veröffentlichung: «Brunnenpoesie», Schuber mit 50 Fotografien bei Orell Füssli.
Ausführliche Biographie
Webseite von Jürg Schoop
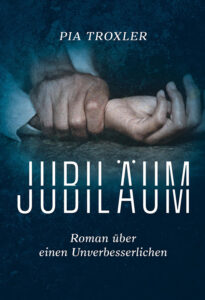


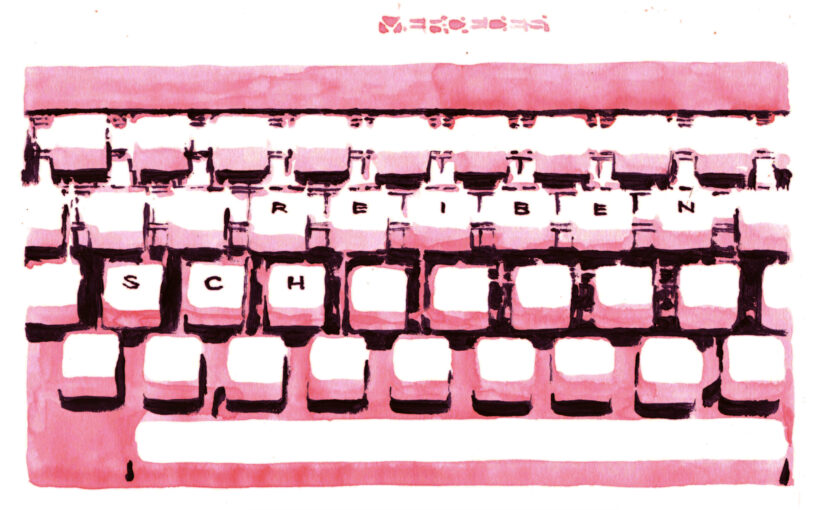

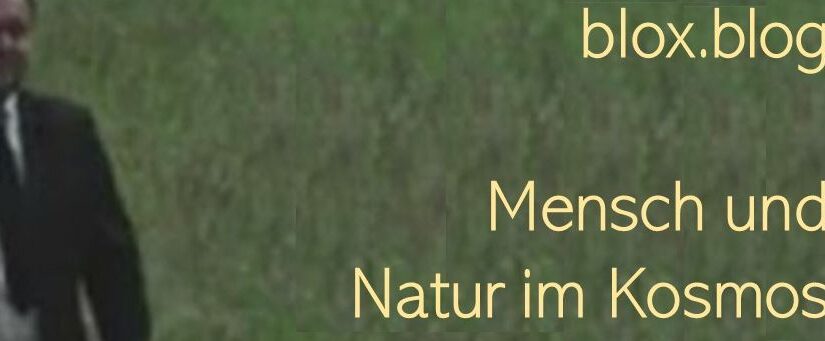

 «Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.
«Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.






















 Gastbeitrag von Céline Burget
Gastbeitrag von Céline Burget