sie steigt aus dem Nachtkino
schwebt
zwischen da und dort
döst eine Weile
und möchte zurück
etwas schmerzt
etwas blieb ungelöst
etwas braucht ihre Stimme
wenn wir die Zeit
festhalten könnten
wenn wir sie nicht splitterten
etwas zieht Josefine O.s
Mundwinkel nach oben aber was
die Augen schlitzweit geöffnet
es ist Tag
Josefine O. streckt sich
es ist Tag
aufstehen
weil es Tag ist
Rabenkrächzen
ein Lastwagen brummt
ein Flugzeug
Josefine O. dreht sich
aber mit dem Wort Tag
ist schon zu viel
sie öffnet die Augen
immer wieder ist es hell
heute prachtvoll
und mit dem prachtvollen Tag
beginnt das Denken
tun
denken
tun
die Schwester der Träumerin
streckt sich
reckt sich
ohne Bewegung
keine Beweglichkeit
sagt Josefine O.
zu Josefine O.
zieht die Decke über die Ohren
sie legt sich auf den Bauch
zieht die Schultern hoch
senkt den Kopf
streckt sich wieder
harrt aus
und nochmals von vorn
die Arme anwinkeln
abstoßen
sie nennen es Liegestütze
Josefine O. atmet tief
eine Anstrengung frühmorgens
wenn jemand zuschaute
wenn jemand zuhörte
an diesem Morgen
hört und sieht niemand
wie sie schnaubt
Josefine O. macht weiter
mit der Beweglichkeit
ob sie sicher halten lässt
die Fehltritte
die sie machte und machte
als sie Stöckelschuhe trug
und die schmerzenden Knöchel
so wäre es mit der Stimme
wenn sie sänge
jeden Tag
sänge sie ein Kinderlied
die Basslinie
von Schuberts Unvollendeter
oder von der Freude
wenn sie sänge
wäre ihre Stimme
tragend
strahlend
sie ist es nicht
sie knattert
wenn sie Kindern
eine Geschichte liest
inzwischen schieben
die Hände die Haut zum Ellbogen
hin und her
dann hüpfen
die Wölbungen
ein wenig
auf dem Rücken
liegen
die Beine
luftfahren
eins, zwei, drei
und weil es sie langweilt
zählt sie quatre, cinq, six
oder sette, otto, nove
ten, eleven, twelve
sie würde auch russisch
oder chinesisch zählen
bei fifty macht sie die Brücke
und tief durchatmen
sagt sich Josefine O.
jeden Morgen
spricht sie mit ihrem Gehirn
bitte nicht entzünden
bitte nicht klumpen
was war das denn neulich
sagt sie zum Beispiel
die Suche nach einem Namen
oder schlimmer noch nach einem Wort
das ärgert mich
sagt Josefine O. zu ihrem Gehirn
es beschämt mich
a wie Annette von Droste Triste
b wie Bettina von Anderswo
c wie Catherine Colombe
d wie wer bitte
e wie elke erb
zum Frühstück kocht sie Tee und Kaffee
bäckt das Brot auf
legt zwei Teller auf den Tisch
zwei Gläser
zwei Tassen
Messer und Löffel
sie setzt sich auf ihren Stuhl
und sagt
würdest du bitte Brot schneiden
möchtest du Tee
Kaffee
hier ist die Butter
Marmelade oder Honig?
sie nickt zum Stuhl
Josefine O. lächelt zum Stuhl
auf dem niemand sitzt
guten Morgen sagt sie
und küsst in die Luft
Am Anfang waren der Klang und die weiten Schritte. Die Frau mit leiser Stimme würde den Kopf etwas schief stellen und beiläufig, worauf warten wir, fragen. Die Hammerschläge auf dem Dach verschluckten das Gesprochene. Ich drehe den Kopf zum Fenster. Dort die Lichter der Häuser, in welchen viele eine bessere Zukunft träumen. Die Lampen, Ampeln, blinkende Barrieren. Grün oder die Farbe der Vergänglichkeit. Vielstimmiger Balzgesang am Morgen ganz nah. Die Frau sähe den Schleier über den Dingen. Wenn sich alle fürchten, wenn sie hoffen, sich freuen, zaudern. Heute Morgen sah ich ein Buch über die Büsche fliegen, sage ich.
Die Tagespresse verspricht nicht allen Gutes. Die Frau mit leiser Stimme mag nicht darüber reden. Sie weiß, worauf es ankäme, sie ahnt, was sich entzweit. Sand knirscht unter ihren Sohlen. Als Kind hätte sie mit einer Schaufel noch mehr Sand angehäuft. Sie hätte mit beiden Händen einen kleinen Kegel gepatscht. Die Schaufel scheppert zu Boden. Schau, sagt das kleine Mädchen und steckt seinen Finger in die aufragende Form. Unterdessen klopfe ich an seine Tür, klopfe nochmals, sehe die Klinke aus der Waagrechten drehen. Er steht da im fleckigen Arbeitsanzug, der dank Übergröße einiges verbirgt. Guten Morgen, sage ich.

Li Mollet, geb. 1947 in Aarberg (BE) studierte Erziehungswissenschaften und Philosophie, lebt und schreibt in Spiegel bei Bern. Ihre Prosa wurde mit Stipendien und Preisen gefördert, u.a. erhielt sie zweimal den Literaturpreis des Kantons Bern, zuletzt 2020 «weiterschreiben» von Kultur Stadt Bern. Bisher im Ritter Verlag erschienen: «weisse Linien» (2021), «und jemand winkt» (2019). 2023 erscheint der dritte Band im selben Verlag.
kritisches lexikon zur gegenwartsliteratur
Beitragsbild © Ritter Verlag Klagenfurt



 Gastbeitrag von Aline Tettamanti
Gastbeitrag von Aline Tettamanti

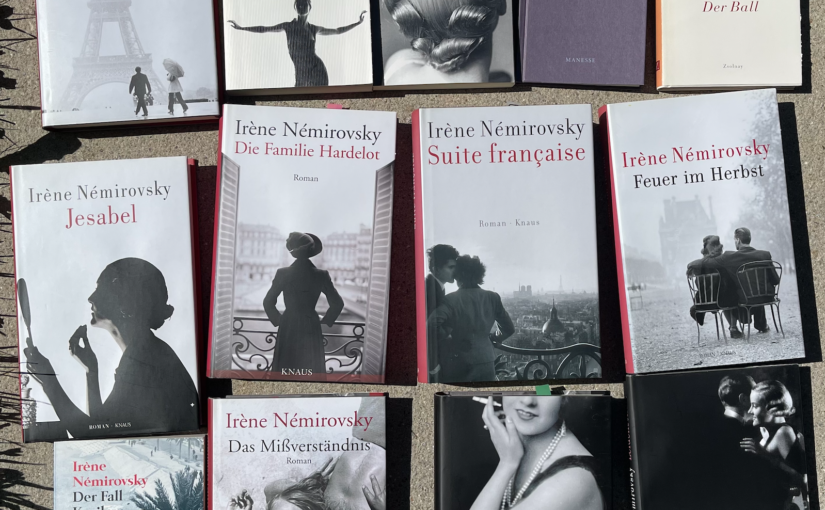
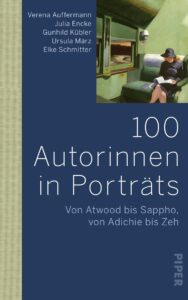 «100 Autorinnen in Porträts»
«100 Autorinnen in Porträts»
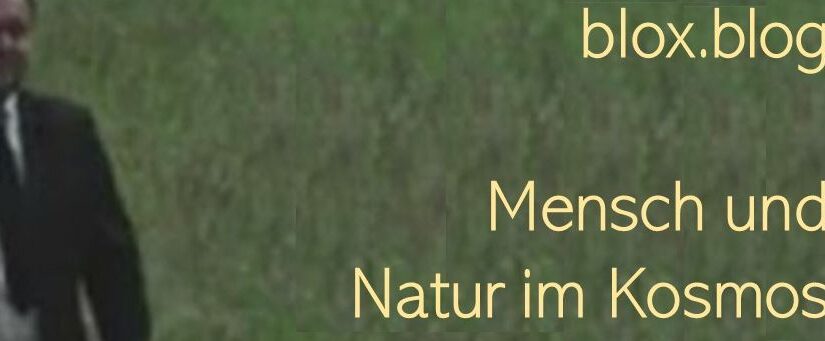
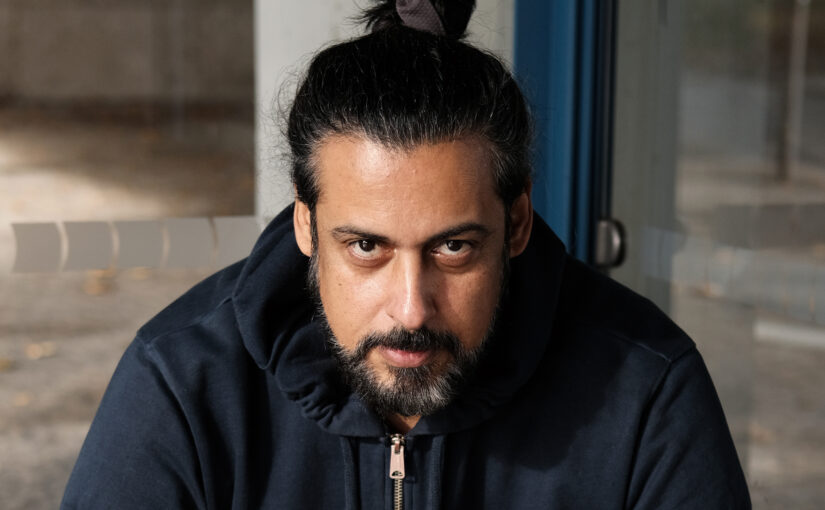
 Gastbeitrag von Elodie Kolb
Gastbeitrag von Elodie Kolb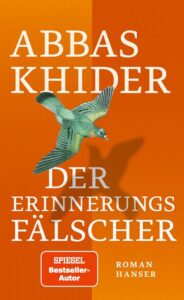


 Gastbeitrag von Yasemin Sarikus
Gastbeitrag von Yasemin Sarikus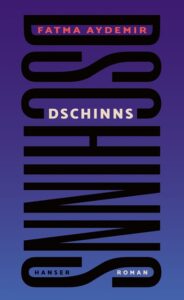
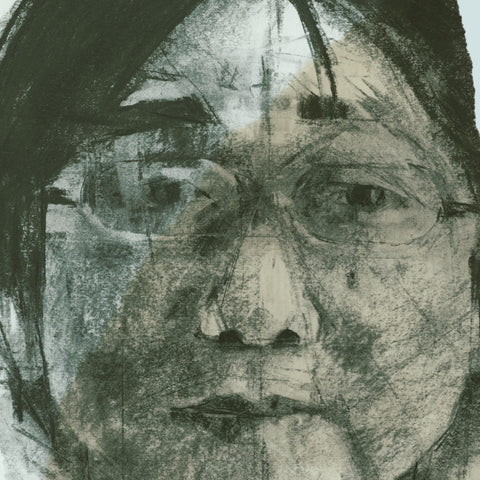

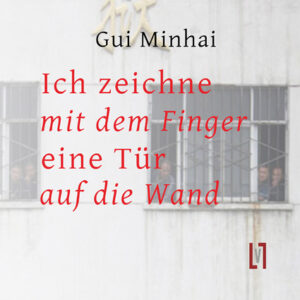
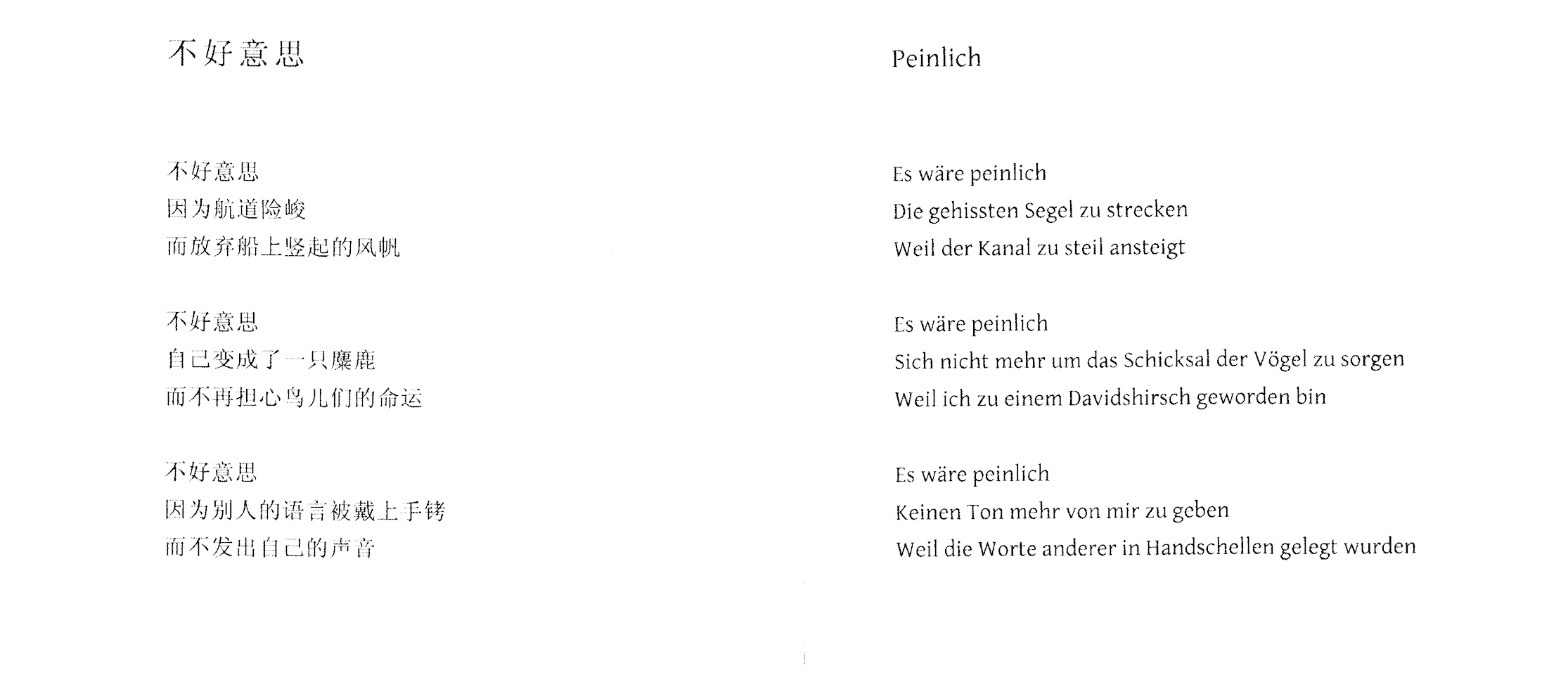
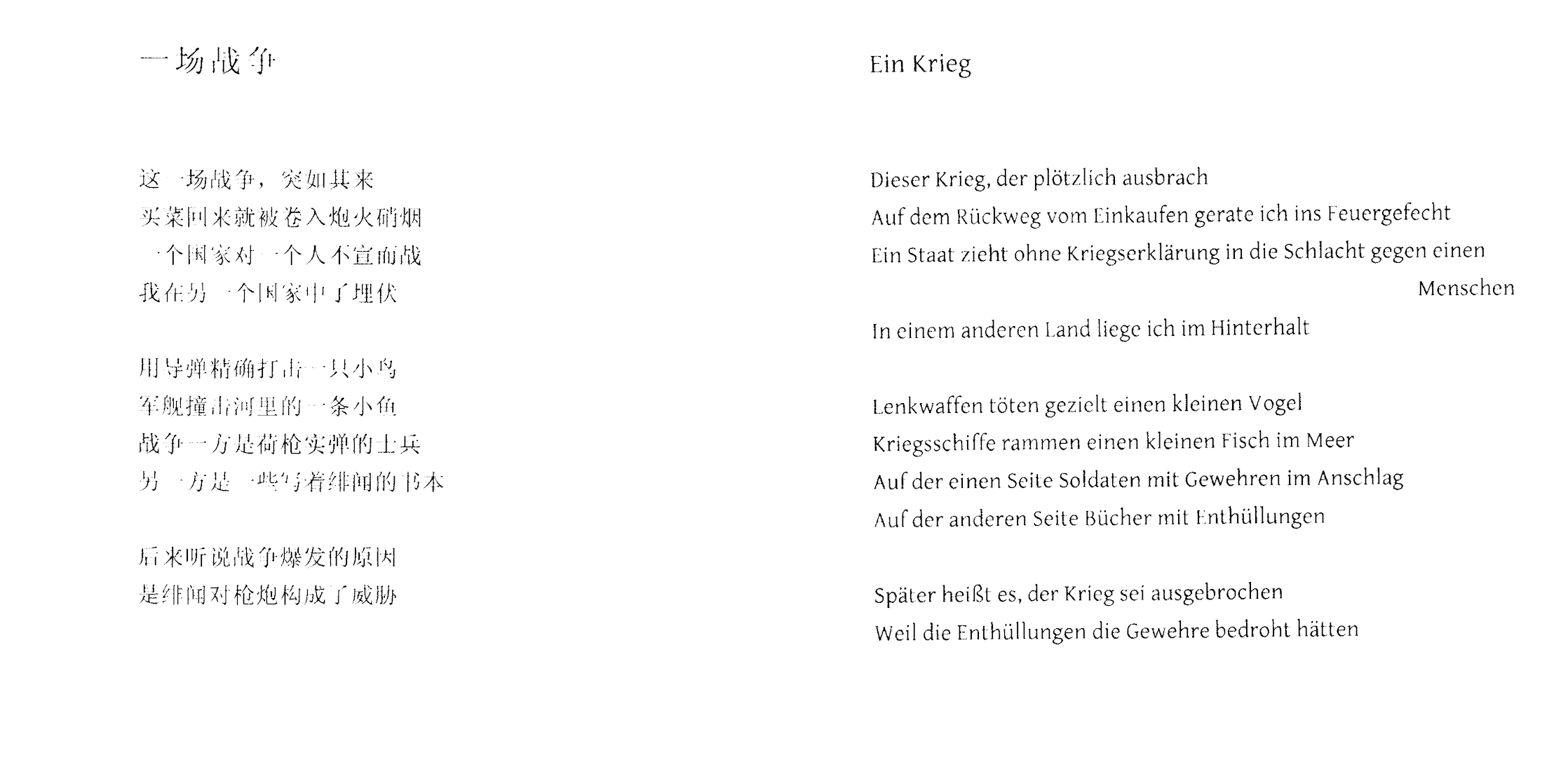

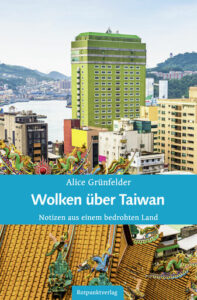




 „
„
 Gasttext von Valentina D. Bischof
Gasttext von Valentina D. Bischof