Eine von X.’ vielen Reisen auf dem afrikanischen Kontinent führte ihn – vermutlich 2014 – in die burundische Hauptstadt Bujumbura. Ich weiss nicht genau, was er dort machte. Manchmal frage ich mich, was er in solch abgelegenen Orten eigentlich suchte. War er für den Geheimdienst unterwegs? Bei dieser Reise allerdings war eher das Gegenteil der Fall. Er wurde beschattet, aber entkam den Agenten.
Er war wie so oft als Journalist eingereist, was auch seltsam ist, weil es die Formalitäten verkomplizierte, und er ja nichts schrieb. Er wäre einfacher als Tourist gekommen. Viele Journalisten reisen der Einfachheit halber lediglich mit einem Touristenvisum, was mit Risiken verbunden ist. Warum machte er es umgekehrt? In Ländern wie Burundi werden ausländische Reporter routinemässig überwacht. War es für ihn eine Art Spass zu versuchen, die Verfolger abzuhängen?
Er stieg zuerst im gediegenen Hotel Roca ab, wo oft Korrespondenten und internationale Delegationen unterkommen. Die Räume sind verwanzt, Telefon und Internet werden überwacht. Er besuchte gelegentlich ein billiges, schummriges Restaurant und beobachtete, dass zwei Agenten draussen, auf der anderen Strassenseite, warteten. Die Toiletten befanden sich im Hinterhof des Restaurants. Bei einer kleinen Inspektion stellte er fest, dass von dort ein schmaler Durchgang zum Innenhof des Nachbarhauses führte. Von dort wiederum gab es einen Ausgang auf ein Seitensträsschen, das weiter ins dichtbevölkerte Quartier und zu einem kleinen, überdachten Markt ging. Bei seinem vierten oder fünften Besuch der Imbissbude haute er durch diesen Hinterausgang ab. „Double-door“ nennt man dieses Manöver im Gangsterslang. Er verschwand im Labyrinth des Viertels.
Er hatte kein Gepäck mehr im Roca-Hotel. Das war bereits am Busbahnhof deponiert. Er zog ins Botanica-Hotel in Downtown um. Man hatte ihm gesagt, dort müsse man keinen Pass vorweisen. So würden auch die Behörden nicht erfahren, wo er war.
Er erschrak zwar, als die Frau am Empfang (es war eher eine Abstellkammer) ihm sagte, er solle seinen Pass nachher dem Chef geben, der komme in einer Stunde. Er versuchte, dem Chef auszuweichen. Aber als er ihm dann später am Abend doch über den Weg lief und an das kleine Pult beordert wurde, merkte er, dass der Chef davon ausging, er habe den Pass bereits der Frau gezeigt (oder zumindest so tat, um den offiziellen Schein zu wahren).
X. hatte Benoît in einem Klub namens „Arena“ kennen gelernt. Sie waren in einer Sitzgruppe am Rand eines Pools miteinander ins Gespräch gekommen. Mit dabei war ein älterer Franzose. X. hatte ihn gefragt, woher komme, und er antwortete, er lebe aus dem Koffer. Es stellte sich heraus, dass er Burundi seit Jahrzehnten kannte, wie auch viele andere afrikanische Länder. Über seine Tätigkeit wollte er nicht allzu viel preisgeben. „Sagen wir, ich bin Consultant.“ Auf X.’ Nachfrage sagte er: «Ich arbeite regional.» Er stellte sich auch nicht mit Namen vor. Irgendwann erhob er sich mit seinem Whiskyglas und sagte: „Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Falls jemand nach mir fragt – wir sind uns nie begegnet“ – und verschwand in der tropischen Nacht. Es hörte sich an wie aus einem schlechten Film, aber er meinte es ernst. Da blieben nur noch Benoît und X. übrig. Es war Benoît, der ihm das „Botanica“ empfahl und nebenbei erwähnte, man müsse dort keinen Pass vorzeigen. Er schwärmte ihm von Vanessa vor, einer Burunderin, in die er sich verliebt hatte. Eigentlich wollte er sie an diesem Abend ein letztes Mal treffen, aber seit 24 Stunden nahm sie das Telefon nicht mehr ab. Benoît war verwirrt, er konnte sich ihr Verhalten nicht erklären. Hatte sie ihr Handy verloren, wollte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben, oder war etwas Schlimmes passiert? Die Stunde seiner Abreise näherte sich, und er geriet immer mehr in Panik. Kurz vor der Fahrt an den Flughafen meldete sie sich, aber es war zu spät für ein Treffen. Benoît gab X. 200 Dollar und ihre Telefonnummer. Sie sollte später am Abend vorbeikommen, und X. würde ihr das Geld aushändigen.
X. wartete im «Botanica»-Hotel auf sie, im kleinen Restaurant des Innenhofs. Gegen elf Uhr nachts tauchte sie auf. Sie war nachlässig gekleidet und schmutzig, aber X. verstand sofort, warum Benoît so fasziniert von ihr war. Ihre Augen leuchteten, eine fast sichtbare Aura ging von ihr aus. Sie wollte nicht, dass X. ihr das Geld im Restaurant gab. Er ging zur Rezeptionistin, die eingezwängt hinter dem Eisenpult sass, und liess sich den Schlüssel geben. Die Decke war so niedrig, dass ihr der Ventilator bei einem brüsken Aufstehen die Haare wegrasiert hätte. Sie reichte ihm den Schlüssel für Zimmer Nr. 7. Das war das Zimmer von Benoît. Offensichtlich verwechselte sie ihn mit ihm, vielleicht, weil Benoît auch schon mit Vanessa hier gewesen war. In diesem Moment erst merkte er, dass es tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit zwischen ihm und Benoît gab. Darüber hinaus hatten Afrikaner oft Mühe, weisse Gesichter auseinanderzuhalten, so wie es Europäern oft auch umgekehrt mit ihnen ergeht. X. liess sich nichts anmerken und ging mir ihr in Benoît ehemaliges und jetzt leeres Zimmer. Sie erzählte ihm, dass sie verhaftet worden sei und eine Nacht im Gefängnis hinter sich hatte. Das Telefon hatte man ihr abgenommen, deshalb verpasste sie Benoîts viele Anrufe. Sie hatte Benoît nichts von ihrer Verhaftung erzählt, sie schämte sich. Nun, sagte sie, wolle sie so rasch als möglich nach Hause, um sich zu duschen und sich umzuziehen. X. sagte ihr, sie könne schon hier ein Bad nehmen, wenn sie wolle. Sie blickte ihn stumm und erstaunt an und lachte dann. Bevor sie ging, lud X. sie für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Er begleitete sie hinaus und hielt ein Taxi für sie an. Als er zurückkam, war niemand mehr an der Rezeption. Er schnappte sich seinen Schlüssel und brachte seine Sachen ins Zimmer Nr. 7. Am nächsten Morgen begrüsste ihn die Rezeptionistin mit „Bonjour Monsieur Benoît“.
Vanessa erschien tatsächlich zum Mittagessen. Sie gönnten sich in der Pergola des Hotels Stachelschwein mit Kochbananen und eine Flasche eisgekühlten Rosé. Nachher landeten sie im Bett. Sie setzte sich rittlings auf ihn und schlug ihm mit der Hand auf den Hintern, wenn er nachliess, und mit den Füssen auf die Oberschenkel, als ob er ein Pferd wäre und sie ihm die Sporen gäbe. Ein schlechtes Gewissen hatte er nicht. Er beendete gewissermassen für Benoît, was dieser angefangen hatte. Er brachte die Sache zu Ende, aber er machte es für ihn, in seinem Namen.
Am Abend gab sie ihm einige Texte, eine Art Tagebuch, die sie Benoît versprochen hatte. X. war neugierig auf ihren Inhalt, öffnete sie jedoch nicht und übergab sie, wieder in Europa, Benoît. Dass er mit ihr im Bett gewesen war, verschwieg er.
Was er allerdings nicht wusste: Vanessa erzählte Benoît alles, der X. jedoch nichts davon sagte. Dafür erzählte Benoît es mir, nach X.’ Verschwinden.
***
Ich ertappe mich bei der Fantasie, nach Bujumbura zu reisen und die Geschichte weiterzuführen. Ich könnte mich als Benoît oder als X. ausgeben (ich habe noch einen seiner Passports). Ich würde im selben Hotel Botanica absteigen, im selben Zimmer Nr. 7, und Vanessa anrufen. Ich kenne ihre Nummer (die bestimmt längst nicht mehr funktioniert – ich vergesse, wie viele Jahre das schon her ist! X. meinte manchmal auch, er könne irgendwohin zurückkehren und nahtlos dort weitermachen. Das ist eine Illusion, und wie viel mehr, wenn ich dort weitermachen will, wo jemand anders aufgehört hat. X. allerdings würde sagen: Natürlich kann ich in die Haut einer fremden Person schlüpfen – ich mache es dauernd! Und natürlich kann ich die Zeit austricksen – auch das tun wir unaufhörlich, ohne es zu merken).
(Der vorliegende Text ist ein bisher unveröffentlichter Auszug aus der entstehenden Erzählung «Tod eines Tricksters».)
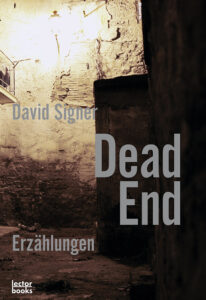 David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.
David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.
Signer schickt in seinem Erzählband weisse, europäische Männer im mittleren Alter ins Verderben. Ob in Varanasi oder in Zürich, alle jagen verlorenen Träumen und unstillbaren Sehnsüchten hinterher, neben denen die Fassaden der bürgerlichen Leben zu Staub zerfallen.
David Signer, geboren 1964, promovierter Ethnologe, hat mehrere Jahre in Afrika verbracht. Er ist Autor des zum Standardwerk gewordenen Buches «Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt» über die Auswirkungen der Hexerei auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Von 2016 – 2020 lebte er als NZZ-Afrikakorrespondent in Senegal, seit 2020 wohnt er in Chicago und berichtet für die NZZ aus Amerika und Kanada. Zuletzt erschienen von ihm die Erzählungen «Dead End» (Lector Books, 2017) und der Roman «Die nackten Inseln (Salis, 2010).
Im Herbst erscheint von ihm im NZZ Libro-Verlag das Buch «Afrikanische Aufbrüche. Wie mutige Menschen auf einem schwierigen Kontinent ihre Träume verwirklichen».





 Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.
Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.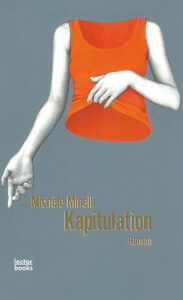 Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst.
Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst. 

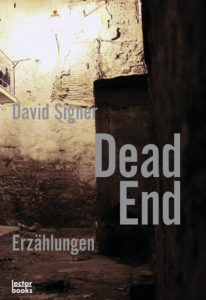 mit Recht vorsichtig. Weiss er doch, wie gerne sich mit der Sehnsucht und Gier des Menschen krumme Geschäfte machen lassen. Mit aller Vorsicht und Skepsis nimmt er Kontakt auf und fliegt dann doch nach Spanien, immer mit dem sicheren Gefühl, das Heft sicher in der Hand zu haben, die Zügel jederzeit herumreissen zu können, sich nicht einwickeln zu lassen. Aber ich als Leser ahne es, leide mit bis zum bitteren Ende.
mit Recht vorsichtig. Weiss er doch, wie gerne sich mit der Sehnsucht und Gier des Menschen krumme Geschäfte machen lassen. Mit aller Vorsicht und Skepsis nimmt er Kontakt auf und fliegt dann doch nach Spanien, immer mit dem sicheren Gefühl, das Heft sicher in der Hand zu haben, die Zügel jederzeit herumreissen zu können, sich nicht einwickeln zu lassen. Aber ich als Leser ahne es, leide mit bis zum bitteren Ende. David Signer, geboren 1964, ist promovierter Ethnologe. Er ist Autor des zum Standardwerk gewordenen Buches „Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt“ über die Auswirkungen der Hexerei auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Der Bild- und Textband „Grüezi – Seltsames aus dem Heidiland“, in Zusammenarbeit mit Andri Pol, erschien 2006, seine Romane „Keine Chance in Mori“ und „Die nackten Inseln“ 2007 und 2010 bei Salis. David Signer ist Afrika-Korrespondent der NZZ und lebt in Dakar.
David Signer, geboren 1964, ist promovierter Ethnologe. Er ist Autor des zum Standardwerk gewordenen Buches „Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt“ über die Auswirkungen der Hexerei auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Der Bild- und Textband „Grüezi – Seltsames aus dem Heidiland“, in Zusammenarbeit mit Andri Pol, erschien 2006, seine Romane „Keine Chance in Mori“ und „Die nackten Inseln“ 2007 und 2010 bei Salis. David Signer ist Afrika-Korrespondent der NZZ und lebt in Dakar.