2037: Das Weltgefüge hat sich nach globalen Kriegen verändert, der Kampf für Gottesstaaten ohne Ende, die Lust nach Zerstreuung ohne Ende und Bücher bloss noch Brennmaterial für ausgefallene Gastronomie der Superreichen und ewig Gelangweilten. Vladimir Sorokin schrieb eine Mischung aus Dystopie und Satire, einen Roman, der vor Witz und Seitenhieben sprüht, das Tagebuch eines von sich selbst Gefangenen.
 Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt.
Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt.
Chefkoch Géza hetzt mit seinem Koffer von kulinarischem Hotspot zu Hotspot. Schaschlik vom Stör auf dem Idioten, Hammelschulter auf Don Quichotte oder Thunfischsteak auf Moby Dick. Géza ist Meisterkoch für Book ’n’ Grill, jettet von Kontinent zu Kontinent, kassiert für ein Kunststück, eine „Lesung“ auf einem Grill gerne 10000 Pfund. Wirklich gelesen wird schon lange nicht mehr. Ist auch gar nicht notwendig, denn wer die nötigen flüssigen Mittel zur Verfügung hat, leistet sich elektronische Flöhe, die in den Ohren eingelassen flüstern, was wissenswert ist, selbstredend auch das, was in Büchern steckt. Mit der weltweiten Cloud vernetzt scannen die kleinen Dinger im Kopf alles ab, antworten auf Gedanken, kommunizieren gar. Géza braucht daher auch keine Freunde mehr, allerhöchstens die eine oder andere weibliche Haut, wenn nicht real, so doch zumindest per Order als Traum in seinen Kopf.
Bücher werden keine mehr gedruckt, höchstens Banknoten. Und weil man dem illegalen Genuss der Reichen einen Riegel schieben will, weil die Bibliotheken auf der ganzen Welt gerupft werden, steigen die Preise für Nachtigallen auf Puschkin, Pferdenüsse auf Majakowski oder Kalbsnüstern auf Pasternak ins Unermessliche, nicht zuletzt für die Kosten derer, die auch nicht vor Blut zurückschrecken, um an die Erstausgaben zu kommen. Géza ist stolz und selbstbewusst, schimpft jene Naiven, die glauben für seine Kunst brauche es keine besonderen Fähigkeiten, „jeder halbwegs versierte Koch könne ein Steak auf den Nackten und den Toten braten“.
 Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.
Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.
Vladimir Sorokin spielt mit Sprache, Geschichte, Zukunftsängsten und all dem, was schon in der Gegenwart schräge Züge entwickelt. Genuss ist alles, das Leben ein Spielplatz. Kunst ist Spektakel, die Literatur nur noch die Glut für Fleischeslust. Da taucht im Roman auch mehrfach Tolstoi auf, der dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht, einmal riesengross mit einem kleinen Mammut in seinem Gepäck oder in Originalgrösse auf einem Schloss mit Frau, Tochter und einem eben erst fertig geschriebenen Manuskript, das für Möhrenfrikadellen herhalten muss. Überhaupt ist der Roman ein Schaulaufen verquerer Figuren und Szenerien, voller Anspielungen, Metaphern und Seitenhieben, nicht zuletzt gegen die postsowjetische Literatur.
Ein grossartiges Literaturspektakel über Literaturspektakel der besonderen Art. Aber kein Buch für „Geschichtenverliebte“- eben ein Tagebuch.

Vladimir Sorokin, geboren 1955, gilt als der bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Russlands. Er wurde bekannt mit Werken wie «Die Schlange», «Marinas dreißigste Liebe», «Der himmelblaue Speck» und zuletzt «Der Tag des Opritschniks», «Der Zuckerkreml» und «Der Schneesturm». Zuletzt erschien von ihm der große polyphone Roman «Telluria». Sorokin ist einer der schärfsten Kritiker der politischen Eliten Russlands und sieht sich regelmäßig heftigen Angriffen regimetreuer Gruppen ausgesetzt.



 gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.
gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.

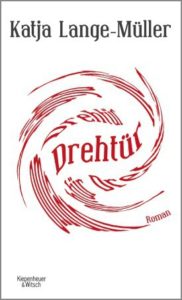 Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem?
Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem? Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.
Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.
 njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?
njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?
 nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq.
nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq. Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit.
Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit. hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.
hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.