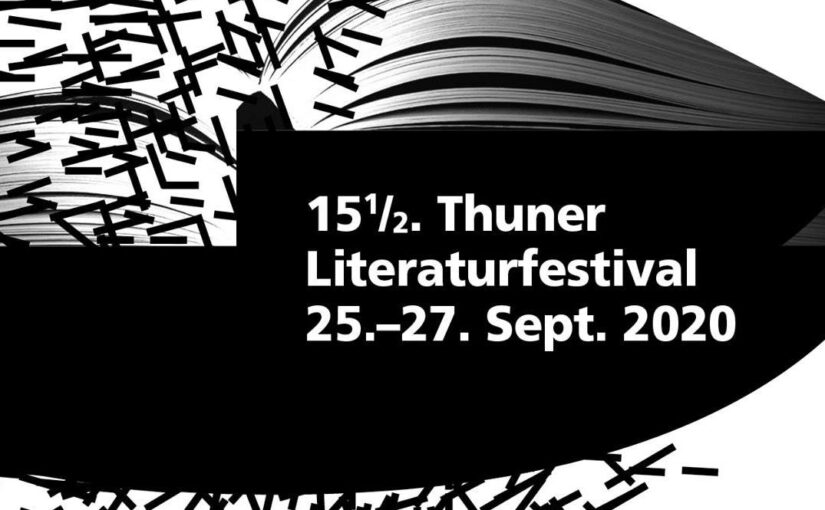Der zweite Eimer war einmal weiß. Er gehört zum Haus, er steht in der Ecke hinter den Fahrrädern. Dort steht auch ein Besen mit abgebrochenem Griff, eine Schneeschaufel, ein halbvoller Sack Streusalz. Die Fahrräder sind blau, im Prinzip, aber immer schmutzig; die Hausbewohner fahren über Feld- und Waldwege damit, kann man sich vorstellen, es kleben Schlammspritzer daran und manchmal Gras oder welkes Laub. Ich fege einmal über die Reifenprofile, ohne die Räder zu bewegen, ich fege die abgefallenen Erdkrumen unter den Gestellen zusammen, so gut es geht. Die Luft zieht unter der Hintertür herein, zerstreut den Schmutz und treibt ihn in neuen Anordnungen zusammen, fügt noch weiteren hinzu, Zigarettenstummel, Taubendreck, Grind von der Straße. Der Kellerraum gehört nicht zum Auftrag, aber es ist besser, ihn sauber zu halten, wenigstens einigermaßen, wenn es regnet vor allem, wenn feuchte Schuhsohlen die Brösel als Abdrucke im ganzen Haus verteilen.
Ich lasse Wasser in den zweiten Eimer laufen, obwohl er nicht mir gehört und nicht der Arbeit, das darf ich eigentlich nicht, das Eigentum der Hausbewohner ist unantastbar, aber den Eimer mit nach oben zu nehmen spart mir einmal Hinab und Hinauf, spart also Zeit, spart das Geld der Hausbewohner, so denke ich. Der Arbeitseimer glänzt speckig, neu und türkis. Unsere Eimer werden regelmäßig ersetzt, damit wir die Firma nicht blamieren. Sauber, sauber soll alles an uns sein, als wäre das eine ungebührliche Unterstellung, dass eine Putzfirma den Dreck anderer Leute aus den Häusern trägt.
Meine Gummihandschuhe sind gelb. Es gibt auch grüne Gummihandschuhe, die sind besser, die liegen enger an und man rutscht nicht überall ab damit, aber die grünen Handschuhe sind teurer als die gelben, die müssten wir uns selbst mitbringen, wenn uns die gelben nicht gut genug seien, heißt es aus dem Büro, mit freundlichen Grüßen. Die gelben Handschuhe werden regelmäßig ersetzt.
Die Eimer nicht zu voll, damit das Wasser nicht überschwappt und die Schultern nicht schon schmerzen, bevor man richtig angefangen hat. Ein Eimer mit Lauge, ein Eimer mit Wasser zum Nachwischen. Das Mittel kommt aus einer Flasche mit grasgrünem Etikett, das ist dem Kunden wichtig, sagt das Büro, dass wir etwas für die Umwelt tun.
Man fängt oben an. Oben in diesem Haus steht eine Garderobe auf dem Absatz vor der Tür, ein schmaler Schrank, ein Schuhregal. Ein Regenschirm lehnt an der Wand. Mobiliar im Gemeinschaftsbereich ist in all diesen Häusern untersagt. Wir verstehen das Problem und die Überlegung, knappe Wohnfläche, es geht nicht höher hinauf, also kein Durchgang, also stört man niemanden, so werden die sich das vorstellen, aber wir ärgern uns. Man braucht länger zum Wischen. Man kann sich die Beschwerden schon denken, die einem später das Büro mitteilen wird. Die Stelle mit dem Regenschirm spart man garantiert aus. Man muss aufpassen, dass man keine Dellen und Wasserflecken hinterlässt. Man muss sich diese Anzeichen von Wohnlichkeit ansehen, man muss sich jemanden unter diesen verblichenen Turnschuhen vorstellen, einen dünnen Mann stelle ich mir vor, mit sehnigen Armen und wochentags glattrasiertem Gesicht, einen Mann, der auch am Wochenende früh aufsteht, um durch den Park zu laufen in extra Sportkleidung, und gar nicht richtig ins Schwitzen kommt, stelle ich mir vor, und am Ende seiner Runde beim Bäcker Croissants holt für die Frau mit den drei Paar Stiefeln und das Kind, das hier auch wohnt und etwa sieben Jahre alt ist, kann man sich denken, ein blaues und ein braunes Paar Schuhe, Mädchen oder Junge, das weiß ich nicht, die Regenjacke hellrot, das ist uneindeutig, sein Kind oder nur das der Frau, oder umgekehrt, auch das weiß ich nicht, das will ich gar nicht wissen, dann beruht genug Nichtwissen auf Gegenseitigkeit.
Die meisten Bewohner bekommen mich nicht mit. Wenn alles gutgeht, verschwinde ich in meiner Arbeit, bin wie nie dagewesen, Sauberkeit sieht man nicht, nur den Dreck. Wüsste man’s, wenn man die Eimer sähe? Was sagt der zweite Eimer über mich, was sagt das Einsparen von Anstrengungen, was sagt die Farbe meiner Gummihandschuhe? Vielleicht ist das offen, eine Kreuzung, an der alles Mögliche zusammenlaufen kann.
Von rechts nach links, links nach rechts mit der Bürste, so die Treppenstufen hinab. Die Stufen sind dunkelgrau gefliest, man sieht jede Spur, wer sich Dunkelgrau ausdenkt für Treppen weiß nichts von Eimern und Gummihandschuhen, den Schmerzen im Nacken und im Kreuz. In diesem Haus muss ich mit klarem Wasser nachwischen, die Seifenlauge hinterlässt sonst Rückstände, und dann heißt es: die vom Putzdienst machen ihre Arbeit nicht, die schieben nur schnell den Dreck hin und her. Ich hebe den Fußabtreter auf und stelle ihn zusammengerollt auf die Kante, schiebe die Borsten und Krümel auf der Schaufel zusammen, die Schaufel ist aus neu glänzendem Plastik, türkis wie der Eimer. Ich wische eine klare Linie von der Tür bis zum nächsten Treppenabsatz. Der Fußabtreter ist sandfarben mit schwarzer Borte. In der Mitte steht ein einfältiger Spruch, der nicht mir gilt. Bevor ich gehe, werde ich den Fußabtreter zurücklegen, aber andersherum, so dass sich der Spruch der Person zuwendet, die aus der Wohnung hinaustritt, die hat mehr davon.
Von rechts nach links, links nach rechts mit der Bürste, weiter die Treppenstufen hinab. Nicht zu fest, nicht so, dass die Bürste gegen die Kanten knallt. Die Türen bleiben zu, aber manche melden sich im Büro, das ist zu laut, sagen sie, das stört uns beim Verrichten wichtiger Dinge. Dabei bin ich allein gar nicht laut. Wenn er mitkommt, dann ja, wenn er nicht auf mich hört, wenn ich sage, er müsse stiller sein, wenn er, was er immer tut, die Teppiche kommentiert und die Schuhe, die Namen auf den Klingelschildern. Er kommt zum Helfen mit, wie er sagt, damit mir die Arbeit schneller von der Hand gehe, damit meint er nicht, damit ich schneller fertig sei und Zeit hätte für Eigenes, Spaziergänge oder Sport oder was die Leute in ihrer Freizeit tun, sondern dass ich danach außerhalb der Firma Aufträge annehmen, mehr Geld verdienen könne, das meint er, dass wir „uns was leisten“ könnten, zum Beispiel eine Reise zu den Eltern oder einen größeren Fernseher oder vielleicht irgendwann ein Auto, das nicht alle paar Wochen einen neuen Schaden hat. Der Fernseher interessiert mich nicht und mit dem Auto lässt er mich dann doch nicht fahren, nicht einmal zum Supermarkt. Wozu es denn Busse gebe, wozu denn unnötig Benzin verfahren, der Bus halte doch alle halbe Stunde fast direkt vor der Tür. Sein Auto ist grau, er nennt die Farbe „metallic“. Das Auto wäscht er jeden zweiten Samstag ab, auch im Winter, er hat extra Schwämme und Lappen dafür. Danach ist er gut gelaunt. Er fährt zu seinen Freunden und lässt mich mit seinen Kindern allein. Ich müsse nichts machen, sagt er, ich könne gern fernsehen, die Kinder kämen allein zurecht und schließlich habe jedes ein Zimmer für sich, ein eigenes Zimmer, das habe es in unserer Kindheit nicht gegeben. Er sagt das, als wüssten Kinder nicht, was ein Dachboden sei, und als müsste er nicht im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen. Er sagt es, als wären wir alt jenseits von Wünschen für die Zukunft.
Der Fernseher nimmt das halbe Wohnzimmer ein, ein großes schwarzes Fenster ins Nichts. Wenn er keine Aufträge habe, müsse er sich beschäftigen, sagt er, aber bewegen könne er sich nicht, weil ihm von der Arbeit die Anstrengung noch in den Knochen stecke, ganz tief in den Knochen, das könne ich mir gar nicht vorstellen, diese Müdigkeit immerzu. Ich sage nichts. Ich koche und putze und beziehe die Betten neu.
Manchmal, wenn wir uns vertragen, setze ich mich neben ihn und sehe, was er sieht auf dem großen Bildschirm. Manchmal bringe ich ihm ein Bier aus dem Kühlschrank und nehme mir auch eins. Wenn die Mutter uns sähe, sagt er dann, wie wir hier sitzen. Wie wir hier sitzen, sage ich, wie wir die Flaschen ohne Untersetzer auf den Tisch stellen, das gäbe schön Streit. Dann lachen wir beide.
Sie dürfen Ihren Mann nicht mit zur Arbeit bringen, heißt es aus dem Büro, aber er ist nicht mein Mann, er ist mein Bruder, einen Bruder wird man nicht los, schon gar nicht, wenn man das Haus der Eltern mit ihm teilen muss, weil es sonst nicht geht, weil man leider sogar Geld braucht, bevor man sich ein Haus aufteilen kann, das einem schon gehört.
Für die letzten beiden Treppen lasse ich frisches Wasser in die Eimer laufen, denn unten ist es schmutziger als oben, dort kommen mehr Menschen vorbei, einfache Rechnung. Wenn jetzt nur niemand hinausmuss. Wenn jetzt nur niemand hereinkommt und über die feuchten Fliesen stapft. Aus der Wohnung im Erdgeschoss riecht es nach Essen. Eine Frau singt ein Lied aus dem Radio mit. Leise, leise wische ich an der Türkante vorbei, damit sie mich nicht hört und mir einen Kaffee anbietet. Sie hat das schon mehrfach versucht und sah ehrlich enttäuscht aus, als ich den Kopf schüttelte. Das Büro gestattet solche Pausen nicht. Wir sollen die Bewohner in Ruhe lassen. Was, wenn euch jemand sieht, wie ihr Geld verdient mit Kaffeetrinken, heißt es. Das könne man sich als Firma nicht erlauben.
Ich schwenke beide Eimer sorgfältig aus, auch den alten, der zum Haus gehört. Auf dem Weg nach oben wische ich mit einem sauberen Lappen das Geländer ab. Das machen nicht alle. Einige nehmen mit Bedacht den schmutzigen Lappen und freuen sich, wenn sie an die Bewohner denken, die sich an ihrem eigenen Dreck festhalten beim Treppensteigen. Ich sehe das nicht ein, einen Schaden zuzufügen, dessen Erfolg man nicht überprüfen kann. Ich lege die Fußmatten zurück. Ich bin fast fertig. Die Kellertür steht noch offen, ich muss noch meine Jacke holen und meine Handtasche. Meine Jacke ist alt, wer zieht sich auch schön an zum Putzen, und die Handtasche praktisch. Ich betrachte kurz meine Hände, die sind aufgequollen, ein bisschen grau an den Gelenken, und tun weh.
Entschuldigung, sagt die Frau beim Eintreten, es tue ihr sehr leid, aber sie müsse nach oben.
Die Frau trägt einen hellen Wollmantel und eine Handtasche, die ich aus einer Reklame kenne. Sie hält inne, als warte sie auf meine Erlaubnis.
Ist trocken, sage ich, kein Problem.
Die Mülltonne müsse ich nicht in den Keller tragen, sagt die Frau und lächelt, die könne ich gern draußen stehen lassen, ihr Mann kümmere sich am Abend darum, ich müsse die nicht schleppen.
Die Mülltonne gehört nicht zum Auftrag, für die bin ich nicht zuständig. Ich hätte sie auch so stehen lassen.
Danke, sage ich. Ich warte, bis sie ihre Wohnungstür schließt und wische noch schnell die Stufen nach, bevor ich gehe.

Elise Schmit wurde 1982 in Luxemburg geboren und ist dort aufgewachsen. Sie hat Germanistik und Philosophie an der Universität Tübingen studiert. Nach zwei längeren Aufenthalten in Tübingen und einem kürzeren in Paris lebt und arbeitet sie seit 2012 wieder in Luxemburg. Mehrfach wurden ihre Texte beim Concours littéraire national in Luxemburg ausgezeichnet, unter anderem die Erzählung «Im Zug». «Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen» ist ihre erste eigenständige Buchveröffentlichung.
Beitragsbild © Boris Loder



 Ich freue mich auf Namen, die ich kenne, auf die Gesichter, die einem immer wieder einmal begegnen, die einen gar freundschaftlich zugewandt. Aber wenn ich ein Literaturfestival besuche, ist da immer auch die Hoffnung, überrascht zu werden. Vielleicht überrascht die Person hinter dem Buch. Aber manchmal überrascht alles. So wie bei «Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen», so wie bei der Luxemburgerin Elise Schmit!
Ich freue mich auf Namen, die ich kenne, auf die Gesichter, die einem immer wieder einmal begegnen, die einen gar freundschaftlich zugewandt. Aber wenn ich ein Literaturfestival besuche, ist da immer auch die Hoffnung, überrascht zu werden. Vielleicht überrascht die Person hinter dem Buch. Aber manchmal überrascht alles. So wie bei «Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen», so wie bei der Luxemburgerin Elise Schmit!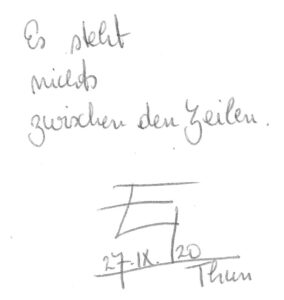 Irgendwann begann sich Elise Schmit für Stürze zu interessieren. Die Liste allein erzählt Bände. Alles mehr als Sinnbilder des «Sturzes», von banal bis Fanal, von unscheinbar bis weltbewegend. Die Stürze in Elise Schmits Erzählband sind Variationen Herausgefallener, nach innen, nach aussen, meist in Einsamkeit und Isolation.
Irgendwann begann sich Elise Schmit für Stürze zu interessieren. Die Liste allein erzählt Bände. Alles mehr als Sinnbilder des «Sturzes», von banal bis Fanal, von unscheinbar bis weltbewegend. Die Stürze in Elise Schmits Erzählband sind Variationen Herausgefallener, nach innen, nach aussen, meist in Einsamkeit und Isolation.