In seinem ersten Roman schickt der Schweizer Autor Fabian Schaefer drei Kantone in einen Bürgerkrieg und entfaltet darin Geschichten, die in ein buntes Kaleidoskop mit allzu menschlichen Facetten mündet.
„Ein Plädoyer für Teilhabe“
Urs Heinz Aerni stellte ihm zu diesem Buch Fragen.
Urs Heinz Aerni: Mit Ihrem schwer in den Händen liegenden Roman «Artovia» schicken Sie die Lesenden durch eine Riesengeschichte, die den aktuellen Zeitgeist mit in die Zukunft nimmt und einen Schweizerischen Bürgerkrieg auslösen lässt. Erinnern Sie sich, durch was Sie auf diese Idee gekommen sind? Etwa bei der Lektüre von «Vom Winde verweht» oder durch den Film «Die Klapperschlange» von John Carpenter?
Fabian Schaefer: (lacht) Im Zug von Zürich nach Brugg. Die Leere um den Güterbahnhof vor Spreitenbach mitten in der Zugfahrt hat mich immer fasziniert. Ich habe mich eines Tages unvermittelt gefragt: Was wäre, wenn hier ein Wall stehen würde, ein wirklicher, nicht nur irgendein «geistiger». Und dann kam natürlich die Frage, warum könnte der da stehen? Auf der anderen Seite stand der Wunsch, was alles in einer mir derart vertrauten Geographie entstehen könnte, wenn die Fantasie einmal frei ist. Ein Thriller, wie eine Fernsehserie vielleicht, ja, aber nicht schon wieder in «New York», sondern hier, bei uns.
Aerni: Dieser Impuls mutierte sich nun zu diesem Roman…
Schaefer: Ja, aus den spontanen Gedanken hat sich Argovia entwickelt, eine nahe Zukunft, und darin verwoben meine eigenen Erfahrungen und Bilder zwischen Basel, Brugg, Aarau und Zürich, erlebte Anekdoten und erinnerte Gespräche und Personen. In diesem Sinne ist das alles auch autobiographisch. Und davor laufen dann Formen und Muster ab, die mir aus Romanen, TV-Serien, Filmen, Graphic Novels geblieben sind.
Aerni: Eine Art das Zusammenführen von Puzzle-Teilen?
Schaefer: Alles Erzählungen, aber auch zeitlose Gleichnisse irgendwie, die Haltungen aufbauen und zusammengesetzte, wichtige Bruchstücke sind, um ein Ganzes zu beleuchten. Das ist vermutlich einerseits vielleicht Zeitgeist, aber es geht hoffentlich sogar tiefer.
Aerni: Ihr Roman bespielt diverse Ebenen. Eine davon ist auch die exakte Konstruktion von politischen und militärischen Ereignissen, die jedoch im Kontext stehen mit Heute oder sich daraus entwickeln. Wer von den gesellschaftlichen Verantwortungstragenden müsste dieses Buch unbedingt lesen?
Schaefer: Ich stimme zu – die meisten Themen von Argovia sind heute schon da, und können vielleicht Beteiligten in der politischen Debatte helfen, es sich bei wichtigen Themen wie Migration, Stadt-Land-Gefälle oder auch Künstliche Intelligenz mit schnell geäußerten Standpunkten doch etwas schwerer zu machen. Das betrifft dann aktive Politiker, aber etwa auch uns alle vor Abstimmungen. Diese Ableitung aus dem Heute ist sicherlich ein wichtiger Reiz von Argovia: bestehende Themen zu benennen, und sie weiterzudenken, auch kontrovers, um Nachdenken auszulösen.
Aerni: Also schon gewisse Appellationen an die aktuelle Generation?
 Schaefer: Ich glaube, dieses Aufrütteln ist mir gelungen. Ich habe Bemerkungen erhalten wie: «Unsere Schweizer Armee würde so etwas niemals tun“ oder „Wir sind nicht so hier in der Schweiz». Vielleicht nicht. Es ist ja ein Roman, keine detailversessene Militär- oder Nationalgeschichte. Aber diese Aussagen zeigen doch, dass man sich angesprochen fühlt. Sie bestärken mich, dass der Roman etwas auslöst. Und das möchte ich auch erreichen. Er ist klar ein Plädoyer für mehr Offenheit und Teilhabe. Dazu braucht es eine bewusste Sicht auf das, was heute ist.
Schaefer: Ich glaube, dieses Aufrütteln ist mir gelungen. Ich habe Bemerkungen erhalten wie: «Unsere Schweizer Armee würde so etwas niemals tun“ oder „Wir sind nicht so hier in der Schweiz». Vielleicht nicht. Es ist ja ein Roman, keine detailversessene Militär- oder Nationalgeschichte. Aber diese Aussagen zeigen doch, dass man sich angesprochen fühlt. Sie bestärken mich, dass der Roman etwas auslöst. Und das möchte ich auch erreichen. Er ist klar ein Plädoyer für mehr Offenheit und Teilhabe. Dazu braucht es eine bewusste Sicht auf das, was heute ist.
Aerni: Der Verlierer eines Bürgerkrieges zwischen den verdichteten Agglomerationen von Basel und Zürich, ist der Aargau. Eine literarische Lektion für falsche Tendenzen in diesem Kanton?
Schaefer: Vordergründig brauchte es zuerst einmal Spannung und einen Konflikt. Ich wollte ja einen Thriller schreiben, ich wollte die Guten und die Bösen. Da ist eine lebensweltliche Grenze um das Gebiet des Aargaus einfach vermittelbar, und ein gerade zu Ende gegangener Krieg bietet ebenfalls vielfältige Ansätze.
Aerni: Die Geographie des Kantons spielte eine Rolle?
Schaefer: (nachdenklich) Das Geographische ist nur eine Art, wie wir Gegensätze wie den von «Heimatidentität» und dem «Fremden» verstehen und entschärfen müssen. Ich glaube, unsere Debatten und Abstimmungen in der Schweiz zeigen immer wieder, dass sich durch die Gesellschaft vielfältige Grenzen ziehen.
Aerni: Die Siegermächte…
Schaefer: …im Roman ist die Bilanz ja durchaus gemischter: Die Menschen in Turikum und Basilea nehmen etwa die Droge Tyla, nicht unproblematisch! Und angedeutet werden auch die Gefahren von Datenmissbrauch und Künstlicher Intelligenz. Eine gestiegene Bedeutung des Ständischen und der «Alten Familien», und eine hohe Militarisierung, bestehen auch in Basilea und Turikum, nicht nur in Argovia – überall gibt es weniger Demokratie als nach unserem heutigen Selbstverständnis. Auch Verrat gibt es zudem diesseits und jenseits der Wälle…
Aerni: Der ziemlich allgemein reich befrachtete Begriff «Heimat» scheint Sie auch umzutreiben?
Schaefer: Man muss das Thema «Heimat» schon genau lesen, sonst tappt man in die aufgestellte Falle: fast alle Hauptpersonen, die «Guten» wie die «Schlechten», sind ja Argovier, also, «Aargauer». Auch diejenigen mit vormals ausländischem Hintergrund sind alle dort aufgewachsen, etwa Enn oder Ibraïm! Und die wenigsten, ob gut oder böse, haben umgekehrt keine ausländischen Wurzeln. Es geht mir um die Frage, was ist überhaupt Heimat, was ist «das Fremde». Heimat als Idee wird dabei überhaupt nicht abgewertet.
Aerni: Sie benutzen Ortsbezeichnungen wie Basilea, Argovia und Turikum. Warum?
Schaefer: Das ist zunächst einmal eher lustvoll, es geht um Sprachklang und ein Spiel mit Referenzen. Aber dennoch: Diese Distanzierung, Verfremdung der bekannten, möglichst genau eingehaltenen Geographie schafft etwas Entfernung, die man nutzen kann, um sich nur noch deutlicher zu fragen, was ist wirklich, oder wird bald wirklich, und was ist Fiktion.
Dies betrifft etwa auch die Namensgebung für Personen. Man hat mich gefragt, warum keine der HeldInnen «Regula» oder «Felix» heißen, etwa, um den «Lokalkolorit» zu verstärken. Wobei übrigens hier hinzukommt, dass derartige Namen ohnehin heute in der Schweiz vor lauter Ann-Sophies, Chayennes, Tabeas, Leahs oder Kevins, Noahs, Lucas, Léons und Finns kaum noch zu finden sind.
Aerni: Die Lektüre lenkt uns nicht nur durch Konflikte, zerstörte Infrastrukturen – wir denken mal hier gar nicht an die AKWs, sondern auch durch durch Ängste und Hoffnungen von Menschen, wie beispielsweise des Biochemikers Chan Effas. Er scheint Ihnen nahe zu stehen, oder?
Schaefer: Ja, Chan ist ja in gewisser Weise eine Linse des Romans, ein Beobachter wie ich es als Autor bin. Das bringt uns schon Nähe. Es ist spannend, durch ihn alles aufbauen und erleben zu können. Er beobachtet sein Zuhause, Turikum, und das von Xhyna, Basilea, ganz genau. Etwa am Akademieball. Und dann folgt er mitten durch Argovia allen Seiten und Fraktionen. Argovia entfaltet sich vor Chan gewissermaßen, zusammen mit dem Lesenden. Ich will hier natürlich gar nicht alles erzählen, aber wie es das Cover des Romans ja schon zeigt, stehen dabei auch starke, prägnante Frauenfiguren im Vordergrund der Handlung. Auch wenn ich das alles natürlich nicht selbst erlebt habe, ist von mir hier auch manches autobiografisch gefärbte eingeflossen. In den Gedanken und Szenarien, aber auch in vielen Einzelheiten der Beschreibungen.
Aerni: Dystopie ist momentan in der Literaturszene in aller Munde, so als Kontrastprogramm zur Utopie. Wie groß ist Ihr Vertrauen nach dem Verfassen dieses Romans in die internationale Politik, Wirtschaft und Technik?
Schaefer: Mein Roman ist zu technisch-gesellschaftlichen Fragen bewusst ambivalent ausgelegt, vielleicht auf eine Art ausgewogen zu Chancen und den Gefahren. Ein Sinnbild hierfür sind etwa die Wälle, die trennen, aber auch transparent sein können und so verbinden, Tiere auf deren Weg nicht behindern und die selbst bewusst sind und irgendwie zu uns sprechen. Ich halte den Roman nicht für eine Dystopie – Eher möchte er zeigen, dass es zu allem ein Für und Wider gibt, das ist heute wohl nicht anders als zu früheren Zeiten. – Argovia ist ja Teil einer Triologie, ich arbeite jetzt an Turikum, mal sehen, wohin es sich in dieser Hinsicht entwickeln wird.
Aerni: Hat die Arbeit an diesem Buch auch gewisse Meinungen verändern lassen?
Schaefer: (überlegt) Durch die Recherche bin ich zu den einen oder anderen neuen Informationen gekommen, z.B. zu Diskussionen um ein «Hyperloop»-Projekt für die SBB oder zur Künstlichen Intelligenz im militärischen Bereich. Aber ich denke, der Hauptpunkt ist, dass ich mich selbst überrascht habe, wie wichtig mir Integration und auch der Glaube an das Richtige und Gute im Grunde sind. Wenn man in aller Ruhe nachdenkt, sich die Zeit nehmen darf, sein eigenes «Science Fiction» – Buch im Hier und Jetzt zu schreiben (lächelt), kommen die wesentlichen menschlichen Fragen und Erkenntnisse vielleicht immer irgendwie hervor. Werden fast zwingend.
Aerni: Das Wechselspiel zwischen dem Erzählen von großen Prozessen und den Dialogen und Gedanken der Protagonistinnen und Protagonisten währt bis Seite 458, dann folgt eine sachlich gehaltene Chronologie des Schweizerischen Bürgerkrieges. Wo lagen für Sie die größten Herausforderungen beim Verfassen?
Schaefer: Ich wusste zuallererst, ich will Wälle aufstellen, und ich wusste, wo. Dann wurde mir die allerletzte Szene im Roman, auf die alles, wirklich alles hinausläuft, klar. Aber ich wollte die Handlung in diesem Jahr 2031 aus dem Heute heraus glaubhaft entwickeln. Daher entstand, noch vor den ersten Skizzen zum Hauptteil des Romans, die Chronologie. Sie musste Heutiges in einer möglichen Weise weiterentwickeln. Sie gibt den Boden ab, auf dem sich dann die Handlungen und Nebenhandlungen, Personen und Dialoge wie auf Bahnen auf den Schluss hin entwickeln. Eine wichtige Herausforderung war, dass alles zueinander passen musste. Da habe ich oft und viel hin und her abgestimmt.
Aerni: Mit welcher geistigen Verfassung, sollte die Leserin und der Leser Ihren Roman aufschlagen?
Schaefer: Neugierig, offen, auch kritisch. Aber vor allem darf man sich einfach genussvoll auf eine spannende Reise voller Wendungen begeben, den bekannten aber verfremdeten Orten wie auch den Wendungen der Geschichte folgen. Man hat hier wahlweise zum Beispiel einen Politthriller, einen Zukunftsroman, eine Liebesgeschichte und einen Heimatroman vor sich. Ich glaube, es ist mir gelungen, das Spielerische dabei nicht zu kurz kommen zu lassen.
 Fabian Schaefer, 1973, studierte Kulturmanagement an der Universität Basel. 2015 erschien im selben Verlag seine Kurzgeschichtensammlung «Aus der Erstarrung». Beruflich ist Fabian u.a. im Kulturbereich in der Umsetzung betrieblicher Strategien, der Organisationsgestaltung und als Unternehmensberater tätig. Zu seinen Interessen zählen klassische und moderne Literatur, Sprach- und Theaterwissenschaft, Anthropologie und Kulturwissenschaft und zeitgenössische bildende Kunst.
Fabian Schaefer, 1973, studierte Kulturmanagement an der Universität Basel. 2015 erschien im selben Verlag seine Kurzgeschichtensammlung «Aus der Erstarrung». Beruflich ist Fabian u.a. im Kulturbereich in der Umsetzung betrieblicher Strategien, der Organisationsgestaltung und als Unternehmensberater tätig. Zu seinen Interessen zählen klassische und moderne Literatur, Sprach- und Theaterwissenschaft, Anthropologie und Kulturwissenschaft und zeitgenössische bildende Kunst.


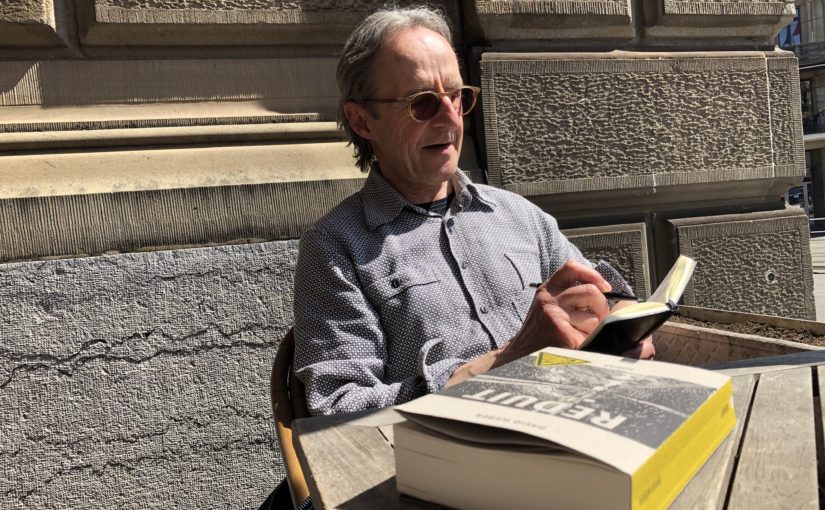
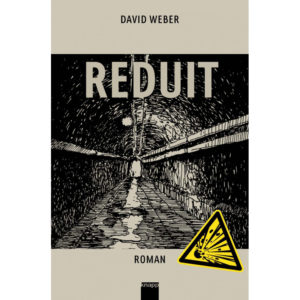 Weber: Ich habe die städtebaulichen Entwicklungen in der Agglomeration Zürich mitverfolgen können. Es gibt viele positive Ansätze und viele ernüchternde Fehlplanungen. Die Frage des Maßstabs und der adäquaten Nutzungen bilden viel Konfliktpotential. Private Investoren suchen in erster Linie die Rendite, nicht den Konsens mit der Stadt und ihren Bewohnern.
Weber: Ich habe die städtebaulichen Entwicklungen in der Agglomeration Zürich mitverfolgen können. Es gibt viele positive Ansätze und viele ernüchternde Fehlplanungen. Die Frage des Maßstabs und der adäquaten Nutzungen bilden viel Konfliktpotential. Private Investoren suchen in erster Linie die Rendite, nicht den Konsens mit der Stadt und ihren Bewohnern. David Weber, Architekt, Musiker und Autor, lebt und schreibt in Zug und Caccior (Bergell). Er studierte «Literarisches Schreiben» an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Sein erster Roman „Kral“ erschien 2018 und sein neuer Roman „Reduit“ in diesen Tagen im Knapp Verlag.
David Weber, Architekt, Musiker und Autor, lebt und schreibt in Zug und Caccior (Bergell). Er studierte «Literarisches Schreiben» an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Sein erster Roman „Kral“ erschien 2018 und sein neuer Roman „Reduit“ in diesen Tagen im Knapp Verlag.
 Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.
Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.
 mich in die Person hineinversetzen können, aus deren Warte ich schreibe. Wenn es bedrohlich wird oder wenn Aktion vonnöten ist, was im Krimi öfters vorkommt, ist es nicht eine Frage des Geschlechts, sondern des Charakters, wie man sich in einer bestimmten Situation verhält. Cora Johannis packt zu, wenn es sein muss. Das entspricht ihrer Persönlichkeit und geschieht unabhängig davon, dass sie eine Frau ist. Wenn sie sich um ihre Kinder Sorgen macht, oder wenn sie sich einem Mann zugetan fühlt, versuche ich zu beschreiben, wie sie sich als Mutter und liebende Frau verhält. Das erfordert Einfühlungsvermögen und Beobachtungen im täglichen Umgang mit beiden Geschlechtern. Die Herausforderung dabei ist es, Klischees und Stereotypen möglichst zu vermeiden.
mich in die Person hineinversetzen können, aus deren Warte ich schreibe. Wenn es bedrohlich wird oder wenn Aktion vonnöten ist, was im Krimi öfters vorkommt, ist es nicht eine Frage des Geschlechts, sondern des Charakters, wie man sich in einer bestimmten Situation verhält. Cora Johannis packt zu, wenn es sein muss. Das entspricht ihrer Persönlichkeit und geschieht unabhängig davon, dass sie eine Frau ist. Wenn sie sich um ihre Kinder Sorgen macht, oder wenn sie sich einem Mann zugetan fühlt, versuche ich zu beschreiben, wie sie sich als Mutter und liebende Frau verhält. Das erfordert Einfühlungsvermögen und Beobachtungen im täglichen Umgang mit beiden Geschlechtern. Die Herausforderung dabei ist es, Klischees und Stereotypen möglichst zu vermeiden.
 Heydinger, der in den Literatenkreisen »Jung-Wiens« verkehrt und im Salon der aufstrebenden Sopranistin Lena von Rother und ihres Vaters ein- und ausgeht, gerät zusehends in den Bann des Fremden, den er in Wien wiedertrifft. Als der Mann eines Tages plötzlich in seiner Sprechstunde erscheint, entpuppt er sich als kokainsüchtiger Amateurdetektiv, den neben einer unglücklichen Liebe vor allem eines an Wien bindet: die finsteren Machenschaften der Geheimgesellschaft »Die Schwarze Hand«.
Heydinger, der in den Literatenkreisen »Jung-Wiens« verkehrt und im Salon der aufstrebenden Sopranistin Lena von Rother und ihres Vaters ein- und ausgeht, gerät zusehends in den Bann des Fremden, den er in Wien wiedertrifft. Als der Mann eines Tages plötzlich in seiner Sprechstunde erscheint, entpuppt er sich als kokainsüchtiger Amateurdetektiv, den neben einer unglücklichen Liebe vor allem eines an Wien bindet: die finsteren Machenschaften der Geheimgesellschaft »Die Schwarze Hand«.
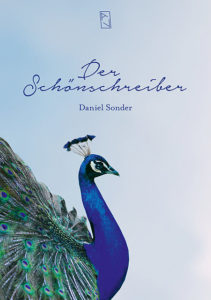 Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen.
Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen. Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.
Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.
 Ciarloni: Es sind beide. Vielleicht zuerst die Umstände, denn sie bringen mich irgendwohin im Leben und dort treffe ich auf Menschen. Zusammen gestalten wir wiederum die Umstände oder ich habe überhaupt nichts zu schaffen mit ihnen, sondern sehe sie bloß oder höre sie reden. Der Rest ist meine Art, auf die Welt und die Menschen zu schauen. Dann entstehen Gedanken, dann entstehen Geschichten.
Ciarloni: Es sind beide. Vielleicht zuerst die Umstände, denn sie bringen mich irgendwohin im Leben und dort treffe ich auf Menschen. Zusammen gestalten wir wiederum die Umstände oder ich habe überhaupt nichts zu schaffen mit ihnen, sondern sehe sie bloß oder höre sie reden. Der Rest ist meine Art, auf die Welt und die Menschen zu schauen. Dann entstehen Gedanken, dann entstehen Geschichten.