Gilbert träumt: Er sitzt in einem Zugabteil neben zwei Frauen. Sie stellen sich mit einer kleinen Verbeugung vor. Martha sagt, sie heißen Ida und Martha. Ida ist stumm, da sie aus ihrem Mund eine Gebirgslandschaft bläst. Sie hört nicht auf, bis alle Berggipfel vollzählig sind und die Wolken einen Himmel gebildet haben. Martha trägt eine Fellmütze auf dem Kopf. Endlich knarrt Ida: Der Arzt sagt, Sie sind ein Engel. Gilbert: Sprechen Sie mit mir? Martha wiederholt: Der Arzt sagt, Sie sind ein Engel. Sie nestelt in ihrer Handtasche, gibt ihm zwei verschlossene Briefumschläge. Er öffnet sie, beide Karten sind unbeschrieben. Ida und Martha ziehen schwarze Lederhandschuhe an. Sie nähern sich seinem Hals, drücken auf seinen Kehlkopf. Er zieht eine Bratpfanne aus der Hosentasche. Gilbert schlägt auf Idas und Marthas Köpfe. Die Pfanne gewinnt. Das Abteil verwandelt sich in einen Hotelflur. Martha ruft den Aufzug herbei. Der Aufzug stürzt ab.
An einem Sonntagmorgen, die Kopfschmerzen lagen noch im Bett, und auf den Straßen herrschte schüchterner Verkehr, schüttelte Gilbert den Traum ab, einen Wiederkehrer, und beschloss statt einer Dusche ein Sandbad zu nehmen. Er füllte die rote Plastikwanne seiner Kinder mit Vogelsand und warf sich, Rücken voran, in den Sand; die Beine und Füße wälzte er zuletzt. Anschließend schüttelte er sich so lange, bis er den Sand vollkommen losgeworden war, und lief in die Küche, wo er ein hart gekochtes Ei und eine Scheibe Toastbrot in seine Backen schob, ohne zu kauen. Im Badezimmer spuckte er die Ladung in den Wäschekorb, die Reste, die in den Zähnen und Wangen stecken geblieben waren, holte er mit den Fingern hervor und schmierte sie dazu. Er schloss den Korb und lief erneut in die Küche, wo er Kaffee aus der Kanne schleckte. Beim Hinauslaufen packte er ein paar Salamischeiben, etwas Vollkornbrot und eine Gewürzgurke in die Wangen und spie die Mischung auf die Dreckwäsche. Danach lief Gilbert in die Abstellkammer zum Schlafen, in einen dunklen Raum unter der Treppe, der wegen der Heizrohre in der Wand warm war.
Als er erwachte, waren seine Lippen zerbissen, und es war ihm kaum möglich, den Mund zu schließen. Seine Zähne waren gewachsen; Gilbert überprüfte dies mit Hilfe eines Spiegels und eines Lineals. Noch während er sie abtastete, musste er feststellen, dass sie bereits weitergewachsen waren, so beschloss er, sie an einem Tischbein abzuwetzen. Er wieselte aus der Kammer, blieb aber mit einer Wange an der Türklinke hängen. Auch die Backen hatten sich verändert, wieder griff Gilbert zum Spiegel, sie hatten sich in Hängebacken verwandelt, reichten bis zur Kinnspitze und schlabberten bei jeder Bewegung. Gilbert machte dies allerdings nichts aus, im Gegenteil: Sie gefielen ihm besser als vorher. Zufrieden ließ er sie in seinen Händen auf und ab hüpfen, als wären sie Brüste.
Es begann zu dämmern, Gilberts Magen knurrte laut und anhaltend. Auf Salami hatte er keine Lust mehr, wohl aber auf Vollkornbrot. Nach dem mühsamen Abendessen, es bestand aus Sonnenblumenkernen, die er mit seinen Zähnen und Fingern aus den Fitnessbrötchen pulte, verspürte er den Drang zu laufen. Laufen gehörte zu den Dingen, die Gilbert früher stets vermieden hatte: Nie wäre er gerannt, um einen Bus zu erwischen, und schon gar nie aus Spaß. Doch heute drängte es ihn geradezu danach zu rennen, er war besessen von dem Wunsch, die Beine zu bewegen, den Wind in den Haaren und hinter den Ohren zu spüren. Hin und wieder schlich sich der Gedanke an Sonnenblumenkerne ein, dann hielt er Ausschau nach einem weiteren Fitnessbrötchen, schließlich aber gewannen die Füße die Oberhand, und er nahm sie unter die Arme und rannte los, aus dem Haustor, die Straße hinauf zur Busstation und weiter nordwärts bis zum Ende der asphaltierten Wege; er lief auf verlassenen Schienen, die mit Gras überwuchert waren, Gras und Unkraut, rannte auf ein Wäldchen zu, über eine Wiese, und verrannte sich. Da er sich nicht entscheiden konnte, in welcher Richtung er weiterrennen sollte, rannte er auf der Stelle, nur um zu rennen. Als er ein verdächtiges Knacksen hinter sich hörte, floh er in den U-Bahn-Schacht.
Für die Zwillinge vergingen die Stunden im Hort zu langsam, die Mädchen starrten auf die große Uhr mit dem römischen Zifferblatt, hatten aber das Gefühl, die Zeiger bewegten sich nicht, tatsächlich waren sie sich nicht sicher, ob der Zeitzähler überhaupt Zeit zählen konnte. Zudem mussten sie stillsitzen, ein Buch in der Hand war alles, was ihnen gestattet war; die Beine brav übereinander geschlagen, und aus den zusammengebundenen Haaren verirrte sich keine Strähne. Die Aufpasserin war stets auf der Suche nach Briefchen, die die Mädchen einander zusteckten. Vielleicht aber, meinte der eine Zwilling, war sie nicht auf der Suche nach Briefchen, sondern dabei, ihre Nummer zu proben. Nummer, fragte der andere. Siehst du denn nicht, sagte daraufhin der eine Zwilling, dass sie eine Schlangenfrau ist?
An der Haltestelle stiegen die Zwillinge in die Tram und pressten ihre Gesichter an die Glasscheibe: Ein Luftballon versuchte dem Gartenzaun zu entkommen. Plötzlich sprang ein Mann auf die Schienen, der Schaffner zog die Notbremse, der Mann blickte sich verwirrt um und verschwand im U-Bahn-Tunnel, und die Schwestern sprangen aus dem Zug und jagten ihm hinterher.
Es roch nach Berührungen von Regen mit Welt; im Tunnel fanden sich weder Gehwege noch der rasende Wilde, nur Feuchtigkeit und die Gewissheit, dass sich Moder in den Haaren und in der Kleidung niederlässt, um für immer eingenistet zu bleiben, und doch kehrten die Zwillinge nicht um, sondern versuchten, den Mann mit den langen Wangen zu erschnuppern; es schien ihnen, als müsste er duften.
Gilbert war in einem Aufsichtsraum angekommen, in einer kleinen Kammer in einem Seitentunnel. Ein Fernseher stand auf einem Plastiktisch, die Zeitung war zusammengefaltet und hing (gerade noch) über der Lehne. Vorsichtig sah sich Gilbert um, seine Schnurrhaare auf dem Nasenrücken zuckten nicht, also schlüpfte er in den Raum, zog die Tür hinter sich zu, schlüpfte unter den Tisch und schlief ein. Vielleicht hatte es ihn danach gedrängt, aus der Wohnung zu laufen, weil er sich in den Höhlen unterhalb der Stadt sicherer fühlte. Die Dunkelheit machte ihm nicht zu schaffen, im Gegenteil, sie erleichterte das Erkennen: Die Finsternis schärfte seinen Sehsinn. Zudem konnte er endlich seinem Drang nachgehen, mit den Händen und Füßen zu graben, in der Erde zu wühlen, sich auf der Erde und in ihr zu wälzen und Dreck auf sich zu häufen, ohne gesellschaftliche Konsequenzen.
Nach dem Nickerchen begann er in den Nebenhöhlen des U-Bahnnetzes Gänge zu graben, vier Eingänge hatte er geplant, die Nestkammer sollte sich genau einen Meter unter der Erdoberfläche befinden und mit Gras ausgelegt sein, seine Fingernägel, seine Schaufeln, hatten schon begonnen, sich diesem Wunsch anzupassen, sie wuchsen sich aus zu Krallen, und die Hände zu Pfoten, etwas stärker behaart und um einiges kräftiger als zuvor. Zunehmend entfiel ihm die helle Welt, und seine Erinnerungen wurden vom Dunkel verschluckt.
Die Zwillinge hatten sich verlaufen. Seit einigen Tagen irrten sie durch das unterirdische Labyrinth und hatten es schon fast aufgegeben, an die Erdoberfläche zu gelangen, als sie an einer Abzweigung eine Abstellkammer entdeckten. Die hölzerne Tür war hinter einem Vorsprung verborgen; sie war ihnen nur aufgefallen, weil ein eigenartiger Geruch durch einen Spalt in den Tunnel strömte.
Vorsichtig spähten sie in den Raum, konnten aber im Schein des Streichholzes nicht viel erkennen. Um sicher zu gehen, dass im Inneren der Höhle niemand auf sie lauerte, blieben sie eine Weile vor der verschlossenen Tür sitzen und horchten auf verdächtige Geräusche. Erst als sie sich vergewissert hatten, dass ihr Leben nicht in Gefahr war, schlüpften sie in die Futterkammer. Eine große Auswahl an Lebensmitteln gab es nicht, sie ertasteten hauptsächlich Erdnüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Sonnenblumenkerne und etwas weiches, fauliges Obst, außerdem tote Fliegen, Würmer und Käfer.
Die Mädchen stürzten sich auf das Essen. Im Schein des vorletzten Streichholzes beschlossen sie, an diesem Ort zu bleiben und auf den Besitzer der Fressalien zu warten; auch wenn er böse auf sie wäre, weil sie seinen Vorrat dezimiert hatten, wollten sie ihn um Hilfe bitten, er musste den Weg ins Freie kennen, vielleicht würde er sie sogar bis zur Erdoberfläche begleiten. Doch bereits nach wenigen Stunden bereuten sie ihre Entscheidung: Nichts deutete darauf hin, dass der Sammler zurückkehren würde, wahrscheinlicher war, dass er diesen Ort aufgegeben hatte, daher das verfaulte Obst und die vielen toten Insekten. Diese Kammer war nicht für die Lebenden gedacht, schoss es ihnen durch den Kopf.
Gerade, als sie sich wieder in die Finsternis wagen wollten, kam ein Schatten durch die Tür gehumpelt, stieß bei ihrem Anblick ein aufgeregtes Pfeifen aus und begann bedrohlich zu knurren.
Sein rechter Unterschenkel stand waagrecht in die Luft, Gilbert war auf seinen Beutezügen von einem Balkon gefallen. Er hatte zwar als Vierbeiner eine beachtliche Geschicklichkeit erworben, war aber gerade deswegen leichtsinnig geworden und hatte sich seine Ziele immer höher und höher gesteckt. Während er von Balkon zu Balkon gesprungen war, mehr ein Affe als ein Nager, war er abgerutscht und dabei mit einem Fuß im Geländer hängen geblieben. Also hatte er die Futtersuche abgebrochen und war in seinen Bau zurückgehinkt. Auf dem Weg in den U-Bahn-Schacht hatte er sich ständig umgesehen, er war das beklemmende Gefühl nicht losgeworden, dass sich ihm ein Raubtier näherte. Nun hatte er zwei Mädchen vor sich, denen die Finsternis sämtliche Farben von Gesicht und Kleidung gestohlen hatte: zwei Geister.
Gilbert machte es sich (so gut es ging) in seinem Nest bequem, krempelte das rechte Hosenbein hoch und untersuchte die Verletzung, die sich, von Schwärze angesteckt, ebenfalls schwarz verfärbt hatte. Das Geisterduo fragte, ob es in der Nähe ein Krankenhaus gebe, aber Gilbert hörte nicht zu, er hatte sich schon über das Bein gebeugt und begonnen, es abzubeißen.
Als er die Operation beendet hatte, reinigte er seine Zähne mit der Zunge und den Fingern. Die Schwestern, die ihm noch immer stumm gegenübersaßen, ignorierte er, akzeptierte aber die Haselnuss, die ihm Nummer Eins anbot. Nummer Zwei trug den abgetrennten Unterschenkel in den Nachbargang und stopfte ihn in einen Spalt, dann säuberte sie Gilberts Nest und streute trockenes Stroh auf die blutdurchtränkte Stelle.
Wie zahm er ist, dachten die Zwillinge, als sie ihm, wie jeden Tag, den Bauch kraulten und ihm Sonnenblumenkerne und Erdnüsse zusteckten. Ließen sie die Nuss auf der Hand, setzte er sich sogar auf ihre Hände, wobei diese vollkommen unter seinem Gesäß verschwanden. Da er sich weigerte mit ihnen zu sprechen – außer einem lauten Pfeifen kam nichts aus seinem Mund –, nannten sie ihn Hallo. Dies war das einzige Wort, auf das er reagierte. Auf die Idee, sich selbst mit Namen vorzustellen, kamen sie nicht. Es reichte ihnen, dass er wusste, wann er angesprochen war.
Sie begleiteten ihn überall hin, auch bei der Futtersuche, da er ständig das Gleichgewicht verlor und sich wunderte, wenn er umfiel. Manchmal versuchte er gar, sich mit dem Phantomfuß am Oberschenkel zu kratzen. Sein wohliger Gesichtsausdruck stand dabei ganz im Gegensatz zum Gelenk, das orientierungslos durch die Luft ruderte. Gilbert schien die Amputation vergessen zu haben, ebenso seinen Unfall; das Einzige, an das er sich erinnerte, waren gute Futterplätze und -verstecke sowie die Mädchen, die ihn mit Nüssen und Streicheleinheiten gezähmt hatten.
Aber auch die Zwillinge vergaßen; sie vergaßen, dass sie vor wenigen Tagen noch verzweifelt versucht hatten, einen Ausgang aus dem Labyrinth zu finden. Nun, da sie ihre genaue Position kannten, genossen sie Gilberts Gesellschaft und dachten gar nicht mehr daran, in ihr Zuhause zurückzukehren. An manchen Abenden wagten sie sich ohne seine Hilfe in die Oberwelt und brachten ihm einen Eimer voll Sand mit, den sie in seine Sandkiste schütteten, damit er ein Sandbad nehmen konnte. Ihr altes Leben vermissten sie nicht; an seinem Haar lasen sie den Wechsel der Jahreszeiten ab, im Oktober verlor es seine Farbe und wurde winterweiß, im Februar dunkelte es nach und wurde wieder hellbraun.
Gilbert wurde ihr Haustier und Anführer, was immer er befahl, sie folgten ihm. Er lehrte sie das Leben im Untergrund, und die Zwillinge revanchierten sich, indem sie ihm seine dreibeinige Existenz so angenehm wie möglich machten – zu angenehm, wie sich herausstellte: Er vergaß vollkommen, seine Zähne zu wetzen. So wuchsen seine unteren Nagezähne aus der Mundhöhle heraus und spiralförmig in seinen Oberkiefer, die oberen Zähne aber krümmten sich um sich selbst und durchstießen sein Kinn.
Kurz bevor Gilbert erstickte, streichelten ihn die ergrauten Zwillinge und stellten sich endlich vor. Du sollst unsere Namen erfahren, sagten sie, wir heißen Ida und Martha.
(Eine längere Fassung erschien 2017 im Erzählband „Fingerpflanzen“, Topalian & Milani)

Anna Kim wurde 1977 in Südkorea geboren, zog 1979 mit ihrer Familie nach Deutschland und schliesslich weiter nach Wien, wo die Autorin heute lebt. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt die Romane «Anatomie einer Nacht» (2012) und «Die grosse Heimkehr» (2017). Für ihr erzählerisches und essayistisches Werk erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, darunter den Literaturpreis der Europäischen Union.
Illustration © leafrei.com






 «Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.
«Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.




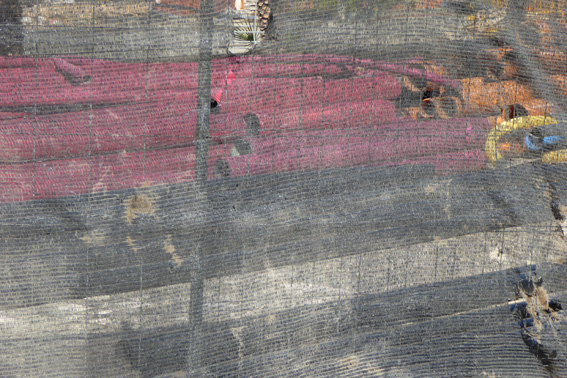




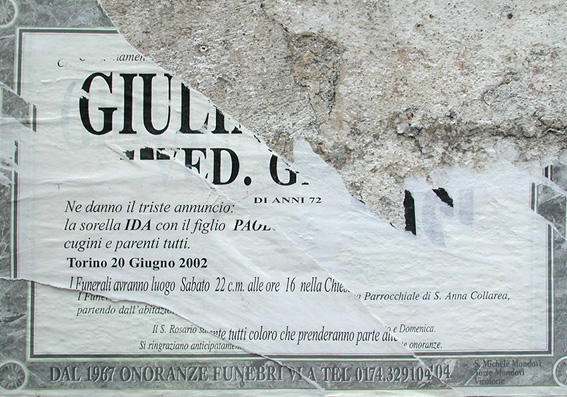














 „
„

 Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «
Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «