Ich begann so, wie ich es bei meinen Prosaübersetzungen zu tun pflege, und hackte meine ersten Versuche in den Computer, löschte und überschrieb alles, wieder und wieder, verlor mich in meinen unzähligen Varianten. Und wurde stutzig. Etwas stimmte nicht. Terres déclives ist keine Prosa! Und es war meine erste Lyrikübersetzung.
«und alles finge von vorne an»
Ich musste anders arbeiten und griff zum Kugelschreiber, kritzelte wild drauflos, füllte dutzende Heftseiten – ein bisschen so, als wäre ich selbst der Poet. Das fühlte sich zwar im ersten Moment besser an, doch das Ergebnis blieb meist Makulatur. Nachsichtig entzifferte ich meine Hieroglyphen, schaute grosszügig über gedankliche Schludrigkeiten hinweg, begnügte mich mit ein paar wenigen Zufallstreffern und kam wieder nicht weiter. Ich wurde erneut zum digitalen Worthandwerker, setzte mich vor den Bildschirm und arbeitete mich Silbe um Silbe, Wort um Wort, Zeile um Zeile vor. Doch wenn ich nach einer Pause wieder auf den Bildschirm starrte, erschrak ich: Wie schwerfällig und verschwurbelt meine deutsche Übersetzung doch war, kein Vergleich mit dem elegant dahinfliessenden, dabei komplexen Original. Ich musste genauer arbeiten! Noch besser erfassen, noch präziser begreifen, was das Gedicht wirklich erzählt. Ich fuhr zu Thierry Raboud, und wir arbeiteten das Original von Anfang bis Ende durch. Oft blieben wir an einer Stelle hängen, kamen nicht weiter, verloren uns im Dschungel der Assoziationen.
parmi les collections
estampes pressées par le temps
lavis pâles sous la paume
de notre oubli
bei den sammlungen
vom lauf der zeit
plattgewalzter drucke
unter der hand des vergessens
vergilbter tusche
Meinte Raboud mit «par le temps» entweder im Lauf der Zeit oder eher vom Lauf der Zeit, oder vielleicht beides oder noch etwas anderes? Wie konnte ich ihm auf Französisch den Unterschied zwischen den deutschen Präpositionen im und vom oder der in diesem Kontext schwerfälligen Variante durch erklären? Raboud hatte auf die meisten Fragen eine Antwort, und selbstverständlich wusste er, warum er ein Bild, eine Metapher, eine Assoziation, eine Assonanz, einen Zeilensprung, einen Reim gewählt oder was ihn dazu inspiriert hatte. Aber nicht immer. Manchmal war etwas einfach «entstanden». Bei den Dichtern ist das so. Wieder an meinem Schreibtisch stellte ich fest, dass seine Erläuterungen mir die Arbeit nicht nur erleichterten, sondern stellenweise auch erschwerten. Ich verstand zwar genauer, was in der einen oder anderen Zeile mitschwang, war aber noch immer von einem befriedigenden Resultat meilenweit entfernt. Verklumpt, verschwurbelt, verkopft erschien mir meine Übersetzung, die Lektüre würde abschrecken.
Also fing ich wieder von vorn an, und ich fand immer besser in die Spur. Mit Geduld – und, wie könnte es anders sein, ein bisschen Demut.
je contourne les statues penchées
dont les visages s’effarent
et dévisagent sans plus de fierté
le vide des sentiers
qui derrière les portes du musée
s’ouvre
ich meide die unsteten statuen
ihren kleinmütigen blick
aus blutleeren augen
auf die weglose ödnis
hinter dem klaffenden
museumstor.

Aber nicht immer nahm das Gedicht meine Übersetzungsvorschläge widerstandslos an. Es entwickelte ein eigenes Selbstbewusstsein und verbat sich, wenn es ihm gegen den Strich ging, etwas in sich aufzunehmen, was ich mir ausgedacht und doch so gut «gepasst» hätte. Ich musste, stellte ich fest, nicht nur in Rabouds Originaltext hineinhorchen, sondern auch auf die Übersetzung hören, mit ihr in Dialog treten und, wenn es hart auf hart käme, ihr ein Zugeständnis abringen. Gebundene Sprache lässt sich nicht auf jede Bindung ein.
Immer klarer wurde mir auch, dass die «Beziehung», die ich mit Terres déclives einging, anders geartet war, als ich es von einer Prosaübersetzung her kenne: Lasse ich mich bei der Arbeit an einem Roman gerne von der Handlung, der Thematik, von einem Schicksal oder der Stimmung eines Texts berühren, so war es hier das Wort, das mich leitete, mir Räume öffnete oder verschloss, die Wucht der Wörter, die in mir Frohlocken oder Verzweiflung auslösten.
Nicht immer konnte ich die Komplexität eines Sprachbilds übertragen:
les tableaux seuls
ont gardé leur aplomb
leur horizon en droit-fil
cisaille le ciel et la terre
de rectitude insolente
alors que
tout penche
nur die bilder
bleiben im lot
dreister schnitt
zwischen himmel und erde
ein rechthaberischer horizont
wo doch
alles wankt.
«en droit-fil» ist ein Begriff aus dem Textilwesen und bezeichnet den Schnitt quer durch den vertikalen Fadenlauf eines Stoffs. «cisailler» heisst zerschneiden, durchtrennen. Raboud beschreibt damit den Schnitt oder Riss zwischen Himmel und Erde. Im Deutschen ist das in knappen Silben nicht zu übersetzen. Ich entschied mich deshalb für «dreister schnitt/zwischen himmel und erde», was sich zwar vom Original entfernt, aber dafür den aggressiven Charakter der französischen Zeile wiedergibt. Im Netz fand ich dazu ein Zitat aus einem diplomatischen Gespräch, in dem der Ausdruck im Sinne von «korrekt, aber rücksichtslos» verwendet wurde, was zu meiner Entscheidung beitrug.
Manchmal erschwerte ich mir die Arbeit auch unnötigerweise. Für «éclairs pâteux» hatte ich lange pastose Erleuchtung stehen, ein schwerfälliger, sich aus der Polysemie des Originals erklärender Neologismus: Bei Raboud stehen die «éclairs» sowohl für Blitze auf einem Ölgemälde wie auch, leicht ironisch, für geistige Erleuchtung. Das Adjektiv «pâteux» bedeutet teigig, dickflüssig, träge; «avoir la langue pâteuse» bezeichnet eine nach übermässigem Alkoholkonsum schwere Zunge. Irgendwann war ich bei gelallten Züngeleien, und damit völlig im Abseits. Als ich mich kurz vor der Textabgabe für das Einfachste und Naheliegendste, für die wörtliche Übersetzung pastose Blitze zurückentschied, atmete auch der Verleger auf.
Ein Jahr später erschien das Buch, und ich erinnerte mich an die Titelsuche. Schieflage war mir früh eingefallen, doch ich fand es zu journalistisch, eine Überschrift allenfalls für eine Zeitungskolumne. Ich versuchte es mit Erde, mit Plan, Terrain oder Ebene. Auch Hanglage kam nicht infrage, falsches Bild und anderweitig besetzt. Abschüssiges war mundartlich konnotiert, und als auch der Verleger nicht weiterkam, holte ich die Schieflage wieder aus der Versenkung und wusste gleich: Der Titel passt. Er leistet genau das, was ich brauche, er löst das Gedicht aus der «hohen leiste der letzten zuflucht» und verlagert es in eine schnörkellose Sachlichkeit.
«et tout recommencerait»
Thierry Raboud, 1987 in Martigny geboren, gehört zur Nachwuchsgeneration der Lyriker in der Westschweiz. Seine erste Gedichtsammlung, «Crever l’écran» (Ed. Empreintes), wurde mit dem Prix Pierrette Micheloud gewürdigt. Als Literaturkritiker und Musiker ist er auch im Bereich Performance und Installation tätig. Im Jahr 2023 war er Preisträger eines Kulturstipendiums der Fondation Leenaards. Seine Gedichte wurden auch ins Italienische übersetzt (Ed. Valigie Rosse).
Yves Raeber ist Schauspieler, Regisseur und literarischer Übersetzer von Theaterstücken und Prosa. Für die Übersetzung von «Die Panzerung» («Béton Armé») von Philippe Rahmy wurde ihm 2019 von der Stadt Zürich eine literarische Auszeichnung verliehen.



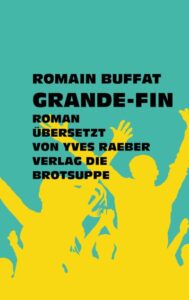




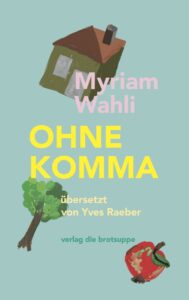

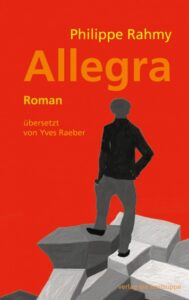

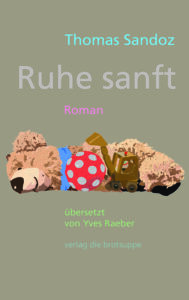 Weil ihn die Bilder aus jener Zeit auch im Alter nicht loslassen. Weil er nie aus seinem Schweigen herausfand. So wie ihn die Schicksale der verstorbenen Kinder nicht loslassen, die Geschichten, die er sich zusammenreimt, die den Kindern eine Vergangenheit schenken, die erklärbar machen, warum man sie auf dem Friedhof vergessen hat. Er macht seinen Kindern Geschenke, bemüht sich viel mehr als nur um die Bepflanzung, das Kreuz, den Grabstein und den Weg dorthin. Er gibt den Kindern Namen; Primel, Forsythie, Hyazinthe, Pfingstrose oder Anemone. Er redet zu ihnen, leistet ihnen Gesellschaft, ist ihnen Behüter und Vater.
Weil ihn die Bilder aus jener Zeit auch im Alter nicht loslassen. Weil er nie aus seinem Schweigen herausfand. So wie ihn die Schicksale der verstorbenen Kinder nicht loslassen, die Geschichten, die er sich zusammenreimt, die den Kindern eine Vergangenheit schenken, die erklärbar machen, warum man sie auf dem Friedhof vergessen hat. Er macht seinen Kindern Geschenke, bemüht sich viel mehr als nur um die Bepflanzung, das Kreuz, den Grabstein und den Weg dorthin. Er gibt den Kindern Namen; Primel, Forsythie, Hyazinthe, Pfingstrose oder Anemone. Er redet zu ihnen, leistet ihnen Gesellschaft, ist ihnen Behüter und Vater.