Vor allem Im Sommer stank es im Werkraum des Schulhauses Kirchstrasse. Man dachte, es liege an der Belüftung, am Untergrund oder sonst irgend welchen Leichen im Keller. Aber ganz im Gegenteil: Was stank, diente einst der vorbildhaften Hygiene. 1909 richtete man in den Mauern des heutigen Werkraums 20 Schulbrausen ein. In einer Zeit, als Wohnungen im Normalfall kein Bad anzubieten hatten und man seine Waschungen am „Schüttstein“ in der Küche vollzog, als es auch in wachsenden, prosperierenden Dörfern wie Amriswil öffentliche Bäder gab und Körperhygiene weit weg von dem war, was man heute darunter versteht.
In Zeiten, in denen viele täglich duschen, Turnhallenduchen süsslich in Deowolken dampfen, in denen sich Lehrkräfte in gewissen Zeiten die Hände nach der Begrüssung mit Alkohol desinfizieren und man mit aller Selbstverständlichkeit in den Klassenzimmern kollektiv die Zähne putzt, spürt man mit einem Mal, wie weit weg die Zeiten der Grossmütter und Grossväter sind.
Grund für den Gestank war eine Ablaufleitung und ein Schacht, den man nicht versiegelte, unmittelbar unter dem Boden. Also vielleicht noch immer ein bisschen von dem Dreck, den die Kinder vor 100 Jahren mit Kernseife und Schweiss hinunterspülten.
Schlagwort: Randnotiz
Alte Schule
Ich war in Eile und ziemlich durch den Wind. Und zuhause würde ich an der Reihe sein, für das Nachtessen zu sorgen. «Und bitte nicht einfach den Inhalt des Kühlschranks auf den Esszimmertisch stellen.» Das kam auf dem Nachhauseweg zu Fuss der Fischstand auf dem amriswiler Marktplatz gerade recht. Frischen Fisch und noch ein geräuchertes Stück Lachs. Zwanzig Franken. Ich kramte in den Jackentaschen, in den Hosentaschen, mit wachsender Beunruhigung auch noch in meiner Mappe, zwischen Mäppchen, Heften und Griffelschachtel. Aber da war nichts, nur die Blicke des Mannes hinter der Ladentheke und der Frau mit Kinderwagen hinter mir.
«Ich muss passen. Meine Brieftasche ist nicht dort, wo sie sein sollte.» «Macht nichts. Nehmen sie den Fisch mit und zahlen sie nächste Woche.» «Müssen sie nichts notieren? Meinen Namen und den Betrag?» «Brauche ich nicht. Ich bin ein Mann alter Schule. Ich schau den Leuten in die Augen und weiss, ob ich mein Geld später bekomme. Bei ihnen passt’s.»
veröffentlicht in der Thurgauer Zeitung, am 5. April, 2018
Randnotiz: Vibrations
An der Fassade am Eck über der Bahnhofstrasse prangt ein Plakat; «wellness vibrations». Unter Wellness lässt es sich einiges vorstellen. Bei Vibration gebe ich zu, dass meine männlich geprägte Vorstellungskraft schon ziemlich eingeschränkt ist. Zumal in dieser Kombination. Wäre damals die Initiative «Freie Schulwahl» angenommen worden, würde man Schulhäuser mit Werbesprüchen behängen. «wellness school» oder «school vibrations», will man doch die Kinder mit Bildung «elektrisieren». Jetzt erst recht, wo uns der deutsche Philosoph und Buchautor David Precht glauben macht, dass es die Schule so nicht braucht, dass unsere Schulen noch immer wie Kasernen funktionieren, in denen gehorsame Staatsbürger gedrillt werden. Da braucht es vielleicht doch wellness vibrations, um all den Bildungsschrott, den man unsern Kindern mit Müh und Not eintrichtert, zu neutralisieren. Bildungsschrott? Lesen, Schreiben, Kombinieren, Diskutieren, Probleme lösen, Stärken fördern, Gestalten, kreativ sein, das interkulturelle Leben üben – eben Schrott. Vielleicht lasse ich mir ein T-Shirt machen mit der Aufschrift «man of natural vibration».
Titelfoto: Sandra Kottonau
7. Randnotiz: Schreie in der Nacht
Schreie in der Nacht
Auch wenn im kleinen Ort schon tödliche Schüsse fielen, ist es ein friedlicher Ort. Auch wenn am Bahnhof manchmal zur späten Stunde die Polizei aufkreuzt oder morgens Entwurzeltes auf den Strassen liegt, scheinen sich der Schrecken und die Angst in Stuben und Zimmern zu konzentrieren, auf Bildschirmen und Schlagzeilen, auf Zeitungen mit grossen Lettern, wenig Text und vielen Bildern. Aber der Schein trügt. Meine Frau und ich sassen abends beide im Wohnzimmer und lasen, als wir durch die geschlossenen Fenster Schreie und wilde Flüche hörten. Eine Männer- und eine Frauenstimme überschlugen sich in Heftigkeit und intimen Grobheiten. Es blitze und krachte verbal, was das Zeug hielt. Selbst der Verkehr auf der Strasse pausierte für die Dauer dieser Schlacht. Die verunsicherten Blicke meiner Frau und mir kreuzten sich. Ich stand auf, öffnete die Tür zum Sitzplatz und lauschte dem Donnerwetter. Für einmal kein Drama am Bildschirm, kein Zerfleischen auf Papier. Die beiden hassten und beschimpften sich in Grund und Boden. Dann knallte eine Autotür, Reifen drehten durch und jemand raste hinter der Hecke vorbei. Mit einem Mal war es ruhiger als sonst. Bis die Vögel wieder zu singen begannen. Es kocht immer irgendwo. Nur meistens fest verschlossen. Es wird verletzt, geweint, geschrien und zerstört, im Stillen, hinter Türen, in Echtzeit, ganz real. Auf dem Deckel meines Buches im Wohnzimmer stand der Titel «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (Ein wirklich guter Roman!).
Gallus Frei-Tomic
Titelfoto: «Zeit» von Philipp Frei
6. Randnotiz: Motorengeflüster
Motorengeflüster
Einmal, nur ein einziges Mal. Aber ich bin ein «Schisshase». Unfähig, aus meiner perfekt antrainieren Rolle auszusteigen. Ich bin selbst bei Krankenkassenvergleichen am Telefon freundlich, auch wenn mein Gegenüber der deutschen Sprache gerade so sehr mächtig ist, dass ich nach den ersten Floskeln verstehe, worum es gehen soll. Ich bleibe anständig, wenn sich Leute vor dem Zug vordrängeln, versuche mich nicht zu entrüsten. Traue mich nicht einmal, wenn im Zugabteil gegenüber eine junge Frau ihre Boots auf die Sitzkante stellt und ihre Fingernägel zu lackieren beginnt. Einmal, nur ein einziges Mal. Am vergangenen Sonntag geschah es wieder. Ich fuhr mit dem Rad zur Bäckerei im Städtchen, meine Frau lag noch im Bett. Ich überquerte die Strasse, hebelte den Ständer runter und hängte den Helm an die Lenkstange. Gleich beim Eingang stand ein dunkelblauer BMW mit laufendem Motor. Aber im Auto drin sass niemand. Der Motor tuckerte vor sich hin, während der Fahrer oder die Fahrerin im Laden Brötchen kaufte. Irgendwie italienische Verhältnisse. Als ich vor Jahrzehnten für ein paar Tage in San Gimignano war, sah ich das auch. Tiffosi, die in der Bar ihren Esspresso tranken, während draussen vor der Tür der beste Freund warm blieb. Wie gerne wäre ich ins Auto gestiegen, hätte den Gang eingelegt, den BMW ganz behutsam aus der Parklücke gefahren, um ihn fünfzig oder hundert Meter weiter weg wieder an den Strassenrand zu parken. Ich wäre zurückgelaufen, in den Laden und hätte durch die Scheibe zugeschaut, wie sie oder er verzweifelt ein Auto sucht. Hätte, wäre. Ich bin ein anständiger Schisser.
Gallus Frei-Tomic
5. Randnotiz: Vogel im Spiegel
Vogel im Spiegel
Morgens und abends fliegt eine Elster aufs Nachbargrundstück und setzt sich auf den Aussenspiegel des schwarz glänzenden BMWs. Dort sitzt sie und flirtet mit ihrem Spiegelbild, flattert wild mit ihren Flügeln, vielleicht sogar ein unbeholfener Paarungsversuch mit ihrem Spiegelbild. Jeden Morgen und jeden Abend. Aber eine ähnliche Beobachtung mache ich auch mit den menschlichen Eitelkeiten. Keine Ahnung, wann ich das innige Interesse an meinem Spiegelbild verloren habe. Allenfalls am Morgen noch einen Kontrollblick. Am Abend laufe ich zum Zähneputzen lieber im Obergeschoss herum. Hernach ein Kontrollblick, ob aller Zahnpastaschaum weg ist. Aber wenn ich durch die Strassen der Stadt gehe, dann ist es bei weitem nicht die Elster allein, die sich am liebsten mit dem Spiegelbild paaren möchte, die sich übermässig für ihr Spiegelbild interessieren. Und es sind nicht nur die Jungen, die sich in allen verfügbaren Scheiben, Spiegeln, Schaufenstern und Gläsern betrachten, posieren, im Vorübergehn die Frisur korrigieren, mit den Fingerspitzen die Strähne hinters Ohr schieben, den Kopf um Zentimeter höher tragen, die Brust um Nuancen vorgestreckt. Im Zug nachts der Geck, der sich an der Eingangstür in den schwarzen Fenstern die gelverstärkten Strähnen zurechtzupft, die Kapuze im Nacken richtet. Der Vogel ist nicht allein, der Vogel am Spiegel meines Nachbarn.
Gallus Frei-Tomic
4. Randnotiz: Das Loch
Das Loch
Im Zentrum klafft ein weites Loch. Trockener Staub brennt in meinen Augen, wenn ich an der riesigen Baustelle vorbeiradle. Männer, vorwiegend älteren Semesters, stehen am Absperrgitter und schauen ins Treiben auf dem Grund dessen, was einmal ein neues Einkaufszentrum werden soll. Die Männer am Absperrgitter erinnern mich an Ausgesperrte, von der Arbeit Verbannte. Da drinnen, in diesem Geviert aus Maschinen, Helmen, Staub und Erde findet das echte Leben statt, von dem man sie mit der Pensionierung abgeschnitten hatte. An der Grenze zur Strasse ist die Baustelle durch einen Kunststoffsichtschutz abgedeckt. Ein langes, weisses Band, noch fast jungfräulich und unbefleckt, das ergeben auf seine Bekritzelung und Besprayung wartet. Und manchmal sehe ich einzelne Fussgänger, letzthin einen alten Mann, nicht mehr gut zu Fuss, der sich tapfer und unbeirrt dem weissen Band entlang fast mitten auf der Strasse Richtung Kirche bewegte. Auf der anderen Seite wäre das Trottoir mehr als breit genug gewesen, auf seiner Seite aufgehoben, weil die Baustelle Platz braucht. Da schlurfte er, langsam und beharrlich. Bis zur Kreuzung waren es schon ein paar Autos, die im Schritttempo hinter ihm herrollten. Keiner hupte. Vielleicht aus Angst, den alten Mann zu Tode zu erschrecken. Wahrscheinlich war der alte Mann schon immer auf der rechten Seite Richtung Kirche gegangen. Das war seine Seite. Von einem Loch, auch von einem riesigen, klaffenden Loch liess er sich nicht vertreiben. Ein schönes Bild für manch eine politische und gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden.
Gallus Frei-Tomic
3. Randnotiz: Jeder in seiner Welt
Jeder in seiner Welt
Manchmal setze ich mich ins Café, um in Ruhe schreiben zu können, bestelle mir einen Kaffee, eine Praline dazu, lasse den Blick kurz schweifen, um zu beginnen. Mir gefällt das Gemurmel, das mich nichts angeht. Es scheint meine Konzentration anzustacheln. Aber manchmal klappt das nicht. Sie kennen das. Sie sitzen im Zug und müssen das Abteil verlassen, weil jemand kaum einen Meter Luftlinie entfernt mit Stöpseln in den Ohren so laut über die Untreue ihres Freundes schimpft, dass man sich zu schämen beginnt und zur Flucht genötigt wird. Im Café wars diesmal anders. Zwei ältere Männer hinter mir hielten mich vom Schreiben ab. Sie sprachen im Minutentakt über alle möglichen Themen; Motorräder, Frauenschuhe, Fussball, Energieineffizienz, Ferien in der Türkei, Trump, Rasentrimmer, Überstunden… Ich sass mit dem Rücken zu den beiden, sah sie nicht. Aber irgendwann legte ich den Stift weg. Ich war nicht überrascht über die Sprunghaftigkeit, auch nicht erschüttert über die deftige Wortwahl. Auch nicht über Meinungen, die ich nicht teilen konnte. Aber darüber, wie weit ich in meiner Welt von der ihren entfernt bin. Als ich dann doch genug hatte, ein erneuter Versuch zu schreiben gescheitert war, packte ich meine Sachen, legte die Münzen neben die Tasse und stand auf. Am Tisch hinter mir sassen zwei Männer so alt wie ich, die meine Brüder hätten sein können.
Gallus Frei-Tomic
Titelfoto «Sprengtafel» von Philipp Frei
2. Randnotiz in der Thurgauer Zeitung: Nachts am Bahnsteig
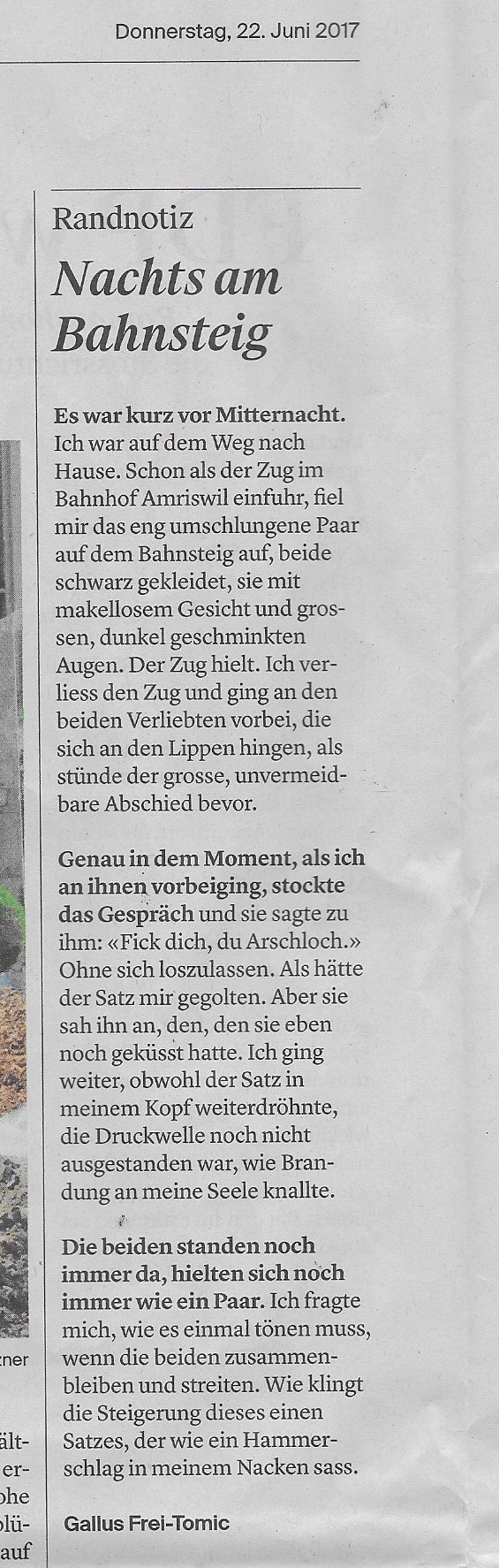
1. Randnotiz: Der Hund im Theater
Der Hund im Theater
Ich sass in der hintersten Reihe. Der dämmrige Saal füllte sich. Und dieses Auffüllen entpuppte sich als ganz besonderes Schauspiel. Vorne auf der Bühne würde in wenigen Minuten die Première eines Schülermusicals stattfinden. Mehr als 250 Kinder vom Kindergarten bis in die 6. Klasse! Folglich war der Saal voll mit Eltern, Grosseltern, Tanten und Göttis, mit Geschwistern in Windeln und der Behördenvertretung ganz vorne in der ersten Reihe. So gar nicht das übliche Theater- oder Musicalpublikum, das Unterhaltung oder Erbauung sucht, so gar nicht. Seitlich in meinem Rücken stand ein älterer Herr ganz in Schwarz, einer der Lehrer von Kindern, die bald als Giraffen, Zebras oder Erdmännchen ihr Bestes gaben. Neben ihm stand ein ebenfalls älterer Herr mit Lederweste, tätowierten Unterarmen und Charles-Bronson-Schnurrbart. Er fragte den Lehrer, ob es okay wäre, wenn er seinen Hund mit in den Zuschauerraum nehmen wird. Nicht wirklich eine Frage. Während der Angesprochene ganz offensichtlich um Fassung rang, konnte ich mit ein stilles Grinsen nicht verkneifen. Ob er seinen Hund auch ins Kino oder in der Kirche mitnehmen musste? Genügte es nicht, wenn sich in den Reihen vor mir Windelpakete tummelten, das Geschnatter fast ohrenbetäubend war und es in Kürze nicht einmal während der Vorstellung Ruhe oder ein Abklingen von permantem Raus und Rein geben würde? Ein Hund im Theater. Ich schüttelte im Halbdunkeln den Kopf und schmunzelte. Aber nur bis sich der Bronson-Verschnitt mit seinem Schosshündchen direkt neben mich setzte: «Er bleibt schon ruhig. Ist noch viel zu jung, um alleine zuhause zu bleiben.» Er lächelte, ich quälte mich damit. Ich mag keine Hunde. Vielleicht ein Überbleibsel einer kindlichen Angst. So ergab ich mich tapfer meinem Martyrium zwischen röchelndem Schosshündchen mit eingedrückter Schnauze, Zwischenrufen quengelnder Kleinkinder und dem verzückten Winken militanter Mütter.
Gallus Frei-Tomic






