Von Katzenhaltung zu sprechen, wird den meisten Beziehungen zwischen Katze und Mensch nicht gerecht. Wie kein anderes Tier schaffte es die Katze, trotz ihrer Eigenwilligkeit, Synonym für Wohlbefinden, Nähe und Zweisamkeit zu werden. Dass sich die Begegnung mit einer Katze aber auch zum Alptraum auswachsen kann, davon erzählt Monika Maron, eine der ganz Grossen der Deuschen Literatur.
Vielleicht ist es genau diese Eigenwilligkeit, die die Katze zu einem Kuscheltier macht. Man muss sich ihre Zuwendung verdienen. Katzen haben nichts von hündischer Ergebenheit. Und weil Katzen ihre Reinlichkeit ganz offen demonstrieren und damit ihren Jagdinstinkt zu kaschieren verstehen, wird die Katze, obwohl ursprünglich Raubtier, zum Kuschelprototypen. Dass Monika Maron keine Katzenhalterin ist, sondern seit Jahren begleitet von einem Hund, verwundert mich nicht. Zwei prägnante, eigenwillige Individuen unter gleichem Dach? Aber weil Monika Maron, oder zumindest die Erzählerin in diesem schmalen, schmucken Buch, ein Herz für Tiere hat, erweicht sie der Anblick einer räudigen Katze am Strassenrand, kurz vor einer Reise nach Budapest. Die nimmt sie mit nach Hause, tut alles, dass es der Katze wieder besser geht, unterschätzt aber die Eifersucht ihres Hundes. Und so kommt es, wie es kommen muss. Nur dass der Biss weder die Katze noch den Hund erwischt, sondern die Erzählerin.

Wird man so für seine Fürsorge, seine Hingabe, die Hilfe, die Liebe belohnt? Ob dieses Buch auch eine Zustandsbeschreibung für die Trennung des ehemaligen „Heimatverlags“ S. Fischer nach 40 Jahren Veröffentlichungen mit der Autorin ist, weil sie bei einem rechtsnahen Verlag ein Essay veröffentlichte, weiss ich nicht, lässt dies aber im Hintergrund vermuten. Monika Maron war und ist eine eigenwillige Schriftstellerin, eine die polarisiert und sich mit ihrer eigenen Meinung nicht zurückhält, einer Meinung, die durchaus kontrovers und sperrig ist. Aber man kann die Erzählung auch einfach als Parabel lesen, wie schnell sich eine gute Absicht gegen einem selbst wenden kann. Raubtier bleibt Raubtier.
Gebissen, verwundet, mit wenigen Handgriffen verarztet macht sich die Erzählerin auf den Weg nach Budapest, auch wenn sie schon auf dem Flughafen und noch mehr im Flugzeug spürt, dass sich die Entscheidung, den Biss auf die leichte Schulter zu nehmen, rächt. In Budapest angekommen, eingespannt in Termine, beginnt ein Amoklauf der Bakterien im Körper der Autorin. Ihr Zustand verschlechtert sich zusehends. Und obwohl ihr eine fürsogliche Begleitung zur Seite steht, wird aus dem Spiessrutenlauf zwischen Ärzten und Terminen ein Kampf bis ganz nahe an die Katastrophe.
Klar liest man jedes neue Bücher dieser Autorin nach Zeichen jener Trennung, nach Ursachen und Wirkungen. Monika Maron wollte vielleicht auch bloss eine gute Geschichte erzählen, was ihr unzweifelhaft gelungen ist, sowohl handwerklich wie sprachlich. Ob ich als Leser dieser Geschichte nun die eine oder andere Bedeutungsebene unterschiebe, bleibt Leserinnen und Lesern überlassen. Aber ich traue der Autorin viel mehr zu. Auf jeden Fall hat die Erzählung Biss!
Interview
Man kann ihre Erzählung einfach als gute Geschichte lesen, weil jeder weiss, wie schnell sich eine gute Absicht in eine verfahrene Geschichte auswachsen kann. Das sind Geschichten, die Resonanz, durch eigene Erfahrung genügend Bestätigung finden. Dass die eigenwillige Schriftstellerin beinahe durch eine eigenwillige Katze ausgebremst wird, ist Stoff genug. Was entscheidet, ob ein Text zu einem Buch wird?
Geschichten mit katastrophalem Potenzial, die aber gut ausgehen, offenbaren nachträglich ja auch ihre Komik. Man erzählt sie natürlich seinen Freunden, und mit dem wiederholten Erzählen verdichten sie sich und man selbst entdeckt dahinter Zusammenhänge und Zeichen, an die man, während man es erlebt hat, gar nicht gedacht hat. Und irgendwann sagt dann jemand: die Geschichte solltest du eigentlich schreiben. Und dann schreibe ich sie, so war das mit Bonnie Propeller und mit der Katze auch.
Gebissen, verwundet, mit wenigen Handgriffen verarztet macht sich die Erzählerin auf den Weg nach Budapest. Es beginnt ein Spiessrutenlauf zwischen Ärzten und Terminen bis zur drohenden Katastrophe. Bei uns in der Schweiz nennt man eine Katze „Büsi“, noch etwas niedlicher als in Deutschland „Schmusekatze“. Die Verkörperung der scheinbaren Harmlosigkeit beisst. Eine Metapher?
Nein, bestimmt nicht. Außerdem war diese Katze ja überhaupt nicht bösartig. Das war einfach ein Unfall. Die Katze wollte sich gegen den wütenden Hund verteidigen und traf versehentlich meine Hand.
Vor ein paar Jahren veröffentlichten Sie die Erzählung „Bonnie Propeller“, eine Liebeserklärung an den verstorbenen Hund und die Erklärung dafür, einen „Neuen“ anzuschaffen. So gross die Liebeserklärung an Bonnie Propeller, so gross die Ernüchterung darüber, was die Eifersucht seines Nachfolgers auslösen kann. Sie zählen zu den bedeutensten Schriftstellerinnen der Deutschen Gegenwartsliteratur, seit bald 45 Jahre, seit ihrem Debüt „Flugasche“. Die beiden Erzählungen sind aber nicht einfach die Hinwendung zum Kleinräumigen. Wir leben in einem Klima des überhöhten Harmoniebedarfs. Streiten ist keine Fähigkeit mehr. Die Katze beisst, das wars. Wie weit steckt Gesellschaftskritik in dieser Erzählung?
Das hieße, dieser Erzählung zu viel aufzuladen. Natürlich spielt sie nicht im luftleeren Raum, ich war nicht nur einfach in Budapest, sondern war eingeladen vom Matthias-Corvinus-Collegium, das oft als Orbans Kaderschmiede bezeichnet wird, das ich aber als eine großzügige Bildungsstätte mit offenem Meinungsstreit erlebt habe, was in der Geschichte auch vorkommt wie kleine Erinnerungen an Vergangenes oder Beobachtungen am Rande. Einen überhöhten Harmoniebedarf in der Gesellschaft erkenne ich eigentlich nicht, eher das Bedürfnis nach ergebnisoffenem Streit ohne Diffamierungen und Verdächtigungen. Die Katze hat damit nichts zu tun. Sie wollte sich verteidigen, das ist ihr Recht.
Nach 40 Jahren kündigte S. Fischer die Partnerschaft mit ihnen, weil sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Steckt in dieser Erzählung auch der Schmerz über jenen Biss?
Oh Gott, nein. Ich fühle mich bei Hoffmann und Campe gut aufgehoben.
Sie schreiben Den Katzenbiss interpretiere ich als eine Mahnung und eine Vorbereitung auf meine möglich Zukunft und nahm mir vor, mich in Sanftmut und Freundlichkeit zu üben. Beobachtet man die aktuellen Debatten auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, wären das doch durchaus allgemeingültige Tugenden, die man sich vornehmen müsste. Gelingt es ihnen?
Sanftmut und Freundlichkeit in politischen Debatten halte ich für unangemessen. Da geht es eher um die Bereitschaft, andere Meinungen ernst zu nehmen und zu ertragen, auch wenn sie scharf und provozierend geäußert werden und den eigenen Positionen extrem widersprechen. Mir ging es um die Demut gegenüber der eigenen Sterblichkeit und ihren kränkenden Vorboten, womit ich zum ersten Mal leibhaftig konfrontiert war.
Monika Maron, geboren 1941 in Berlin, ist eine der bedeutendsten
Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik nach Hamburg und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane und mehrere Essaybände. Ausgezeichnet wurde sie mit zahlreichen Preisen, darunter der Kleistpreis (1992) und der Deutsche Nationalpreis (2009).
weitere Besprechungen auf literaturblatt.ch zu Büchern von Monika Maron
Beitragsbild © Jonas Maron



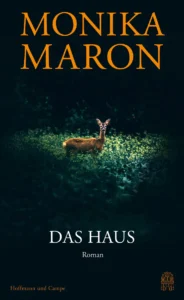

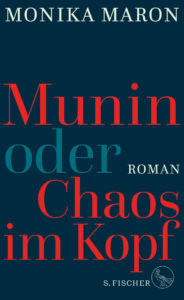 Monika Marons Roman mischte die ihr sonst so zugewandte Kritik mächtig auf, weil der Roman und seine Rezeption beweist, wie schwierig es ist, Inhalt und Autorin voneinander zu trennen. Wenn im Text Ängste mitschwingen, Ängste vor dem Islam zum Beispiel, ist das Geschrei unzimperlich und die Debatte darüber unverhältnismässig. Monika Maron schrieb ein Buch. Die Frau im Buch heisst Mina Wolf, eine einsame Wölfin in der Angst, die Welt immer mehr dem Chaos übergeben zu müssen. Und so spiegelt sich das Chaos in ihrem Kopf.
Monika Marons Roman mischte die ihr sonst so zugewandte Kritik mächtig auf, weil der Roman und seine Rezeption beweist, wie schwierig es ist, Inhalt und Autorin voneinander zu trennen. Wenn im Text Ängste mitschwingen, Ängste vor dem Islam zum Beispiel, ist das Geschrei unzimperlich und die Debatte darüber unverhältnismässig. Monika Maron schrieb ein Buch. Die Frau im Buch heisst Mina Wolf, eine einsame Wölfin in der Angst, die Welt immer mehr dem Chaos übergeben zu müssen. Und so spiegelt sich das Chaos in ihrem Kopf. Monika Maron ist 1941 in Berlin geboren, wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter «Flugasche», «Animal triste», «Endmoränen», «Ach Glück» und «Zwischenspiel», außerdem mehrere Essaybände, darunter «Krähengekrächz», und die Reportage «Bitterfelder Bogen». Zuletzt erschien der Roman «Munin oder Chaos im Kopf». Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis (1992), dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2003), dem Deutschen Nationalpreis (2009), dem Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und dem Ida-Dehmel-Preis (2017).
Monika Maron ist 1941 in Berlin geboren, wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter «Flugasche», «Animal triste», «Endmoränen», «Ach Glück» und «Zwischenspiel», außerdem mehrere Essaybände, darunter «Krähengekrächz», und die Reportage «Bitterfelder Bogen». Zuletzt erschien der Roman «Munin oder Chaos im Kopf». Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis (1992), dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2003), dem Deutschen Nationalpreis (2009), dem Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und dem Ida-Dehmel-Preis (2017).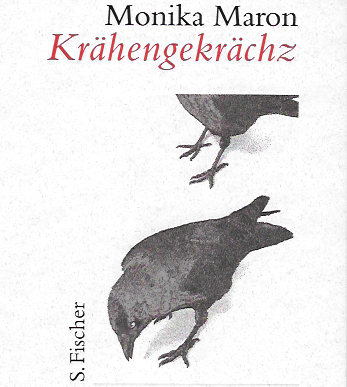
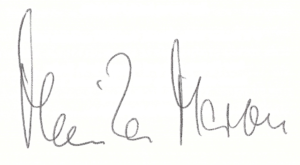 Und wer noch mehr über Krähen lesen will:
Und wer noch mehr über Krähen lesen will: