1
Man geht das Zimmer ab, man geht es mit
den Augen ab, im Bett liegend, und es ist
sehr früh am Morgen, und man sucht nach
ersten Schatten, nach ersten Umrissen,
nach ersten Farben. Man wartet auf
Geräusche, auf die Rufe der Kinder
vielleicht oder auf den Schlag der
Glocken. Man wartet auf Stimmen im
Treppenhaus, es ist noch früh, denkt man,
einer ist zu hören, der sich räuspert, um
die ersten Worte zu sprechen an diesem
Tag. Man verlässt das Bett und man kennt
die Ecken des Zimmers, die Kanten der
Möbel, man findet sich zurecht in dem
Halbdunkel, man findet in das Bad, man
findet sich zurecht, auch ohne Licht, auch
ohne Blick in den Spiegel.
2
Oft sind die Alten auf dem Platz. Sie
sitzen auf den Bänken und beobachten sich
gegenseitig. Manchmal flucht eine,
manchmal erzählt einer, manchmal lacht
eine, und obwohl dies miteinander
geschieht, gibt es keinen Zusammenhang
zwischen ihnen. Man kann sich nicht
vorstellen, dass sie es gut miteinander
meinen, man weiß nicht, weshalb man es
sich nicht vorstellen kann. Vielleicht, so
denkt man, weil sich die Menschen ähnlich
werden im Alter, weil sie sich gegenseitig
zu sehr an sich selbst erinnern, ist
Wohlwollen nicht möglich. Sie bewohnen
dasselbe Haus, sie gehen durch dieselben
Gänge, sie essen gleichzeitig, sie leben
in gleichen Zimmern, mit jeweils einem
Fenster. Manchmal sitzt ein alter Mann auf
der Bank und sieht zu, wie ein anderer
alter Mann über den Platz geht. Man kann
beobachten, wie sich der eine über den
anderen wundert, sich ärgert oder
ängstigt. Sie haben eine gemeinsame
Geschwindigkeit, in der sie gehen, in der
sie sprechen. Sie verstehen die Welt
außerhalb des Hauses auf eine gemeinsame
Weise. Man kann sich jedoch nicht
vorstellen, dass sie darüber sprechen, wie
sie nun und im Vergleich zu früher in
einer anderen Geschwindigkeit leben, die
sich nicht mehr an die Geschwindigkeit
außerhalb des Hauses anpassen lässt. Kaum
eine der alten Damen verlässt ohne
Handtasche das Haus. Die Handtaschen, so
denkt man es sich, sind fast leer. Ein
zusammengelegtes Stofftaschentuch, eine
Geldbörse, ein Kamm. Abends sehen die
alten Damen aus den Fenstern ihrer Zimmer.
Das tun sie nicht, um nach draußen zu
sehen, das tun sie, um sich zu
vergewissern, im Haus zu sein.
3
In einem Wagen sieht man ein Kind liegen.
Das Kind sieht seine Hand, es sieht seinen
Fuß, es sieht seine Mutter an. Es lacht,
sein Blick erstarrt, es sieht in die
Ferne. Man zählt einige der Dinge auf, die
das Kind lernen wird. Das gezielte
Einsetzen der Hände, das Sehen von Farben,
das Halten des Kopfes, das Erinnern.
4
In der Wohnung ist es still, nichts als
die Fliege ist zu hören. Es ist still,
weil sich niemand bewegt, weil niemand
sonst in den Räumen ist und etwas sagt.
Man kann sich nicht vorstellen, die Fliege
zu erschlagen, sie ist zu groß, als dass
man sie einfach erschlagen könnte. Man
lässt die Fliege also gegen die
Fensterscheibe fliegen. Immer wieder hört
man den Aufprall, man öffnet das Fenster
nicht. Diese Geräusche, der Flügelschlag,
der Aufprall, das Summen in der Ecke des
Fensters, all diese von der Fliege
ausgehenden Geräusche sind in dieser
Stille der einzige Beweis dafür, dass
wirklich Zeit vergeht.

5
Nachmittags spielen die Kinder im Hof. Sie
rufen sich Namen zu, sie jubeln und
kreischen, der Hof vervielfacht ihre Rufe,
ihren Streit, ihr Lachen. Auf dem Boden
des Hofes sind Kreidezeichnungen zu sehen.
Autos, Monster, Bäume oder aber Helden,
die man nicht kennt. Nachts ist der Hof
nichts weiter als der Abstand zwischen den
sich gegenüberstehenden Häusern.
6
Man geht das Zimmer ab, man geht es mit
den Augen ab, im Bett liegend und es ist
spät am Abend und man hört Schritte im
Treppenhaus, eine Begrüßung hört man, kurz
bevor die Tür zu einer anderen Wohnung ins
Schloss fällt. Man geht das Zimmer ab, man
geht es mit den Augen ab und man sucht
nach letzten Schatten, nach letzten
Umrissen, nach letzten Farben des Tages.
(Zeichnung Renata Jäckle)
Nina Jäckle 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann 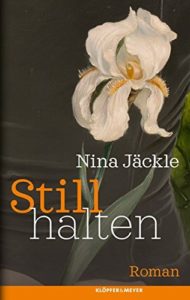 Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.
Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.
Rezension von «Stillhalten» auf literaturblatt.ch
Rezension von «Warten» auf literaturblatt.ch
Rezension von «Der lange Atem» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Michael Schroeder


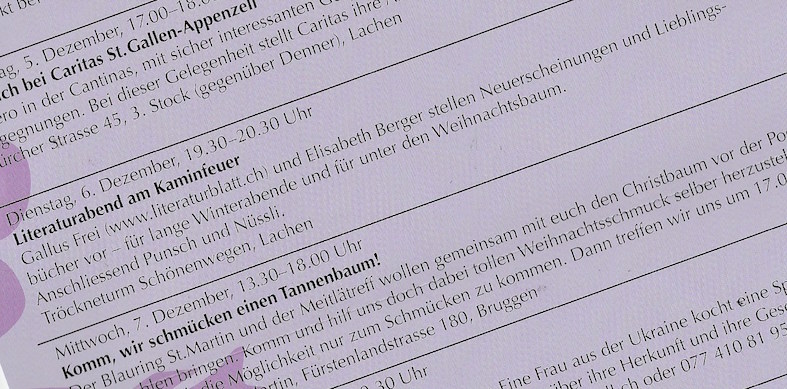
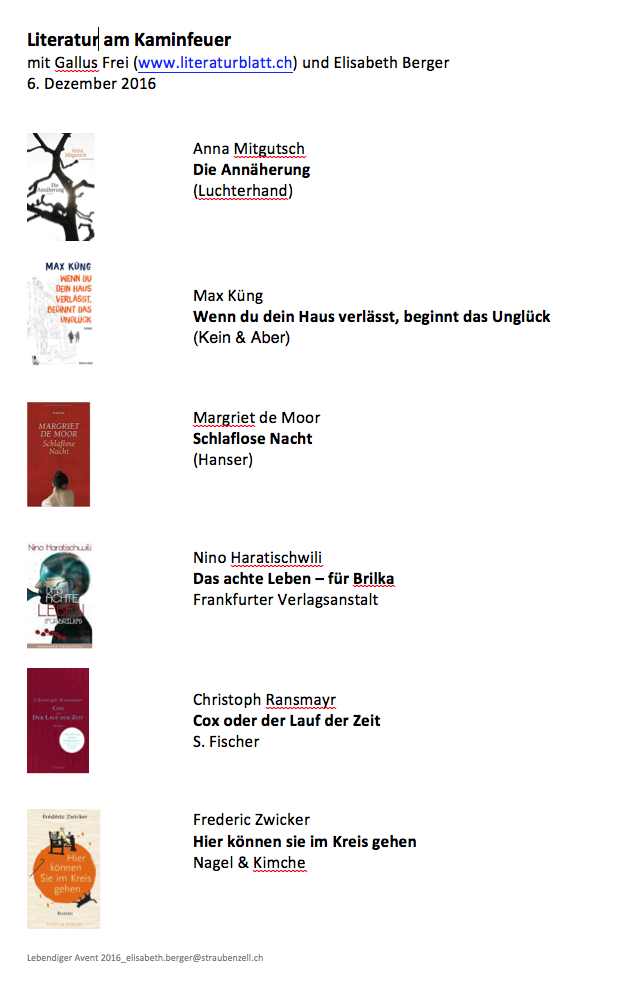
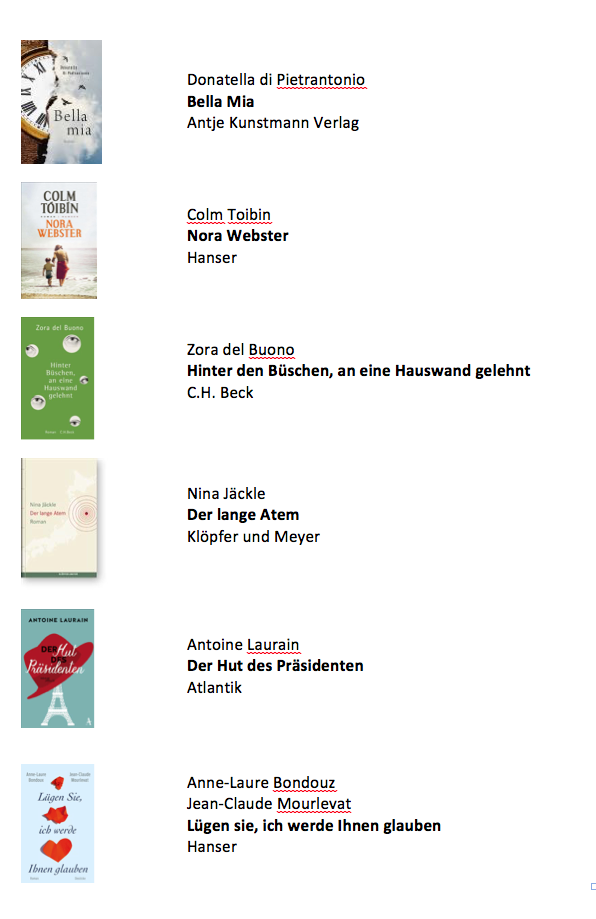


 Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»
Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»
 Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.
Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.