30 Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich erzählen von ihren Grosseltern, Geschichten bis nach Italien, Frankreich, Polen, Tschechien, Ungarn, der Ukraine, Israel, Pakistan und der DDR. Geschichten von Berührten, Geschichten, die berühren.
Auf einem meiner Regale steht ein eingerahmtes, sepiafarbenes Foto. Ein Mann in Anzug und Kravatte sitzt in einem Korbstuhl neben einem Tischchen mit Spitzendecke. Mein Grossvater. Er war Tischler, Schreiner. Auf dem Foto hatte er etwas zu repräsentieren. Dazu gehören wohl auch die Bücher auf der Ablage unter dem Tischchen und das offene Buch mit Stift auf dem weissen Tischtuch. Mein Grossvater starb, als ich ein Jahr alt war. Meine Mutter erzählt, er habe mich, schon gezeichnet von seiner Krankheit, noch in Händen gehalten. Er wurde nicht alt, aber von meinem Grossvater gibt er Zeugnisse, die noch immer an den Wänden im Haus meiner Mutter und meiner Tante hängen; Aquarelle und Ölbilder, von naturalistisch bis abstrakt. Mein Grossvater war begabt und hätte sich wohl viel lieber als Künstler gesehen, statt als Handwerker, der nur mit grösster Anstrengung dem nachgehen konnte, was seiner Leidenschaft entsprach. Aus Geldknappheit und weil meine Grossmutter wohl alles andere als glücklich darüber war, dass ihr Gemahl Geld für Ölfarben ausgab, bemalte er seine Leinwände gar beidseitig, sodass man sich später, als man dann doch das eine oder andere Bild einrahmte, stets für das eine oder andere entscheiden musste, im Wissen darum, dass das verborgene Bild Schaden nehmen würde. Die Begabung meines Grossvaters setzte sich in meiner Mutter, die auch heute noch mit über achtzig malt, meinem Bruder, der in Zürich seit Jahrzehnten ein Atelier führt und meinen Kindern fort. Eine Begabung, die mich stets in die Nähe der Kunst führte, gepaart mit dem ewigen Zweifel, der mit Sicherheit auch meinen Grossvater begleitete, denn nach seinem Tod sah man an den Wänden meiner zur Witwe gewordenen und wieder verheirateten Grossmutter nie ein gemaltes Bild meines Grossvaters.
«Schon lange wollte ich meine Beziehung zu meinem Grossvater in einer Erzählung festhalten. Mir war klar, dass mir das einiges abfordern würde. Vielleicht hatte ich sie deshalb noch nicht zu Papier gebracht, als die Einladung mit der Frage kam, ob ich einen Text beisteuern möchte für ein Grosseltern-Buch. Ja, natürlich, das war mein erster Gedanke. Und doch zögerte ich ein paar Wochen lang, bevor ich zusagen konnte, denn ich wusste: Über meinen Grossvater schreiben bedeutet über mich schreiben. Und das heisst: rausrücken mit dem, was ich für sehr privat halte. Das war und ist schwierig für mich, denn ich leide durchaus nicht unter Bekenntiszwängen. Nun bin ich aber überglücklich, es gewagt zu haben, über diese Geschichte entspannen sich neue Beziehungen, auch in der Familie, ich stehe neu mit zwei Cousins in intensivem Kontakt, ich erfuhr so viel mehr über meinen Grossvater und meine Herkunft. Die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Und nicht zuletzt: Die Geschichte meines Grossvaters verbindet sich mit allen Geschichten und mit allen Grosseltern im Buch. Und auch die Autorinnen und Autoren haben – so behaupte ich – einen neuen und vertieften Zugang zueinander. Das hat grosse poetische Kraft.» Romana Ganzoni

Vielleicht ist genau das die grosse Tür, die sich auftut, wenn man die Geschichtensammlung „Fragen hätte ich noch“ liest. Das Buch lädt ein, sich mit den eigenen Grosseltern zu befassen, sich zu fragen, was denn an Erinnerungen, an Wissen, an Persönlichem noch da ist. Wer sich nicht aktiv mit seinem Stammbaum, seiner Herkunft befasst, weiss vielleicht nur wenig, vor allem von dem, was Fotografien nicht erzählen. Urgrosselten und ihre Vorfahren verschwinden im Vergessen. So wie die meisten von uns in 100 Jahren vergessen sein werden. Meine Mutter ist weit über achzig. Wenn ich sie noch einmal fragen möchte, dann wäre es jetzt an der Zeit. Wer war meine Grossmutter? Warum habe ich von ihr ein derart nüchternes Bild? Warum empfinde ich meinem Grossvater gegenüber derart viel Wärme und Sympathie, obwohl ich ihn nie wirklich erleben konnte.
«Einige der Geschichten im Buch rufen in Erinnerung, dass Europa in der Weltgeschichte eine ebenso verdienstvolle wie zerstörerische Rolle spielt. Von hier gingen ja auch vielfältige Brutalitäten aus, die sich vor, während und nach den beiden Weltkriegen zugetragen haben, etwa die Gründung der Staaten Israel, Indien und Pakistan, oder die Zerstückelung ganzer Kontinente. Die meisten meiner Vorfahren – aber nicht alle von ihnen – entkamen der Vergewaltigung, Enteignung und Entwurzelung durch die europäischen Kolonialmächte. Durch eine postkoloniale Fügung des Schicksals bin ich in der Schweiz aufgewachsen: Mein Vater war Bankier.» Waseem Hussain
Wolfram Schneider-Lastin, der Herausgeber und Mitverfasser des Buches, schildert in seinem knappen Vorwort die Entstehungsgeschichte des Buches, wie er während der Pandemie begann, die Geschichte seiner Grossväter aufzuschreiben, sie an Freunde weitergab und Lektüre und Reaktionen eine wahre Welle auslösten. Entstanden ist eine erstaunliche Sammlung von Geschichten, von Frauen und Männern im 20. Jahrhundert, die sich ganz verschieden durch ein Jahrhundert der Kriege und Umwälzungen stemmten. Geschichten von Liebe und Hass, von Ernüchterung und Enttäuschungen, vom grossen Schweigen und dunklen Geheimnissen, von tiefer Verbundenheit und schmerzhaftem Ekel.
«Dass sich meine Grosseltern krumm und bucklig gearbeitet haben, dass vor lauter Arbeit kein Denken möglich war, das kam nochmals stärker durch. Und ist damit übertragbar auf Menschen, die eben am Rand und «unten» wie blöd und hart arbeiten, dass nichts anderes mehr möglich ist. (s.a. «Jahrhundertsommer»). Und – das ist mir im Vergleich mit den anderen Geschichten aufgefallen – dass es von meiner Oma nur überhaupt zwei Fotos gibt, denn niemand hatte einen Fotoapparat und auch keine Zeit für so etwas, dass sie auch kein Auto hatten, vor dem man sich hätte fotografieren lassen können, dass sie auch nie in Urlaub fahren konnten, von dem es Fotos hätte geben können, dass sie arm waren, ohne dass sie je von sich gedacht hatten, arm zu sein. (Und meine andere Seite der Familie war noch sehr viel ärmer.) D.h. die Klassenfrage, die Frage nach der Herkunft, drängt bei jedem weiteren Schreiben und im Alter immer stärker durch.» Alice Grünfelder
Ein wunderbares Buch, eine Einladung, ein Zeitdokument.
Wolfram Schneider-Lastin, geboren 1951 in Schwäbisch Gmünd, studierte Schauspiel, Germanistik, Geschichte, Altphilologie und Kunstgeschichte an den Hochschulen Stuttgart, Tübingen, Wien und Rom. Seit 1988 lebt er in der Schweiz, wo er seine wissenschaftliche Karriere – nach der Promotion über Johann von Staupitz – an verschiedenen Universitäten und als Redakteur der Zeitschrift Librarium fortsetzte. Als Schauspieler hat er sich vor allem mit literarischen Lesungen einen Namen gemacht.
Die Autorinnen und Autoren: Fabio Andina (CH), Esther Banz (CH), Nelio Biedermann (CH), Sabine Bierich (D/CH), Zora del Buono (CH/D), Alex Capus (CH), Verena Dolovai (A), Daniela Engist (D), Oded Fluss (ISR/CH), Romana Ganzoni (CH), Roswitha Gassmann (CH), Alice Grünfelder (D/CH), Gottfried Hornberger (D), Waseem Hussain (PAK/CH), Markus Knapp (D), Andreas Kossert (D), Martin Kunz (CH), Hanspeter Müller-Drossaart (CH), Christa Prameshuber (A/CH), Helmut Puff (D/USA), Klemens Renoldner (A), Christian Ruch (D/CH), Ariela Sarbacher (CH), Thomas Sarbacher (D/CH), Herrad Schenk (D), Gerrit Schneider-Lastin (DDR/CH), Wolfram Schneider-Lastin (D/CH), André Seidenberg (CH), Ruth Werfel (CH), Anke Winter (D/CH)
«Ich wundere mich über die historische Amnesie in Jurys, Feuilletons, sogenannten Kulturkreisen, wie wenig von diesem Wissen vorhanden ist, wie wenig diese Leute in diesen Bubbles selbst von anderen Kreisen wissen, in denen sie sich nicht bewegen, wie viel für «alt» gehalten wird und noch lange nicht überwunden ist – und wie viel Kraft es kostet, diese Vergangenheit und auch Krisen anderswo wieder und wieder gegen den Mainstream in Erinnerung zu rufen.» Alice Grünfelder
Illustration © Hannes Binder




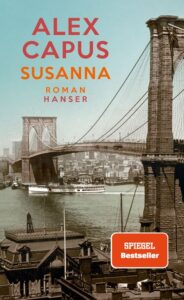

 jenem Tag, als er Marie trifft, aus Blicken und einem Spaziergang in die Nüsse eine Liebe wird, die aber keine Chance hat. Maries Vater ist ein wohlhabender Bauer. Jacob ein «Halbwilder» ohne Familie, viel zu wenig für einen Bauer, der bei der Vermählung seiner Tochter strategisch denkt. Aber die Liebe lässt sich durch keine Strategie durchkreuzen. Marie und Jacob finden sich – aber Jacob muss das Land verlassen, um der Willkür des tobenden Bauern zu entkommen. Er wird Soldat am Ärmelkanal, später Kuhhirt am Hof Ludwig XVI, wo Élisabeth Philippe Marie Hélène de Bourbon, die Schwester des Königs vor den Toren Versailles ein «Landgut» betreibt, eine heile Welt direkt neben der zu Stein gewordenen Machtdemonstration des untergehenden Nachfolgers des einstigen Sonnenkönigs.
jenem Tag, als er Marie trifft, aus Blicken und einem Spaziergang in die Nüsse eine Liebe wird, die aber keine Chance hat. Maries Vater ist ein wohlhabender Bauer. Jacob ein «Halbwilder» ohne Familie, viel zu wenig für einen Bauer, der bei der Vermählung seiner Tochter strategisch denkt. Aber die Liebe lässt sich durch keine Strategie durchkreuzen. Marie und Jacob finden sich – aber Jacob muss das Land verlassen, um der Willkür des tobenden Bauern zu entkommen. Er wird Soldat am Ärmelkanal, später Kuhhirt am Hof Ludwig XVI, wo Élisabeth Philippe Marie Hélène de Bourbon, die Schwester des Königs vor den Toren Versailles ein «Landgut» betreibt, eine heile Welt direkt neben der zu Stein gewordenen Machtdemonstration des untergehenden Nachfolgers des einstigen Sonnenkönigs. Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten und Reportagen. Bei Hanser erschienen «Léon und Louise» (2011), «Fast ein bisschen Frühling» (2012), «Skidoo» (Meine Reise durch die Geisterstädte des Wilden Westens, 2012), «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» (2013), «Mein Nachbar Urs» (Geschichten aus der Kleinstadt, 2014), «Seiltänzer» (Hanser Box, 2015), «Reisen im Licht der Sterne» (2015), «Das Leben ist gut» (2016) und «Königskinder».
Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten und Reportagen. Bei Hanser erschienen «Léon und Louise» (2011), «Fast ein bisschen Frühling» (2012), «Skidoo» (Meine Reise durch die Geisterstädte des Wilden Westens, 2012), «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» (2013), «Mein Nachbar Urs» (Geschichten aus der Kleinstadt, 2014), «Seiltänzer» (Hanser Box, 2015), «Reisen im Licht der Sterne» (2015), «Das Leben ist gut» (2016) und «Königskinder».
 Bar, nicht weit vom Bahnof, eingeklemmt zwischen kubische Glaspaläste der Neuzeit. Eigentlich ist Max Schriftsteller, aber so gern er manchmal schreibt, so gerne tut er das, was im alten Gemäuer seiner Bar an Arbeit anfällt, sei es auch nur der Gang mit zum Altglas auf dem Handwagen zur Sammelstelle. Seine Bar ist der Ort seiner Geschichten, wie jene, die der Bar den Namen gibt oder jene, die erzählt, warum an der einen Wand ein Stierkopf hängt, der einmal in der Not gar ersetzt werden musste. Geschichten von Menschen, die Stammkunden in der Sevilla Bar sind und über deren Leben Max als Barbesitzer und -betreiber unweigerlich vielmehr erfährt, als sässe er zuhause allein hinter seinem Schreibtisch: Von Ismail, der nie zur Ruhe kommt, von Miguel Fernando Morales Delavilla Miguelanes, dessen Frau Max einen Korinthenkacker und Hochtonfurzer schimpft. Oder von seinem ehemaligen Lehrer Toni Kuster und seinem Cowboy-Freund aus den Everglades.
Bar, nicht weit vom Bahnof, eingeklemmt zwischen kubische Glaspaläste der Neuzeit. Eigentlich ist Max Schriftsteller, aber so gern er manchmal schreibt, so gerne tut er das, was im alten Gemäuer seiner Bar an Arbeit anfällt, sei es auch nur der Gang mit zum Altglas auf dem Handwagen zur Sammelstelle. Seine Bar ist der Ort seiner Geschichten, wie jene, die der Bar den Namen gibt oder jene, die erzählt, warum an der einen Wand ein Stierkopf hängt, der einmal in der Not gar ersetzt werden musste. Geschichten von Menschen, die Stammkunden in der Sevilla Bar sind und über deren Leben Max als Barbesitzer und -betreiber unweigerlich vielmehr erfährt, als sässe er zuhause allein hinter seinem Schreibtisch: Von Ismail, der nie zur Ruhe kommt, von Miguel Fernando Morales Delavilla Miguelanes, dessen Frau Max einen Korinthenkacker und Hochtonfurzer schimpft. Oder von seinem ehemaligen Lehrer Toni Kuster und seinem Cowboy-Freund aus den Everglades.![Capus_hf_i[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/08/Capus_hf_i1-195x300.jpg) Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. 1994 veröffentlichte er seinen ersten Erzählungsband «Diese verfluchte Schwerkraft», dem seitdem weitere Romane, Bücher mit Kurzgeschichten und Reportagen folgten. Alex Capus verbindet sorgfältig recherchierte Fakten mit fiktiven Erzählebenen, in denen er die persönlichen Schicksale seiner Protagonisten einfühlsam beschreibt. Bei Hanser erschienen zuletzt die Romane «Léon und Louise» (2011) sowie der Western «Skidoo» (2012).
Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. 1994 veröffentlichte er seinen ersten Erzählungsband «Diese verfluchte Schwerkraft», dem seitdem weitere Romane, Bücher mit Kurzgeschichten und Reportagen folgten. Alex Capus verbindet sorgfältig recherchierte Fakten mit fiktiven Erzählebenen, in denen er die persönlichen Schicksale seiner Protagonisten einfühlsam beschreibt. Bei Hanser erschienen zuletzt die Romane «Léon und Louise» (2011) sowie der Western «Skidoo» (2012).