Das Selbstverständnis „Die Krone der Schöpfung“ zu sein, ist angesichts der aktuellen Lage der Menschheit manchmal nur noch schwer nachzuvollziehen. In seinem neuen Essayband sind Beiträge aus dem Zeitraum von 2018 bis 2020 gesammelt. So etwas wie den Jahren vor und nach der „neuen Zeitrechnung“.
Die meisten dieser gesammelten Essays sind im Sonntags-Blick erschienen und garantieren schon einmal für adäquate Länge und Verständlichkeit, auch wenn das Lukas Bärfuss gar nicht beweisen muss. Lukas Bärfuss ist nicht der klassische Intellektuelle, studiert, promoviert, gebettet und gepolstert. Lukas Bärfuss ist feiner Beobachter, weder aus der Vogel- noch aus elitärer Perspektive. Kein Polterer, der sich in seinem übervollen Büro hinter seinen Papieren filmen lässt und die Welt mit ein paar Behauptungen und kernigen Sätzen erklärt. Keiner der Besserwisser, die sich auf Privatkanälen tummeln und ihren FollowerInnen den Kopf verdrehen.
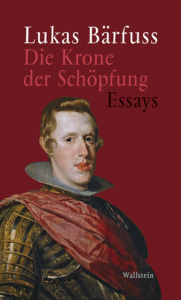
Und trotzdem sind seine Essays mit reichlich Pfeffer und Salz geschrieben, keine kopflastigen Pamphlete, sondern feinsinnige Analysen zu aktuellen Fragen der Zeit, von scheinbar kleinen Themen, hinter denen sich die grossen verstecken. Lukas Barfuss will verstehen und nimmt mich mit. Er sieht tief und will verstehen. Er denkt nach und schreibt. Fähigkeiten, die immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden, weil Selbstinszenierung und Selbstüberschätzung grassieren, sei es im Kleinen bis hin zur Weltpolitik. Die Wirren um Trumps Präsidentschaft sind ein Beispiel dafür.
«Die Geschichte bewegt sich nicht im Ochsengang, nicht in einem gleichmässigen Trott. Sie gleicht eher den wilden Sprüngen eines Pferdes, das nach Tagen im Stall wieder auf die Weide gelassen wird.»
Und Lukas Bärfuss ist Leser von Klassikern, wohl auch dort Vertreter einer aussterbenden Kaste, die sich nicht von Aktualität und Moderne, von Hype und Pointe leiten. Er liest und kombiniert. Er denkt nach, weiss um die menschlichen Schwächen und schlägt mir damit nicht um die Ohren. Was er schreibt, spornt mich an, nimmt mich mit. Bärfuss moralisiert nur rudimentär. Was als Moral durchscheint, ist an seine tiefe Betroffenheit gebunden.
„Die Krone der Schöpfung“ ist Lesegenuss und Denkfutter, vielleicht auch Lesefutter und Denkgenuss, auch wenn in manchen seiner Texte unterschwellig eine ganz ordentliche Portion Wut steckt. Aber nie eine destruktive Wut, nie eine Wut, die sich bei mir als Leser fortsetzen soll. Sondern in allen seinen Texten, Essays schwingt viel Respekt!
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht 2019 den
Georg-Büchner-Preis an Lukas Bärfuss, der mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens erkundet. In einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildersprache durchdringen sich in seinen Dramen und Romanen nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall, psychologische Sensibilität und der Wille zur Wahrhaftigkeit. Diese Qualitäten prägen zugleich Lukas Bärfuss‘ Essays, in denen er die heutige Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleitet.

Lukas Bärfuss, geb. 1971 in Thun / Schweiz, ist Dramatiker und Romancier, Essayist. Seine Stücke werden weltweit gespielt, seine Romane sind in zwanzig Sprachen übersetzt. Lukas Bärfuss ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und lebt in Zürich.
Er erhielt zahlreiche Preise, zuletzt u. a.: Berliner Literaturpreis (2013), Schweizer Buchpreis (für «Koala», 2014), Nicolas-Born-Preis (2015). Mit «Hagard» stand er 2017 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. 2019 wurde Lukas Bärfuss mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Rezension von «Hagard» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Lea Meienberg









 In einer Gesellschaft, die geprägt ist von Feindschaft, Unverständnis, Hass und Neid, in der es unter idyllischer Oberfläche brodelt und kocht, in der damit unverhohlen Politik gemacht wird und man Schuldzuweisung und Abschottung zur obersten politischen Strategie erklärt, erzählt Maja Haderlap unaufgeregt die Geschichte ihrer Familie, ihrer Grossmutter, ihres Vaters, ihrer Mutter.
In einer Gesellschaft, die geprägt ist von Feindschaft, Unverständnis, Hass und Neid, in der es unter idyllischer Oberfläche brodelt und kocht, in der damit unverhohlen Politik gemacht wird und man Schuldzuweisung und Abschottung zur obersten politischen Strategie erklärt, erzählt Maja Haderlap unaufgeregt die Geschichte ihrer Familie, ihrer Grossmutter, ihres Vaters, ihrer Mutter.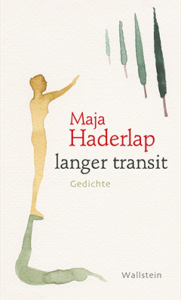 An diesem Abend, begleitet vom Gesang eines Männerchors aus der Nachbargemeinde ihres Heimatortes, las Maja Haderlap auch aus dem letzten von ihr veröffentlichten Gedichtband «langer transit». Gedichte, die Geschichten erzählen, die Stimmungen wiedergeben, Momente, in denen sich die Autorin auf sich und die Welt einlässt. Maja Haderlap, die früh mit dem Schreiben von Gedichten begann, begleitet das Schreiben von Gedichten schon Jahrzehnte, eine Form der Kommunikation mit Vergangenheit, Sprache, Natur und Momenten, aber nicht einfach Betrachtungen, sondern intensive Auseinandersetzungen, die sich bis ins Politische ausweiten. Maja Haderlap zeigt eindrücklich, wie sehr sich Lyrik einmischen, einbringen und einsetzen kann.
An diesem Abend, begleitet vom Gesang eines Männerchors aus der Nachbargemeinde ihres Heimatortes, las Maja Haderlap auch aus dem letzten von ihr veröffentlichten Gedichtband «langer transit». Gedichte, die Geschichten erzählen, die Stimmungen wiedergeben, Momente, in denen sich die Autorin auf sich und die Welt einlässt. Maja Haderlap, die früh mit dem Schreiben von Gedichten begann, begleitet das Schreiben von Gedichten schon Jahrzehnte, eine Form der Kommunikation mit Vergangenheit, Sprache, Natur und Momenten, aber nicht einfach Betrachtungen, sondern intensive Auseinandersetzungen, die sich bis ins Politische ausweiten. Maja Haderlap zeigt eindrücklich, wie sehr sich Lyrik einmischen, einbringen und einsetzen kann.