Schreiben, als ein «Ort extremer Klarheit»
«frag-ment-iert» lautet der Titel des Debüt-Romans von Ev Arlt, in dem sie das Epizentrum zwischen dem eigenen Glück und die Grenzen der Freiheiten literarisch auslotet.
 Gastinterview mit Urs Heinz Aerni
Gastinterview mit Urs Heinz Aerni
Urs Heinz Aerni: Der Sog des Lesens ist Ihnen gelungen. Kompliment, auch wenn der Einstieg uns gleich wieder in die Pandemie zurück katapultiert. Wann wussten Sie, dass Sie mit diesem Setting beginnen werden?
Ev Arlt: In meiner Geschichte geht es um die Frage nach der Konstruktion von Identität. Wir sehen der Protagonistin bei ihrem identitären Trauma zu, das im Verlust sozialer Rollen und des vertrauten sozialen Kontextes besteht. Diese rein persönliche Erfahrung wurde in ihren Auswirkungen ja in der Pandemie kollektiv erlebt, natürlich je nach persönlicher – kultureller und beruflicher wie ökonomischer – Situation anders ausdekliniert.
Aerni: Die Lektüre schickt die Lesenden schon zurück in eine Zeit, die man vergessen möchte, was keine Kritik ist, übrigens…
Arlt: Diese Analogie der sozialen, ökonomischen und psychischen Ausnahmesituation vermittelt den Lesenden zu Beginn der Erzählung jene Beklemmung, jenes Gefühl von Isolation und sozialer und eventuell ökonomischer Unsicherheit, die aus eigener Erfahrung bekannt sein dürften. Im Buch geht es dann ja überhaupt nicht um die Pandemie – vielmehr um die Themen Würde, Freiheit und Selbstbestimmung.
In einer Szene wird ein aus dem Radio tönender Song von David Bowie wie folgt kommentiert: «Wie aus einer anderen Zeit überschaubarer Weltprobleme – Heroin und Langstreckenraketen.» Ist heute so alles anders als früher?
Gar keine Frage, wobei wir jetzt natürlich exklusiv über unseren Teil der Welt reden. Das Ende des Kalten Krieges, der 11. September und nun der Krieg in Europa markieren eine tiefgreifende Wende, die deutlich sichtbar zu einer breiten Verunsicherung geführt und strukturelle gesellschaftliche Veränderungen nach sich gezogen hat. Ob alles anders ist als früher, muss jeder individuell für sich beantworten.
Was war für Sie der Fokus hierbei?
Mir geht es bei dieser Beobachtung um die ökonomische und politisch-soziale Entwicklung in Europa und die nicht einfache, hochkomplexe Problemlage in unseren Gesellschaften. Ich glaube durchaus, dass es eine Sehnsucht nach einer Welt in schwarz-weiß gibt.
Woran machen Sie das fest?

Das Ablehnen komplexer Realitäten erkennt man ja klar am zunehmenden Erfolg vereinfachender Rhetorik der Debatten oder am breiten gesellschaftlichen, von Algorithmen gelenkten Diskurs, der gar keiner mehr ist. Man wirft sich die Feindbilder an den Kopf, die Angst geht um, jeder zieht sich in sein Lager, seine Bubble, zurück. Überspitzt gesagt: Politisch korrekte Realitätsverweigerer stehen dem aggressiven Machtanspruch der Vereinfacher gegenüber.
Statt «Roman» steht unter dem Titel «Die unvorhersehbare Reise des Fräulein L.» Was war die Überlegung auf die Gattung Roman zu verzichten?
Aber ich halte ja ohne Zweifel einen Roman in der Hand. Es handelt sich lediglich um einen Untertitel, der angesichts des sicherlich enigmatischen Buchtitels der Leserschaft letztlich doch etwas Orientierung geben soll. Man erfährt: es geht um einen weiblichen Hauptcharakter und um eine Reise, die offenbar so nicht geplant war.
Sie entschieden sich im Untertitel für das Wort «Fräulein»…?
Ja. Ich gehöre zu einer Generation, die diese Bezeichnung in ihrer diskriminierenden Dimension nicht nur überwunden, sondern vermutlich niemals als Problematik begriffen hat. Wir fokussieren uns auf andere Probleme im heterosexuellen Miteinander, die Debatten sprechen da für sich. Wir besitzen Ironie und Selbstbewusstsein und ein eigenes Portemonnaie. Es gibt wichtige Frauenthemen – das ist keines.
Hört sich erfrischend an, denn das «Fräulein» liest sich bekanntlich antiquieret an allerdings mit auch mit einem literarischen Beiklang.
Die Bezeichnung „Fräulein“ wird tatsächlich schon seit Jahren auch für Produkte verwendet – Modeartikel, Eisdielen. Offenbar klingt das Wort kokett, frech, jung, ansprechend. Was mein Buch angeht, ist die Protagonistin am Anfang ihrer Reise definitiv so: jung, kokett – naiv und etwas verloren. Das steckt doch eigentlich im Untertitel, der den Namen des Fräuleins dann ja nur mit einem Großbuchstaben verrät – ein Verweis auf das Verwirrspiel mit Identitäten.
Die junge Protagonistin wird Mutter Anfang der Nullerjahren in Deutschland. Es schien alles offen zu sein für die jungen Menschen, von Karriere bis alle Freiheiten. Und doch kam es anders. Abgesehen vom Geschehen im Buch, wie sehen Sie die Zukunft der jetzigen Jugend?
Die Frage lässt sich angesichts der ungelösten und sich zuspitzenden globalen Probleme im Grunde leicht beantworten. Andererseits ist die junge Generation auch wieder laut und macht sich bemerkbar. Sie haben definitiv andere Instrumente als meine technologiefern aufgewachsene Generation, der die Reste der Ideologien am Ärmel klebten und der der Druck einer neoliberalen Gesellschaft die großen Gewissensfragen im großen Ganzen bequem ersparte.
Und die…
Die jetzige Jugend?
Ja.
Im schlimmsten Fall sind sie brave Konsumenten, im Besten viel weniger beeinflussbar vom System, das sie längst durchschaut haben und ironisieren bis verachten. Ein großes Problem unserer Zeit beim Beurteilen von Fragen wie diesen ist doch die allumfassende Inszenierung, der wir hilflos ausgesetzt sind und aus der wir nur schwer Wahrheiten ableiten können.
Sie arbeiten mit fast surrealen Einschüben in kursiver Schrift im Buch. Wie kamen Sie zu dieser Idee solcher stilistischen Mitteln?
Es stellt sich hier, denke ich, weniger die Frage nach der Idee zur Textmontage als vielmehr zur zweiten Protagonistin des Buches. Die surreale Ebene von Phoenix – nennen wir sie eine Scheintote, die gegen die strukturelle Herrschaft alter Männer vorgeht – muss natürlich zwangsläufig zu diesem Stil führen. Phönix sehnt sich dabei in Wahrheit die ganze Zeit nach der Auflösung ihrer Opferrolle und sucht mit Gewalt nach einem Ausweg.
Das hat sich also beim Schreiben mutierend entwickelt…
Es steckt generell tatsächlich weniger Konstruktion hinter dem Ergebnis meines Schreibens als vielmehr Entwicklung und Reifen – es gibt durchaus eigenständige Prozesse, mit denen ich behutsam umgehe, von denen ich überrascht werde, die sich mir aufdrängen und die mich leiten. Das Kursiv in meinem Roman, wenn Sie so wollen, steht für Abrechnung, für Hoffnung auf Erlösung, für Sehnsucht nach persönlichem Glück, für Erkenntnis.
Sie studierten Theater- und Politikwissenschaften und Soziologie, waren als Journalistin tätig und leben – soviel ich weiß – in Italien. Bleibt es dabei, mit Italien und dem Schreiben?
Tatsächlich kann ich mir da in nächster Zukunft so einige Veränderungen vorstellen – wieder mehr redaktionell zu arbeiten wäre schön. Mein italienisches Domizil darf man sich jetzt nicht verspielt mit Zitronenbäumen und eleganten Zypressen an der Einfahrt vorstellen, ich bin wirklich drin in dieser widersprüchlichen, ächzenden Gesellschaft.
Mit welcher Wahrnehmung Ihrerseits?
Die Italiener sind emsig arbeitende Stehaufmännchen und phantasievolle Lebenskünstler mit einer bewundernswert unverbrüchlichen Energie und Lebensfreude und zutiefst humane Menschen – allerdings in einem System, welches mich seit je an den realen Sozialismus erinnert, wobei die zentrale ineffiziente Verwaltung mafiös unterwandert ist. Um hier zu überleben, muss man die Schlupflöcher im System kennen. Frauen wie Männer arbeiten viel, den Freizeitanspruch der Deutschen kennen sie nicht. Sie ernähren die Familien gemeinsam, die Geschlechterproblematik beginnt im Privaten und der Sexismus hierzulande ist bodenlos salonfähig und allseits geduldet. Ich würde dem Land mehr Transparenz und Gerechtigkeit wünschen.
Deutliche Worte…
Was das Schreiben angeht: das ist nie eine Option gewesen, sondern für mich primärer Ausdruck. Das Leben drinnen und draußen entwirren. Ein Ort extremer Klarheit. Eine Spielwiese für verschachtelte Gedanken und unklare Emotionen. Figuren, in die ich mich verliebe. Schreiben ergo sum.
Ev Arlt wurde 1978 in Nürnberg geboren, studierte Theaterwissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie in München, Berlin und Siena. Sie war unter anderem als Radiomoderatorin und Journalistin tätig. Derzeit schreibt sie aus Italien.
Beitragsbild zVg





 Interview:
Interview: 


 «Ich muss ja nur noch, was ich muss.»
«Ich muss ja nur noch, was ich muss.»
 Martin Kunz studierte Philosophie, anthropologische Psychologie, Pädagogik und deutsche Literatur in Zürich und Berlin. Weiterhin studierte er am Konservatorium und an Kunstschulen und liessß sich zum analytisch orientierten gestaltenden Psychotherapeuten ausbilden. Bis vor kurzem war er Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Heute führt er am Rande des Zivilisationslärms ein Atelier für Kunst und Philosophie. Von ihm sind u. a. «Honig und Quarz. Lyrik und philosophische Zuspitzungen» (Collection Entrada 2017) und das «Wider der Selbstvergessenheit», Bucher Verlag 2020).
Martin Kunz studierte Philosophie, anthropologische Psychologie, Pädagogik und deutsche Literatur in Zürich und Berlin. Weiterhin studierte er am Konservatorium und an Kunstschulen und liessß sich zum analytisch orientierten gestaltenden Psychotherapeuten ausbilden. Bis vor kurzem war er Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Heute führt er am Rande des Zivilisationslärms ein Atelier für Kunst und Philosophie. Von ihm sind u. a. «Honig und Quarz. Lyrik und philosophische Zuspitzungen» (Collection Entrada 2017) und das «Wider der Selbstvergessenheit», Bucher Verlag 2020). 
 P.B.W. Klemann wurde 1981 in Singen unter der Festung Hohentwiel geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bohlingen. Der Autor hat an der Universität Konstanz Philosophie und Mathematik studiert. Seine erste Veröffentlichung war seine Abschlussarbeit zu Marc Aurel und der Stoa, die einen Universitätspreis erhielt. Es folgten Bücher im Bereich der Reiseliteratur sowie journalistische Arbeiten rund um Geschichte und Philosophie. Heute arbeitet er als Verlagsleitung und ist freier Drehbuchautor und Schriftsteller. Rosenegg ist somit nicht ganz ein Debüt aber Klemanns erster historischer Roman.
P.B.W. Klemann wurde 1981 in Singen unter der Festung Hohentwiel geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bohlingen. Der Autor hat an der Universität Konstanz Philosophie und Mathematik studiert. Seine erste Veröffentlichung war seine Abschlussarbeit zu Marc Aurel und der Stoa, die einen Universitätspreis erhielt. Es folgten Bücher im Bereich der Reiseliteratur sowie journalistische Arbeiten rund um Geschichte und Philosophie. Heute arbeitet er als Verlagsleitung und ist freier Drehbuchautor und Schriftsteller. Rosenegg ist somit nicht ganz ein Debüt aber Klemanns erster historischer Roman.





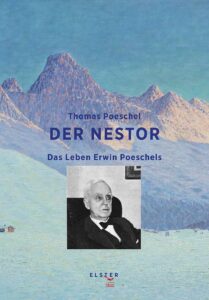

 Urs Heinz Aerni: Ihr Verlagslogo schmückt sich mit einer Meeresgöttin, der Amphtrite. Wie sind Sie auf sie gekommen?
Urs Heinz Aerni: Ihr Verlagslogo schmückt sich mit einer Meeresgöttin, der Amphtrite. Wie sind Sie auf sie gekommen?

 Monika Lustig,
Monika Lustig,