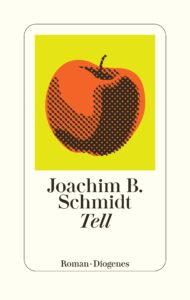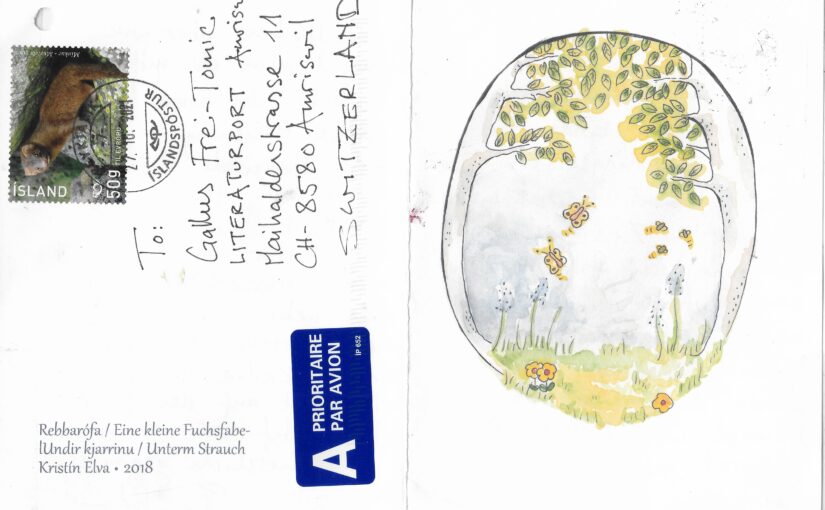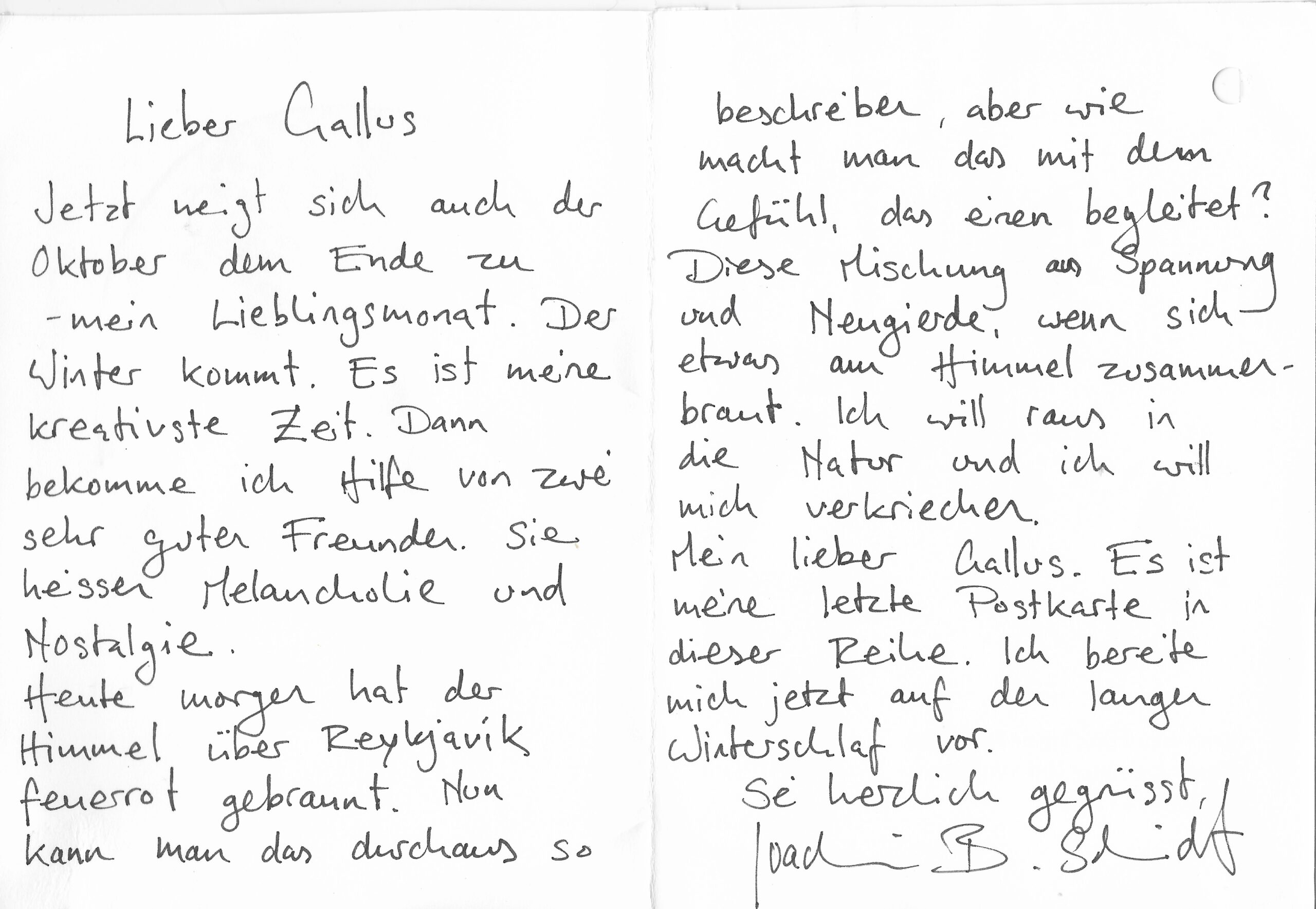Liebe Sieglinde, du sitzt das dritte Jahr in der Jury des Schweizer Buchpreises, bist in diesem Gremium „Dienstälteste“. Ehre und Last zugleich?
Liebe Sieglinde, du sitzt das dritte Jahr in der Jury des Schweizer Buchpreises, bist in diesem Gremium „Dienstälteste“. Ehre und Last zugleich?
Weder noch. Ich bin ein ganz normales Jury-Mitglied. Allerdings möglicherweise mit einem Erfahrungsvorsprung: Ich weiß, wie unterschiedlich die Diskussionen, die „Chemie“ in der Jury jedes Jahr war. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wie anders wir lesen – bei aller professionellen Leseerfahrung. Die Jurysitzungen sind eine unvergleichliche Gelegenheit, das eigene Urteil zu hinterfragen. Das hat zur Folge, dass ich mir als Leserin je länger, je weniger über den Weg traue. Eine Erfahrung, die sich mit jeder Jurysitzung erneuert.
Fast hundert Titel wurden eingereicht. Wie gross ist dein tatsächliches Lesepensum für den Buchpreis? Wählt man da die Bücher aus, die man schon gelesen hat? Oder musst du gar Bücher ein zweites Mal lesen, weil dich deine JurykollegInnen dazu nötigen?
Wir teilen die Bücher so auf, dass jedes Buch von mindestens zwei Jurymitgliedern gelesen wird. Was von der Qualität her überzeugt, müssen dann alle lesen. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Bücher ich letztlich gelesen habe, es werden so um die fünfzig gewesen sein. Manches habe ich tatsächlich ein zweites Mal gelesen, um meinen Eindruck zu überprüfen. Die zweite Lektüre ist der Lackmus-Test: Entweder ich kenne schon alles und entdecke nichts Neues (das kann auch bei sehr komplex gebauten Romanen der Fall sein), oder ich sehe neue Dimensionen, erkenne interessante Widersprüche in den Charakteren, verborgene Handlungslinien oder sprachliche Eigenheiten, die mir bei der ersten Lektüre nicht aufgefallen waren. Sei es, weil ich nicht „wach“ genug war (gerade, wenn man so viele Bücher liest, ist man nicht immer gleich aufnahmefähig), sei es, weil das Werk eine Tiefe hat, die sich beim ersten Lesen nicht voll erschliesst.
Liest du ein Buch aus dieser Auswahl anders als jene Bücher, die du sonst als Buchkritikerin liest?
Beim Jurylesen geht es darum, möglichst wenig Zeit mit jenen Büchern zu verbringen, die von der Qualität her nicht in Frage kommen. Wenn ein Buch mich in der ersten Hälfte nicht überzeugt, kommt es für den Preis nicht mehr in Frage, auch wenn es sich in der zweiten Hälfte berappelt.
Wenn ich dagegen als Kritikerin lese, kosten mich oft gerade jene Bücher viel Zeit, die mir nicht gefallen, denn wenn ich einen Verriss schreibe, muss ich meine Kritik transparent begründen, und das bedeutet auch, dass ich meine Kriterien wieder neu reflektiere. Beim Rezensieren befinde ich mich oft im Feld des „Einerseits-Andererseits“, da muss ich auch Büchern gerecht werden, die für einen Preis nicht in Frage kämen.
Der Schweizer Buchpreis will den präsentierten Büchern „grösstmögliche Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bieten“. Schielt man dann in den Schlund des öffentlichen Geschmacks?
Laut Reglement wird der Schweizer Buchpreis für „das beste erzählerische oder essayistische deutschsprachige Werk“ vergeben. Die „grösstmögliche Aufmerksamkeit“ ist kein Kriterium für die Auswahl der Werke. In den drei Jahren, in denen ich dabei war, ging es in den Diskussionen nie um die öffentliche Aufmerksamkeit, sondern nur um die literarischen Kriterien, nach denen wir die eingereichten Werke beurteilten.
Deswegen stand die Jury paradoxerweise auch in der Kritik: Vor allem bei den Shortlists der letzten beiden Jahre wurde bemängelt, dass sich zu wenige bereits bekannte Werke darauf befanden. Letztes Jahr erhielt mit Kim de l’Horizons „Blutbuch“ sogar ein Debüt den Preis. Doch das hat m. E. mit der Innovationskraft der Schweizer Literaturszene zu tun. Bei mehr als der Hälfte der eingereichten Werke hatte ich den Namen der Autor:innen noch nie gehört, und das ist dann ein abenteuerliches Lesen mit vielen Entdeckungen. Manchmal raubt es mir den Atem, wenn ein Buch etwas macht, was ich noch nirgends gelesen habe.
Wie muss man sich das Auswahlverfahren innerhalb der Jury vorstellen? Müssen die fünf Bücher, die auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises einstimmig in die letzte Runde geschickt werden? Wie heftig können solche Diskussionen werden?
Solche Diskussionen sind immer heftig, das ist die Essenz der Jury-Arbeit. Jeder Kopf liest anders, und jedem von uns hat schon das Herz geblutet, weil man für ein Buch, für das man brannte, keine Mehrheit erreichen konnte – weil die anderen es eben anders gelesen hatten. Auch das Gegenteil passiert: Man lehnt einen Roman ab, den die Mehrheit grossartig findet. Gerade nach meiner Erfahrung der drei Jahre bin ich überzeugt, dass die Shortlist bei einer anders zusammengesetzten Jury anders aussehen würde; es gibt kaum je „Selbstläufer“, die zwangsläufig auf die Shortlist kommen.
Wirst du anders wahrgenommen, seit du in der Jury mitarbeitest? Telefoniert und schreibt man dir, um dich über die wahren Perlen in Kenntnis zu setzen?
Nein. Ich denke, da liegt die Hemmschwelle bei den Verlagen hoch, und das weiss ich sehr zu schätzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Berlin lebe und wenige persönliche Verbindungen zur Schweizer Verlagswelt habe.
In der Vergangenheit stand der Schweizer Buchpreis schon mehrfach und immer wieder in der Kritik. Wie weit muss ein Jurymitglied konflikt- und kritikresistent sein?
Ich darf mich als Jurymitglied nicht vorauseilend von einer möglichen Kritik beeinflussen lassen. Wenn ich die eingereichten Bücher lese, dann gibt es in diesem Moment nur mich und das Buch. Julian Schütt hatte angesichts der vielen Debüts auf den früheren Shortlists zu bedenken gegeben, dass der Schweizer Buchpreis kein Entdeckerpreis werden dürfe, sondern auch den Glamour der bekannten Namen brauche. Das mag ein berechtigter Einwand sein, doch steht er in einem Konflikt zum Reglement: Wenn die Bücher, die wir nach unserer Auseinandersetzung als die besten identifiziert haben, von unbekannten Autor:innen stammen, dürfen wir hier keine Kompromisse machen. Jurys können auch ein Korrektiv der Literaturkritik sein – gerade, weil wir Diskussionen führen und uns mit der Lesart der anderen auseinandersetzen. Als Kritikerin bin ich ja mit meinem Kopf weitgehend allein, da gibt es auch die Gefahr, dass man sich verrennt. Deshalb gibt es ja die vielen Hypes.
Es gibt etliche AutorInnen, die sich mittlerweile dem Schweizer Buchpreis verweigern. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Kritikpunkt, der immer und immer wieder auftaucht, ist der, Bücher könne man nicht in eine Wettbewerbskonkurrenz schicken. Bücher würden nicht taugen, sie aneinander zu messen. Dieses Argument blitzt nur beim Schweizer Buchpreis auf. Aber im Gegensatz zu allen anderen Preisen ist hier die Auswahl der letzten im Scheinwerferlicht. Ist das gut so, wenn 4 MitkonkurrentInnen an der Preisverleihung in einer Mischung aus Enttäuschung und Verlegenheit artig mitklatschen?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn es um die ganz grosse Kunst geht, ist der Wettbewerbsgedanke in der Tat nicht angemessen: Es hat keinen Sinn zu fragen, ob Kafka besser sei als Beckett. Wenn es jedoch darum geht, die sehr guten von den mittelmässigen Werken zu unterscheiden, kann man sehr wohl einen Wettbewerb durchführen. In diesem Sinn ist Literaturkritik ja immer ein inoffizieller Wettbewerb.
Alain Claude Sulzer war zwei Mal mit einem Roman auf der Shortlist und bekam dann jeweils den Preis nicht, und er hat letztes Jahr in einem Artikel in der NZZ am Sonntag freimütig bekannt, dass er sich diese „Demütigung“ kein drittes Mal antun wolle; deshalb macht er nicht mehr mit beim Buchpreis. Gerade für arrivierte Autor:innen kann es schwierig sein, wenn sie sich die Shortlist mit Debütant:innen teilen müssen, mit dem Risiko, dass der Preis an jemanden geht, der oder die im Literaturbetrieb noch keinen Status hat. Auch der Deutsche Buchpreis sieht sich mit diesem Problem konfrontiert: So soll der Erscheinungstermin des neuen Romans von Daniel Kehlmann vom Verlag bewusst so angesetzt worden sein, dass das Buch nicht für den Preis eingereicht werden konnte. Aber das ist nun mal the name of the game: Selbst wenn alle nominierten Bücher den Preis verdient hätten, kann nur ein Roman gewinnen.
Auch das ist übrigens eine Erfahrung, die ich als Jurymitglied gemacht habe: Es ist überhaupt nicht ausgemacht, welches der fünf Bücher am Ende das Rennen macht. Wir lesen die Titel auf der Shortlist noch ein zweites Mal, oft mit überraschenden Ergebnissen. Auch diesmal bin ich gespannt auf unsere Diskussionen.
Gibt es festgelegte Kriterien? Orientiert sich die Jury an aktuellen Themen, Diskussionen, Strömungen?
Kriterien für Literatur kann man kaum festlegen. Das ist auch das Spannende an den Diskussionen: Wir bringen alle unsere eigenen Kriterien mit. Für mich sind Innovation, Kreativität, Risikobereitschaft ein wichtiges Kriterium: Macht jemand etwas mit der deutschen Sprache, was noch niemand vor ihm oder ihm gemacht hat? „Make it new!“, so definierte Ezra Pound einmal die Aufgabe der Autor:innen. Im Weiteren geht es um die Plausibilität von Figuren und Handlungen. Doch dann gibt es Werke, die meine „willing suspension of disbelief“ strapazieren – und die das auf so zwingende Weise tun, dass ich nicht widerstehen kann.
Kriterien gibt es am ehesten für rein handwerkliches Können: Funktionieren Perspektivwechsel? Sind die Dialoge lebendig? Finden sich Klischees, Stilblüten, etc.? Doch dann gibt es wieder Romane, die alles richtig machen, zugleich jedoch so öde sind, dass ihnen jede Relevanz abgeht. Auch wenn ein Roman von brennend wichtigen Dingen handelt, dies jedoch auf literarisch unbedarfte Weise tut, kommt er für den Schweizer Buchpreis nicht in Frage. Denn eine Geschichte ist nur so gut, wie sie erzählt wird.
Ich wurde letztes Jahr mehrfach mit dem Verdacht konfrontiert, dass wir Kim de l‘Horizons „Blutbuch“ wegen seiner Thematik ausgezeichnet hätten und dem Modetrend des Non-Binären aufgesessen seien. Doch dieser Vorwurf kam ausschliesslich von Leuten, die das Buch nicht gelesen hatten. In den Jurydiskussionen ging es nur um die literarischen Qualitäten: den Wagemut, den Erfindungsreichtum, den sprachlichen Drive. Das kann man auch in der Laudatio auf der Website des Schweizer Buchpreises nachlesen.
Noch ein Buch ausserhalb jeder Konkurrenz, das du empfehlen willst?
Ich empfehle die grosse Schweizer Autorin Eleonore Frey, die mit 84 Jahren immer noch ein Geheimtipp ist. Es kommt fast nie vor, dass eine Literaturwissenschaftlerin auch Prosa schreibt: Eleonore Frey war bis 1997 Titularprofessorin am Deutschen Seminar in Zürich, ich habe bei ihr studiert. Sie erschafft Literatur mit dem Wissen darüber, wie Literatur gemacht ist – und doch ist in ihren Romanen und Erzählungen nichts „gemacht“. Ihre Texte sind verspielt, hellwach, und sprachlich sind sie so kühn wie sorgfältig. Mit jedem Werk überrascht mich Eleonore Frey aufs Neue.
Sieglinde Geisel, geboren 1965 in Rüti/ZH (Schweiz), lebt in Berlin seit 1999 freie Journalistin, regelmässige Mitarbeit bei Deutschlandfunk Kultur, SRF2 („Literatur im Gespräch“), bei der Republik u.a., 2016: Gründung des Online-Literaturmagazins tell, Schreibcoach. Jurymitglied 2021, 2022, 2023.
Beitragsbild © Lena Mucha



 Gastbeitrag von Sophie Waldner
Gastbeitrag von Sophie Waldner