Er wusste immer, dass er einmal der reichste Oberbrucher wird. Und dass ihm irgendwann mal die richtige Idee kommen würde, war ihm auch klar. Nur dass es so einfach sein würde, hätte er nie gedacht. Vor allem nicht, wenn man dabei auch noch ehrlich bliebe. Wahnsinnig ehrlich. Mit dem Wahnsinn seinen Lebensunterhalt verdienen, dachte er und musste darüber seinen Kopf ein wenig von der einen zur anderen Seite schütteln, weil er lachen musste. Das sind die Momente, die man sich erträumt. Träumend in der Wirklichkeit hängen, und sie schießt einen nicht ab. Lässt einen hängen. Genüsslich. Für beide. Als hätte das Dasein einen Sinn fürs Gerechte.
Er wartete auf Klaus, der um halb neun kommen wollte. Klaus würde um die Ecke kommen, mit seinem Zweirad, was er naturgemäß überhaupt nicht gerne hörte. Er fuhr also am liebsten Motorrad, mehr noch als alles andere, da brachte ihn keiner von ab. Und was Klaus am wenigsten leiden konnte, war ein Sozius hinter ihm. Selbst seine eigene Freundin, wenn er denn mal wieder eine hatte, mochte er nicht hinter sich haben. Was er aber überhaupt nicht ausstehen konnte, war, wenn sie sich an ihm festhielt und von hinten ihre Arme um ihn geschlungen hatte. Wenn Klaus schon mal jemanden mitnahm, dann sagte er gleich, dass er das nicht mochte. Wem er nichts erklären musste, war seine süße Gummipuppe. Deshalb nahm er die auch am ehesten von allen mit. Obwohl er am liebsten immer noch alleine Motorrad fuhr. Und das würde auch so bleiben, bis an sein Lebensende. Das ließ Klaus immer wieder durchblicken. – Dass er damit aber Joschy zu einem reichen und deshalb angesehenen Oberbucher machen würde, konnte natürlich keiner ahnen. Klaus kam wie verabredet gegen halb neun um die Ecke gefahren. Joschy stand schon draußen vor der Tür, es waren schon sechs Minuten nach halb neun, und er hatte heute Lust, in die Kiste zu fahren. Dort war es am diesem Tag immer am schönsten. Es war viel los, aber nicht so überfüllt von so vielen uninteressanten Leuten wie an den Wochenenden. Mittwochs war Philosophentag. Man freute sich die ganze Woche schon darauf. Und als Klaus um die Ecke bog, sah Joschy, dass er nicht ganz alleine war, jemand mit einer etwas ungewöhnlichen Farbe saß hinten drauf, ohne sich an Klaus’ Bauch festzuhalten. Sie saß sogar etwas nach hinten gebeugt dort, so dass man Angst haben musste, dass sie rücklings hinunterfallen würde. Sachte brachte Klaus die Maschine zum Stehen. Joschy traute seinen Augen nicht. Er erkannte sie als besagte Puppe mit Helm auf dem Kopf. „Nimm ihr den Helm ab“, sagte Klaus, nachdem er sein Visier hochgeklappt hatte, „und klemm sie zwischen uns“. Joschy zögerte. Er wollte sie erst kennen lernen. „Willst du sie mir nicht vorstellen?“ fragte er ihn. „Sie heißt Evelyn und kann verdammt gut blasen“, antwortete Klaus etwas genervt. Er wollte zur Kiste. Merkte aber auch, dass Joschy sich noch sträubte. Also drehte Klaus sich um, während die Maschine ins Wanken geriet, Joschy aber geistesgegenwärtig nach dem Lenkrad griff und sie wieder ins Gleichgewicht brachte, und zog ihr den Helm aus. – „Sie sieht etwas komisch aus“, sagte Joschy, der sich mit ihrem Mund nicht gleich anfreunden konnte. Klaus stieß einen langen Seufzer aus. – „Evelyn, das ist Joschy, er hatte immer schon Probleme mit Frauen, also sei artig. – Können wir jetzt fahren?“ – „Is’ ja schon gut“, erwiderte Joschy, während er sich den Helm aufsetzte und hinter Evelyn auf dem Motorrad Platz nahm. In der Kiste stellten die drei sich zwei Meter hinter dem Tresen zwischen die Stehtische. Evelyn mit Helm in ihrer Mitte. Jeder, der eintrat und an ihnen vorbeigehen wollte, wunderte sich zunächst darüber, dass jemand den Helm anbehalten hatte. Dann erspähten sie allmählich einen rosaroten Körper, nackt. Und als sie ihr Auge schamvoll darauf fallen ließen, wurde es immer größer. Sie erkannten eine Plastikhaut. Und als Klaus das Visier von Evelyns Helm hochzog und sie den weit offen stehenden Mund wahrnahmen, wurden die einen wütend, die anderen lachten laut auf und verneigten sich vor Evelyn, die ihnen natürlich vorgestellt wurde. Irgendwann an diesem Abend fragte zu später Stunde ein Fremder, der Evelyn unbedingt näher kennen lernen wollte, ob er die Sau mal ausgeliehen haben könnte. Der Kunde konnte kaum noch stehen und hatte nur noch Augen für die Kleine. – „Aber nur für zwei Bier und zwei Cola“, sagte Klaus.
Nickend drehte der Fremde seinen Kopf zur Seite, wie Betrunkene es nun mal tun, langsam und bedächtig, und bestellte die Getränke. „Und zehn Euro“, schoss es aus Joschys Mund, der das eigentlich gar nicht sagen wollte. Joschy war ein Mensch, der anderen Menschen nie zu nahe treten wollte. Deshalb sah Klaus ihn auch so überrascht an, genau so überrascht wie die vielen Leute, die an diesem Abend an ihnen vorüber gegangen waren. – „Klar“, antwortete der Fremde und begann nach seinem Portemonnaie zu suchen. Er legte zehn Euro auf den Tisch. – „Und wie wissen wir, dass du damit nicht abziehst“, fragte Klaus ihn. Schon legte der Fremde seine Geldbörse neben den Zehn-Euro-Schein auf den Tisch. – „Ich komm wieder, ehrlich“, stammelte er, „aber ohne Helm“, fügte er lallend hinzu.
Klaus nahm Evelyn den Helm ab, und sie sahen den beiden hinterher, wie sie aus dem Lokal verschwanden. Ein komisches Gefühl, dachte Joschy. Doch er sagte es nicht, wollte es lieber für sich behalten. Es war nicht so, dass irgendein Fremder mit irgendeiner Puppe ging. Es war anders.
Um sich nichts anmerken zu lassen, bestellte er zwei Bier und zwei Hennessy. Mit Cola, warf Klaus schnell hinterher, worauf Joschy nur sorry sagte. Er hatte nicht daran gedacht, dass Klaus mit dem Moped war, so zumindest nannte er seine Maschine, und außerdem konnte Klaus eh nicht viel vertragen. Ein richtiger Kumpan war er nie. Darin konnte man sich nie auf ihn verlassen. Das konnte Joschy, wenn er ehrlich war, noch nie leiden. Und das war auch immer etwas, was zwischen ihnen stand. Es hatte was mit der Einstellung zum Leben zu tun…
Nachdem die beiden ihre Gläser ausgetrunken hatten, sagte Klaus, dass der Typ bestimmt abgehauen sei, weil in seinem Portemonnaie nur noch 22 Euro waren. Pass und Bankkarte waren nicht darin. Joschy blickte auf. Nach einer kurzen Pause bat er Klaus mitzukommen. Er führte ihn über den Parkplatz in eine gegenüberliegende Hecke aus Koniferen. Er begann sie mit seinen Händen abzutasten, wie ein Bulle, der nach einer Waffe oder nach Stoff sucht. Nur dass der eine oder andere Ast sich nicht nur bewegte, sondern gar zurückschlug. Das machte Joschy wütend, und er suchte immer schneller, bis er plötzlich aufschrie: „Sieh hin, da liegt er.“ Der Fremde war über Evelyn eingeschlafen. Die weiße Haut seines Hintern blinzelte den beiden entgegen. Klaus sah Joschy fragend an. Der sah genauso jungfräulich zurück, mit seinen großen Rehaugen. Sonst immer so cool tun, dachte Joschy, und kaum sind wir in einer anderen Welt, schon ist der Lack ab. Er schüttelte nur mit dem Kopf und sagte nichts, weil er wusste, dass man in solchen Situationen einen Menschen am besten erkennen kann und seine Erkenntnis dann für sich behalten sollte, weil jedes Wort nicht nur zu viel ist, sondern stört.
So sah Joschy sich veranlasst, einen Ast der Konifere abzubrechen, um damit leicht auf die sich bewegende weiße Haut zu schlagen. Es tat sich nichts. Also versuchte er, etwas strenger zuzuschlagen. Doch immer noch keine Reaktion. Dann noch etwas härter. Im Einklang mit einem verzerrten Gesicht, das zum Glück im Dunkeln blieb, kam dann eine erste Regung. Noch härter. Ein erstes Lebenszeichen. Ein Knattern in der Stimme. Ein erstes Wort. Ein Satz fast. – „Eij, was soll das!“ – „Eij, du Penner, steh auf, du bringst unsere Evelyn um. Sie erstickt. Hast du se nicht mehr alle.“ Der Fremde regte und räkelte sich. – „Wollt’ ich nich’, sorry“, entschuldigte er sich, während er aufstand und sein Gleichgewicht zu finden suchte. – „Warst du zufrieden?“ fragte Joschy. – „Toll!“, antwortete der Fremde. – „Okay, ich glaub dir. Hier hast du dein Portemonnaie zurück.“ Der Fremde wurde plötzlich munter. Er bedankte sich überschwänglich, indem er Klaus um den Hals fiel, ihn dann losließ, um Joschy ebenso zu umarmen. Die beiden nahmen es hin. Und während sie dem Fremden hinterher blickten, sagte Joschy ganz trocken: „Der erste Freier!“ Klaus, der nicht hingehört hatte, sagte nur: „Und wer macht sie nun sauber?“ Einige Tage später rief Joschy seinen Freund Klaus an und fragte ihn, ob der ihm Evelyn überlasse. Klaus war froh, die Puppe los zu werden. Er mochte sie nicht mehr anfassen, seitdem dieser Typ sie hatte. Das war der Tag, an dem Joschy seine Chance sah. Mit diesem Tag setzte er seine Idee in die Wirklichkeit um. Nun ließ er die Puppen für sich tanzen. Bis hierher war es immer umgekehrt. Bis sie zuletzt überhaupt keine Achtung mehr vor ihm hatten, und ihn nur noch mit Helm herumlaufen ließen. Und es dauerte nicht lange, da konnte er sich eine zweite Puppe anschaffen, und eine dritte… eine vierte meldete sich fast von alleine. Die nämlich bekam er auch geschenkt, wie die erste, Evelyn, die nach wie vor sein bestes Plastikpferd im Stall war. „Pfand: 50 Euro und gespült zurück!“ Das war sein Werbespruch. Und alles lief wie am Schnürchen. Klar, hin und wieder kam die eine oder andere Puppe nicht wieder. Aber das machte gar nichts. Er hatte ja die 50 Euro als Pfand. Was für ihn aber am Wichtigsten war: Es war nie Evelyn, die wegblieb! Sie kam immer wieder zu ihm zurück! Auch wenn sie mit der Zeit, was nicht ausblieb, älter und verbrauchter wurde, so gab es Freier, die nur sie haben wollten. Mit der Zeit nämlich hatte sie Ecken und Kratzer entwickelt, die den Jungs gut taten. Verdammt gut. Sonst wäre sie nicht so gefragt gewesen. Und das Schönste war, dass sie den glatteren Mädels so einiges beibringen konnte. Joschy wollte eigentlich gar nicht reich werden. Er wollte nur unabhängig sein. Frei, wie er immer sagte, frei und trinken können, wann er will. Damit meinte er zwar nicht, wie er immer betonte, kein Bier vor Vier, sondern den Schmerz tief in seinem Herzen, der gegen seine ausgebeulten Gedanken fuhrwerkt, und das manchmal sage, weil er schräg geträumt habe, sonst aber gehe es ihm blendend, schließlich habe er fast alles erreicht in seinem Leben, und damit meinte er sicherlich, wie man sich vorstellen kann, dass man die eine oder andere Frau, die man in echt oder im Fernsehen sieht, wahrlich nicht von seiner Evelyn unterscheiden könne, nein, Evelyn… nein, lassen wir das.
Das einzige, was er wollte, war, sich einen weißen Anzug zuzulegen, wo er doch die ganze Zeit schon weiße Schuhe trug. Der weiße Anzug war für ihn wie eine weißer Mercedes mit weißem Lenkrad. Einmal aber war es beinahe vorbei mit seinem Geschäft. Ein Zuhälter aus dem Nachbarort hatte es auf seine Puppen abgesehen. Denn mit der Zeit wurde die eine oder andere Puppe angegriffen, attackiert von fremden Fingern mit fremden Nadeln. Und es wurde immer schwerer für Joschy, das seinen Kunden klar zu machen. Sie blieben mit der Zeit weg. Joschy wusste aber, dass sie niemals echte Haut vorziehen würden. – Joschy war der beste Psychologe der Umgebung. Er hat Menschen immer schon gerne beobachtet. Und manchmal konnte er sich nicht vorstellen, dass den Anderen es anders erging. Das, was man sagte, war doch in den meisten Fällen, das Uninteressanteste und Unwichtigste. Doch nur zwischen den Wörtern eitert so was wie Wahrheit heraus. Doch nur in Blicken oder im Schweigen fühlt man sich ertappt. Doch nur da, und sonst nirgendwo. Und er hatte recht. Mit der Zeit kamen alle seine Freier wieder zurück. Da halfen keine Nadelstiche. Irgendwann fuhr Joschy mit Evelyn in ein Geschäft, stellte sie ohne Helm als seine Evelyn vor und bat den Verkäufer mit ausgestreckter Hand diese herrliche Harley Davidson an seinen besten Freund Klaus zu verschicken: mit besten Grüßen von J. und E. – nach 20 Jahren! Der weiße Anzug war zwar etwas verwaschen, und Evelyn brauchte schon seit langer Zeit nicht mehr zu arbeiten. Joschy hat es ihr aber nie verboten. Im Gegenteil. Er mochte die Vorstellung, dass sie von einem anderen begehrt und manchmal sogar berührt würde. Und er hat lange Zeit gebraucht, um es ihr zu sagen. So wie manche Menschen nie die Zeit dafür finden, sich der Wahrheit zu stellen, sagte er Klaus einmal nach einem Fußballspiel. Joschy konnte zwar mit diesem Spiel nichts anfangen. Er ist aber Klaus’ zuliebe hin und wieder mit ins Stadion gefahren. Ganovenehre, dachte er dann immer, und sah Klaus an und musste denken, dass der auch Ganovenehre dachte, und Joschy fühlte sich mitten unter den vielen Menschen nicht allein gelassen. Was Gedanken und Gefühle alles anrichten können, dachte er dann und freute sich mit, wenn Klaus das erste Tor seiner Elf bejubelte.
Die beiden, Joschy und Evelyn also, waren verliebt wie an dem Tag, als Klaus sieben Minuten nach halb neun mit ihr um die Ecke bog, von der Kirchenuhr war fast noch der Nachklang der Glocke zu hören, die sich zwei Mal meldet, wenn es halb ist, und Joschy nie wieder in seinem Leben das Gefühl los wurde, das er seit damals hatte, als er zum ersten Mal die Uhr für um halb schlagen hörte, es hatte so etwas Beruhigendes, noch eine halbe Stunde bis zur vollen Zeit, noch so viel vor einem, noch so viel Leben und Unerzähltes und so viel Hoffnung, als hätte ein Flugzeug niemals vor zu landen.
Willi van Hengel, 1963, arbeitet als Lektor im Deutschen Bundestag. 2006 veröffentlichte er „Lucile“, seinen ersten Roman, 2008 der Roman „Morbus vitalis“ und 2010 der Gedichtband „Wunderblöcke“, 2018 sein erstes Theaterstück „de Janeiro – ein Punk ertrinkt in Weißensee“, 2021 das Theaterstück „flanzendörfer“ und 2022 der Roman „Dieudedet oder sowas wie eine Schneeflocke“. Der Roman „Entstellung des Gesichts“ wird im März 2025 im Verlag kul-ja-publishing erscheinen.







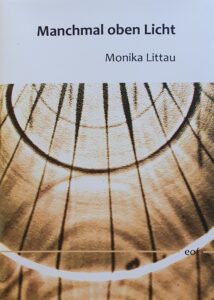









 Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg.
Ihr Roman »Die Schüchternheit der Pflaume« (FVA 2012) war für den »aspekte«-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt des ZDF nominiert. Im Herbst 2016 erschien ihr Roman »
Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg.
Ihr Roman »Die Schüchternheit der Pflaume« (FVA 2012) war für den »aspekte«-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt des ZDF nominiert. Im Herbst 2016 erschien ihr Roman »
 Arno Dahmer wurde 1973 in Frankfurt am Main geboren. Heute lebt er in Mainz. Er studierte Germanistik, war danach u. a. journalistisch tätig und arbeitet zurzeit als Lehrbeauftragter an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er veröffentlichte kurze Prosa in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie den Erzählband Manchmal eine Stunde, da bist Du (Mirabilis, Klipphausen/Miltitz, 2017). Arno Dahmer nahm an der von Kurt Drawert geleiteten Darmstädter Textwerkstatt teil und erhielt für seine literarische Arbeit einige Stipendien sowie einen Sonderpreis beim Uslarer Literaturpreis. Bei kul-ja! publishing erschien im März 2023 sein Roman «Ein Mythos von mir». Aktuell arbeitet Arno Dahmer an seinem neuen Roman, der voraussichtlich 2026 bei kul-ja! publishing erscheint.
Arno Dahmer wurde 1973 in Frankfurt am Main geboren. Heute lebt er in Mainz. Er studierte Germanistik, war danach u. a. journalistisch tätig und arbeitet zurzeit als Lehrbeauftragter an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er veröffentlichte kurze Prosa in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie den Erzählband Manchmal eine Stunde, da bist Du (Mirabilis, Klipphausen/Miltitz, 2017). Arno Dahmer nahm an der von Kurt Drawert geleiteten Darmstädter Textwerkstatt teil und erhielt für seine literarische Arbeit einige Stipendien sowie einen Sonderpreis beim Uslarer Literaturpreis. Bei kul-ja! publishing erschien im März 2023 sein Roman «Ein Mythos von mir». Aktuell arbeitet Arno Dahmer an seinem neuen Roman, der voraussichtlich 2026 bei kul-ja! publishing erscheint.