In der Liebe liegt nicht unbedingt die Rettung, aber mit Sicherheit Leidenschaft. Will liebt Phoebe. Sie lernen sich auf einem us-amerikanischen Campus kennen. Sie aus gutem Haus, er ein mittelloser Stipendiat. Aber Phoebe entgleitet ihm in den Bann einer Sekte, einer kleinen radikalen Gruppe, die auch vor Extremismus und Gewalt nicht zurückschreckt.
Dass dieser Roman in den Staaten zu einem Bestseller geworden ist, erstaunt nicht. Die junge Autorin sticht mit ihrem Buch in eine stetig wachsende Eiterbeule, die sich in einer immer radikaler werdenden Gesellschaft in den verschiedensten Färbungen ausbreiten kann. Meinungen werden zu Wahrheiten erklärt, das Fremde zur Bedrohung, Toleranz zu Schwäche und Gewalt zur Selbstverteidigung. Nicht das Radikalisierung ein us-amerikanisches Phänomen wäre, aber wenn gesellschaftliche Veränderungen in den USA zum Modell dessen werden, worauf sich Europa vorzubereiten hat, dann lohnt sich die Lektüre eines Buches wie «Die Brandstifter» erst recht.
Schon das erste kurze Kapitel, in dem aus der Sicht von Will erzählt wird, lässt keinen Zweifel daran, dass eine Katastrophe geschehen ist, eine Explosion. Am einen Ort steigt Rauch aus, Menschen sterben und wahrscheinlich sitzen auf einem Dach in Sichtweite andere und lassen Weingläser klirren, stossen an auf das, was Bomben ins Rollen bringen sollen. «Die Brandstifter» ist ein Erklärungsversuch eines mehrfach Zurückgelassenen, eines Mannes, der zu verstehen versucht, aber nicht kann, der die Zündschnur hat brennen sehen, aber nicht in der Lage war, die Lunte zu löschen.
Will lernt Phoebe an der prestigeträchtigen Edwards University kennen. Er schaffte es nur mit einem Stipendium an diese Uni und muss seinen Lebensunterhalt mit Jobs finanzieren, mal im Service eines Gourmettempels, mal als Assistent an der  Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte.
Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte.
Das alleine wäre Stoff genug für einen Roman. Aber R.O. Kwon will mehr. Phoebe lernt in dieser Phase grösster Verunsicherung, eine Verunsicherung, die durch die bedingungslose Liebe Wills nicht leichter geworden ist, den schon etwas älteren John Leal kennen, einen Mann mit Charisma und Mission. Ein Mann, der allerhand vorgibt; er habe einst Priester werden wollen, habe Nordkoreanern von China aus zur Flucht verholfen, sei gefangen genommen worden, hätte in Lebensgefahr fliehen können. John Leal sammelt eine kleine Gruppe Suchender um sich, die sich mehr und mehr von der Mitwelt abkoppeln, bis zur Selbstkasteiung geisseln und in einer kleinen Hütte im Nirgendwo Anlauf nehmen für diese eine finale Aktion, die das Übel mit einem lauten Knall ausbrennen soll.
Will muss zusehen. «Die Brandstifter» ist die Geschichte eines Zurückgelassenen, von einem, der die drohende Katastrophe sieht, aber unfähig ist, ihr entgegenzuschreiten, auf die brennende Lunte zu stehen. Eines jungen Mannes, der die Liebe gewinnt und gleichzeitig verliert, der mit jeder Umarmung den Kontakt mehr und mehr verliert, bis er nicht einmal mehr sicher ist, ob es Phoebe überhaupt noch gibt. Ein wichtiges Buch, ehrlich geschrieben, ohne amerikanischen Pathos, aber mit ergreifender Unmittelbarkeit.
 R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.
R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.
Die Übersetzerin Anke Burger studierte Amerikanistik, Germanistik und Publizistik in Heidelberg, an der Freien Universität Berlin und der University of Texas in Austin. Sie schloss ihr Studium 1994 mit einem M. A. ab und siedelte dann nach San Francisco über, wo sie über sieben Jahre lang zu Hause war. 2003 wurde sie mit dem Wieland-Übersetzerpreis ausgezeichnet.
R.O. Kwon liest am 18. September in Zürich!
Beitragsbild © Smeeta Mahanti



 Das Phänomen des sich Entziehens, Kinder um jeden Preis vor allem schützen zu wollen, ist aber beileibe kein japanisches. Medienberichte von Eltern, die ihre Kinder unter Verschluss halten, von mehr oder weniger misshandeln oder verwahrlosenKindern gibt es zuhauf. Yoko Ogawa geht es aber weder um ein Verbrechen, noch um die verstiegene Mutterliebe einer vom Wahn Getriebenen. „Augenblicke in Bernstein“ konzentriert sich auf die Geschwister im begrenzten Kosmos eines grossen Hauses mit umschlossenem Garten. Die drei Kinder sind nicht unglücklich, arrangieren sich mit ihrem Sein, nehmen Teil an der Welt im Kleinen, lernen aus den Enzyklopädien ihres Vaters und lieben sogar ihre Mutter, von der sie glauben, sie würde sie schützen.
Das Phänomen des sich Entziehens, Kinder um jeden Preis vor allem schützen zu wollen, ist aber beileibe kein japanisches. Medienberichte von Eltern, die ihre Kinder unter Verschluss halten, von mehr oder weniger misshandeln oder verwahrlosenKindern gibt es zuhauf. Yoko Ogawa geht es aber weder um ein Verbrechen, noch um die verstiegene Mutterliebe einer vom Wahn Getriebenen. „Augenblicke in Bernstein“ konzentriert sich auf die Geschwister im begrenzten Kosmos eines grossen Hauses mit umschlossenem Garten. Die drei Kinder sind nicht unglücklich, arrangieren sich mit ihrem Sein, nehmen Teil an der Welt im Kleinen, lernen aus den Enzyklopädien ihres Vaters und lieben sogar ihre Mutter, von der sie glauben, sie würde sie schützen. Yoko Ogawa (1962) gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo.
Yoko Ogawa (1962) gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo.
 Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken.
Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken. Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.
Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.
 jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen.
jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen. Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.
Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.
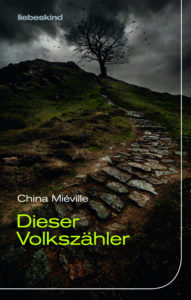 Sohn hoch über dem Brückendorf weit ab in einem Haus am Hang. Man sucht den Schlüsselmacher auf, bittet um ganz spezielle Schlüssel, die der Handwerker in seiner Werkstatt im Erdgeschoss seines Hauses fertigt. Schlüssel, die nicht unbedingt Türen öffnen sollen. «Seine Kunden kamen aus dem Dorf zu ihm hinauf und baten um Dinge, um die Menschen üblicherweise bitten; um Liebe, Geld, darum, etwas zu öffnen, die Zukunft zu erfahren, Tiere zu heilen, Sachen zu reparieren, stärker zu werden, jemanden zu verletzen oder zu retten, zu fliegen -, und er machte ihnen einen Schlüssel dafür.»
Sohn hoch über dem Brückendorf weit ab in einem Haus am Hang. Man sucht den Schlüsselmacher auf, bittet um ganz spezielle Schlüssel, die der Handwerker in seiner Werkstatt im Erdgeschoss seines Hauses fertigt. Schlüssel, die nicht unbedingt Türen öffnen sollen. «Seine Kunden kamen aus dem Dorf zu ihm hinauf und baten um Dinge, um die Menschen üblicherweise bitten; um Liebe, Geld, darum, etwas zu öffnen, die Zukunft zu erfahren, Tiere zu heilen, Sachen zu reparieren, stärker zu werden, jemanden zu verletzen oder zu retten, zu fliegen -, und er machte ihnen einen Schlüssel dafür.» China Miéville, 1972 in Norwich geboren, gilt als einer der wichtigsten Autoren der zeitgenössischen Fantastik. Er studierte Sozialanthropologie in Cambridge und Politikwissenschaft an der London School of Economics. Sein Debütroman «König Ratte» erschien 1998. Für seinen Roman «Perdido Street Station» erhielt er 2001 den Arthur C. Clarke Award sowie den British Fantasy Award. Mit seinem Roman «Die Stadt & Die Stadt» gewann er 2010 neben dem Arthur C. Clarke Award auch den Hugo Award und den World Fantasy Award. In Deutschland wurde er drei Mal mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. China Miéville kandidierte 2001 für die Internationale Sozialistische Allianz bei den britischen Unterhauswahlen, bis 2013 war er aktives Mitglied der Socialist Workers Party. Er lebt und arbeitet in London.
China Miéville, 1972 in Norwich geboren, gilt als einer der wichtigsten Autoren der zeitgenössischen Fantastik. Er studierte Sozialanthropologie in Cambridge und Politikwissenschaft an der London School of Economics. Sein Debütroman «König Ratte» erschien 1998. Für seinen Roman «Perdido Street Station» erhielt er 2001 den Arthur C. Clarke Award sowie den British Fantasy Award. Mit seinem Roman «Die Stadt & Die Stadt» gewann er 2010 neben dem Arthur C. Clarke Award auch den Hugo Award und den World Fantasy Award. In Deutschland wurde er drei Mal mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. China Miéville kandidierte 2001 für die Internationale Sozialistische Allianz bei den britischen Unterhauswahlen, bis 2013 war er aktives Mitglied der Socialist Workers Party. Er lebt und arbeitet in London.