Auch die letzten noch intakten Gegenden unseres Planeten drohen im Sog wirtschaftlicher Interessen zu kippen. Am „Ende der Welt“ forscht eine kleine Gruppe, ob mit dem Einsatz künstlicher Stoffe den Veränderungen von Klimawandel und Wirtschaftinteressen entgegnet werden kann. Der Debütroman von Sophia Klink ist ein Sprachkunstwerk – für einmal etwas, das der Welt nur gut tun kann!
Der Kurilensee, ein riesiger Kratersee, 77 km2 gross, liegt ganz im Süden der dünn besiedelten Halbinsel Kamtschatka, auf russischem Staatsgebiet, aber 6773 Kilometer von der Hauptstadt Moskau entfernt. Wenn es also einen Ort gibt, der weit ab vom Schuss ist, und normalerweise nur mit Helikopter erreichbar, dann der Kurilensse, an dem eine Forschungsstation liegt, in der eine kleine internationale Crew sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt, vor allem darum, weil der See wirtschaftlich eine grosse Bedeutung für die Lachsfischerei hat, einem Wirtschaftszweig, der mehr und mehr in Bedrängnis kommt, weil natürliche Lachspopulationen rückgängig sind, der Überfischung ausgesetzt und die Tiere empfindlichst gestresst auf die Einwirkungen des Menschen reagieren. Ein kleiner, von einem Zaun gegen Bären geschützer Ort, an dem die Protagonistin Anna das drohende Ungleichgewicht zwischen Lachsen und Phytoplankton, zum Beispiel Kieselalgen, untersucht, Lachsfische vor der Laichablage zählt und Teil einer Equipe von Wissenschaftler*innen und Rangern ist. Zur Gruppe gehört Vowa, ein Ranger, der jeden Bären an seinem Fell zu kennen scheint, mit dem Anna schon im sechsten Jahr den Sommer über in der Forschungsstation lebt.
Anna und Vowa sind ein Paar, was für die anderen in der Station längst kein Geheimnis mehr ist. So wie wenig ein Geheimnis bleibt an einem Ort, von dem man ohne Gewehr, Boot oder Hubschrauber kaum weiter weg kommt. Jeder in der Station hat seine fixe Aufgabe und als Ganzes hat man in diesem Sommer die Aufgabe, wissenschaftliche Grundlagen dafür zu schaffen, ob man mit einer Phosphatdüngung das aus dem Gleichgewicht kippende Ökosystems des Lachssees aufhalten kann, oder ob der Einsatz von 5 Tonnen künstlicher Düngung nicht der Anfang vom Ende ist, ein nicht wieder gut zu machender Eingriff mit nicht vorhersehbaren Konsequenzen. Die Crew auf der Station ist nicht nur auf den Lebensmittel- und Materialnachschub per Helikopter angewiesen, sondern auch auf die finanziellen Mittel derer, die daran interessiert sind, dass wirtschaftliche Interessen wissenschaftlich abgestützt sind.
Wir könnten einfach alle Daten auflisten und ganz ehrlich eingestehen, dass wir keine Ahnung haben, was das Beste für den Kurilskoye ist.
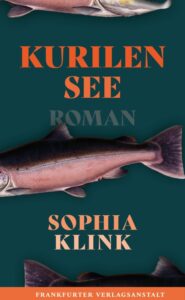
Anna ist nicht nur fasziniert von der Artenvielfalt in und um den See, sie ist auch erfüllt von ihrer Arbeit, sieht in den Kleinstlebewesen im See nicht nur einen Forschungsgegenstand, sondern eine Spiegelung der Natur, ihrer Schönheit, ihrer Vollendung als Teil der Evolution. Aber so wie das ökologische Gleichgewicht dieses Sees weitab von der Zivilisation bedroht ist, so bedroht ist die Station selbst. Nicht nur weil jeder Winter an den Bauten nagt, Bären sich immer wieder einmal an den Einrichtungen zu schaffen machen und auch den Bewohnern bedrohlich nahe kommen können, sondern weil man der Station auch ganz leicht über die Finanzen die Nabelschnur zur Zivilisation kappen kann. Eine permanente Ungewissheit, die zusammen mit der zu treffenden Entscheidung wegen der Düngung mehr und mehr zu einer Belastung wird. Trifft man die richtigen Entscheidungen? Wohin führt Annas Weg? Wohin soll es gehen mit Anna und Vowa? Als Anna spürt, dass auch ihre Gesundheit Kapriolen schlägt, weitet sie ihre Untersuchung aus auf den eigenen Körper, misst die Temperatur. Ist sie schwanger, obwohl die beiden mit Gummi verhüten?
Werfe nie einen gestressten Fisch zurück ins Wasser, sagt Vowa.
Alles an diesem menschenfeindlich scheinenden Ort schreit nach einer Entscheidung, bevor die Crew die Station im September für den Winter wieder verlassen wird. Was an Sophia Klinks Debüt fasziniert, ist aber weit mehr als die Geschichte und die Psychologie unter Wisschenschaftler*innen und Rangern. Sophia Klink hängt die Spannung auch an keinen Showdown, kein Psychodrama auf der Forschungsanlage. Absolut faszinierend ist der Blick der Autorin auf die Natur, ihr Tun, auf die Zusammenhänge, die mir als Leser über weite Strecken verborgen bleiben. Sophia Klink ist nicht einfach Schriftstellerin, die sich mit sorgfältiger Recherchearbeit das nötige Wissen holte, um einen „Ökoroman“ zu schreiben. Sophia Klink ist promovierte Biologin und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen in einer Sprache, die ihre Liebe, ihre Faszination und ihre Ehrfurcht vor der Natur und ihren Zusammenhängen widerspiegelt. Und weil Sophia Klink „nebenbei“ auch noch preisgekrönte Lyrikerin ist, wird ihre Sprache zu einem magischen Instrument, schillernd, ohne abgehoben zu wirken, schön wie Kieselalgen selbst.
„Kurilensse“ ist ein Roman wie der grosse, weite See selbst; tief und voller Zauber!
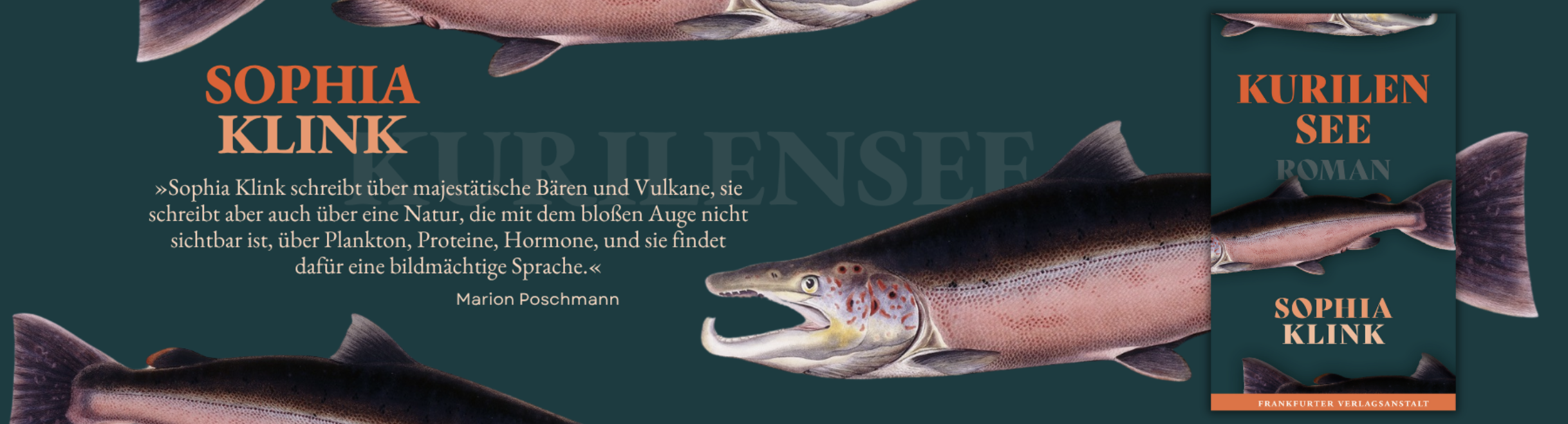
Interview
Was für ein Roman! Ich bin hell begeistert! Habe das Gefühl, einem Unikat begegnet zu sein. Ein Unikat darum, weil sie in ihrer ganz eigenen Sprache ihrem Stoff begegnen, aus Sicht einer Wissenschaftlerin literarisch schreiben. Was sie wissenschaftlich vermitteln, bleibt selbst für Laien wie mich verständlich. Gekoppelt mit ihrer Begeisterung in ihrer Sicht auf die Schönheit der Natur und ihrem sprachlichen Können werden aus ganzen Abschnitten literarische „Nahaufnahmen“, Stilleben ganz eigener Art. Wissenschaftliches Schreiben klingt sonst so ganz anders, eine eigene, analytische Sprache. Inwieweit half ihnen bei der Findung einer eigenen Sprache ihr lyrisches Gespür?
Das war ein längerer Prozess über viele Texte hinweg. Ich schreibe ja seit Jahren literarisch über Natur und Wissenschaft und habe viel herumexperimentiert, welche sprachliche Form zu welchem Inhalt passt. Dem Klang nachzuspüren, ist mir dabei sehr wichtig. In der naturwissenschaftlichen Sprache liegt schon an sich so viel poetisches Potential. Es erzeugt aber auch eine Reibung, die ich ästhetisch spannend finde. Diesen Kontrast herauszuarbeiten, hat mich in diesem Roman besonders interessiert. Als ich angefangen habe zu schreiben, hat sich die Sprache dann schönerweise wie von selbst eingestellt. Da musste ich gar nicht mehr lange suchen. Die Sprache stellte sich einfach ein.
Wie leicht wäre es gewesen, die Story dramatisch aufzublasen; noch mehr Countdown in die Handlung, eine dramatische Liebesgeschichte oder ein fatales Psychospiel in einer abgelegenen Forschungsstation. Aber darum ging es ihnen nicht. Es ging ihnen nicht einmal darum, einen „Ökoroman“ zu schreiben, auch wenn es doch einer ist. Aus ihrem ganzen Roman spricht der Respekt, die Ehrfurcht und die Sorge um eine Welt, die durch die Eingriffe des Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Die Liebe zu ihrer Arbeit, sowohl als Biologin, als Wissenschaftlerin wie auch als Sprachgestalterin, als Künstlerin. Was stand zu Beginn ihres Schreibens an diesem Roman? Waren es Verarbeitungen eines eigenen Forschungseinsatzes? Und wie weit mussten sie sich als Wissenschaftlerin zügeln?
Inspiriert haben mich auf jeden Fall meine eigenen Forschungserlebnisse. Im Masterstudium bin ich auf einer meeresbiologischen Station im nordwestlichen Russland gewesen und wusste schon damals, dass ich über diesen Ort schreiben muss. Mich hat beim Schreiben eine Sehnsucht angetrieben und die Trauer darüber, dass es diese unberührte Wildnis irgendwann nicht mehr geben wird. Dass ich auf den Kurilensee gestossen bin, war ein Glücksfall. Dadurch konnte ich viel übertragen, ohne meine eigenen Erinnerungen überschreiben zu müssen. Und natürlich war ich neugierig auf dieses andere Ökosystem, das mir gleichzeitig fremd und bekannt vorkam. Zügeln musste ich mich als Wissenschaftlerin dabei gar nicht so sehr. Es gibt so viele Details über Kieselalgen, Lachse und den menschlichen Körper, die ich liebend gerne im Roman angesprochen hätte. Aber natürlich versuche ich beim Recherchieren jenen Informationen nachzuspüren, die sich mit den Gefühlen meiner Protagonistin Anna verknüpfen lassen. Für mich sind es doch zwei sehr unterschiedliche Modi, Informationen für ein Paper konzise darzustellen oder sie auf eine Emotion hin zu befragen. Allein aus Fakten lässt sich keine Geschichte entwickeln. Zellen und Moleküle müssen auch erst mal so beschrieben werden, dass man sie sich vorstellen kann. Das geht in vielen Fällen einfach nicht auf. Ich freue mich eher, wie viele Proteine, Wasserstoffbrückenbindungen und Dinoflagellaten es am Ende doch in den Roman geschafft haben.
Man kann den Kurilensee sehr gut auch als Metapher für das globale Gleichgewicht sehen. Ist Literatur so etwas wie die verbliebene Hoffnung angesichts der im düster werdenden Prognosen?
Ich hoffe schon, dass Literatur einen kleinen Anstoss geben kann. Wo sollen wir anfangen, eine bessere Welt zu imaginieren, wenn nicht in der Sprache? Ich verstehe die Literatur als Mittel, immer wieder unsere Perspektive zu verschieben und uns emotional für andere Lebenswirklichkeiten zu öffnen. Auch mal den Blick auf winzige Kieselalgen und unsichtbare Stoffwechselprozesse zu richten, die wir sonst nicht wahrnehmen. Ich finde, dass Literatur da nachhaltig unseren Blick auf die Welt verändern kann. Geschichten haben eben eine ganz andere Kraft als Zahlen. Und sie können trösten, wenn die Prognosen immer düsterer werden.
Ich habe mir im Netz Bilder und Illustrationen von Kieselalgen angesehen und bin restlos fasziniert, sei es von ihrer Geometrie, ihrer Körperlichkeit, sei es von ihrer Aufgabe, ihrem Dasein. Es ist der faszinierte Blick in die Kleinheit, der auf das Grosse überschlägt. Ihre Begeisterung, die in ihren Beschreibungen lesbar wird, ist pure Verzückung. Auf der andern Seite der Schmerz darüber, dass Profitgier und kurzfristiges Denken so viel Zerstörung mit sich ziehen. Sie moralisieren in ihrem Roman nicht. Anna hat die Hoffnung nicht verloren. „Kurilensee“ ist auch eine Liebesgeschichte. Eine ganz zarte. Auch eine Liebesgeschichte an die Natur, ihre Arbeit als Wissenschaftlerin, an die Sprache. Wo holen sie den Dünger, um ihre Hoffnung nicht sterben zu sehen?
Vielleicht ist die Wissenschaft auch hier ein wichtiger Anker für mich. Wenn ich mich mit Kieselalgen, Pilzen und Bakterien beschäftige, verliert die winzige Gruppe der Trockennasenprimaten ganz schnell an Bedeutung. Mir diese Dimensionen immer wieder vorzustellen, was wir alles nicht verstehen oder kontrollieren können, daraus ziehe ich persönlich viel Zuversicht. Dass es Lebensformen gibt, die unsere Zerstörungswut überdauern werden. Der Ohnmacht zu verfallen, hilft auch einfach nicht. Anna entscheidet sich schliesslich auch dafür, an das Schöne zu glauben und in eine neue Generation zu investieren, der man diese Liebe mitgeben muss, um die Zukunft besser zu machen.
Nicht vor den Bären oder dunklen Nächten habe ich Angst, sondern vor den Menschen, die glauben, alles unter Kontrolle zu haben, schreiben sie in „Kurilensee“. Das gilt überall, auch in der Politik, denken wir nur an all die Männer, die der Überzeugung sind, ihre Macht mit Kriegen demonstrieren zu müssen. Hat nicht die Spezies Mensch versagt, weil sie den Profit über die Empathie stellt? Sie moralisieren nicht, zumindest spüre ich das nicht. Wie sehr mussten sie sich davor hüten?
Mir ist wichtig, dass die Moral meiner Texte subtil mitschwingt. Meine Kritik an Überfischung, Geldgier und blindem Anthropozentrismus wird hoffentlich auch so deutlich. Es hat sich richtig angefühlt, gerade die Ambivalenzen in der Schwebe zu halten und auch zu zeigen, wie Anna letztendlich bei der Manipulation des Sees dabei ist. Bis zum Schluss weisss sie eben nicht, was richtig oder falsch ist. Aber sie will sich nicht ihrer Verantwortung entziehen, sondern sich der ganzen Tragweite ihres Verhaltens bewusst sein und genau hinsehen.

Sophia Klink, geb. 1993 in München, hat Biologie studiert und promoviert zurzeit über die Symbiose zwischen Bakterien und Pflanzen. Sie wurde mit dem Literaturstipendium München und dem Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis beim Literarischen März ausgezeichnet und mit Stipendien des British Council und der Stiftung Kunst und Natur gefördert. Sie war Finalistin beim open mike, Aufenthaltsstipendiatin der Roger Willemsen Stiftung, des Adalbert Stifter Vereins und der Villa Sarkia in Finnland. Im Frühjahr 2025 erschien ihr Lyrikdebüt bei hochroth München. Durch einen Forschungsaufenthalt am Weissen Meer in Russland zu ihrem Roman »Kurilensee« inspiriert, stand sie mit einem Auszug daraus auf der Shortlist des W.-G.-Sebald-Preises.
Beitragsbild © Heike Bogenberger


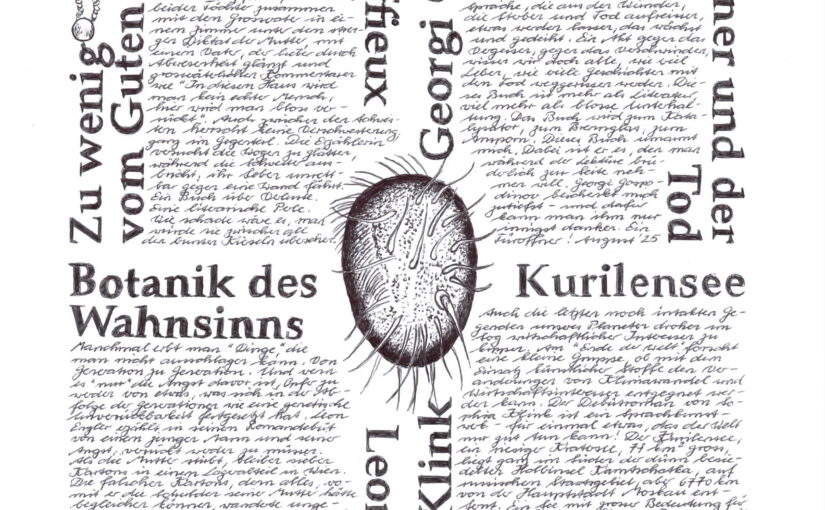
 Kontoangaben:
Kontoangaben: