Stoffe finden ist die einfachste Sache der Welt. Sie liegen überall herum. Sie lächeln einem aus der Zeitung entgegen. Sie flimmern über Bildschirme. Stoffe wollen gefunden werden. Ich habe keine Ahnung, weshalb sich das Märchen von den Stoffen, die sich in den hintersten und letzten Winkel verstecken, so hartnäckig hält.
Natürlich ist es immer der Schriftsteller, der den Stoff finden muss. Stoffe finden keine Schriftsteller. Das liegt daran, dass sich Schriftsteller in der Öffentlichkeit gerne unauffällig benehmen, durch die Strassen gehen, wie normale Menschen, einkaufen, was alle kaufen, lesen, was alle lesen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Stoff. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich so hübsch wie möglich zu präsentieren, damit ein vorbeigehender Schriftsteller auf Sie aufmerksam wird. Denn woher wollen Sie wissen, wer von den Vorbeigehenden ein Schriftsteller ist.
Stoffe finden ist kein Problem. Viel schwieriger ist der Umgang mit einem Stoff. Haben Sie einen Stoff für gut befunden und mit nach Hause genommen, bildet er sich schnell etwas darauf ein. Stoffe sind ganz schön eitel und alles andere als pflegeleicht. Der grösste Fehler, den Sie machen können, ist, dem Stoff alles zu geben, was er will. Gehen Sie von Anfang an intensiv auf den Stoff ein, verwandelt sich der gleiche Stoff, den sie eben noch in einem schmutzigen Hinterhof zwischen Abfalleimern gefunden haben, in ein grössenwahnsinniges Ungetüm, weil er sich für unersetzlich hält. Das Wesen des Stoffes neigt zum Grössenwahn. Das muss man leider sagen. Arbeiten Sie also nie mit nur einem Stoff. Nehmen Sie von verschiedenen Stoffen, so viel Sie brauchen, aber nie von einem einzigen so viel, dass Sie ohne ihn nicht mehr auskommen. Das spürt ein Stoff sofort. Und ist es erst so weit, macht er Ihnen die Arbeit zur Hölle. Er geht Ihnen nicht mehr aus dem Sinn. Er bestimmt Ihre Gedanken und Handlungen. Er führt Sie an Orte, wo Sie nie im Leben hin wollten.
Ein Schriftsteller darf die Kontrolle über seinen Stoff nicht verlieren, weil sich der Stoff ansonsten entfaltet, wie es ihm passt und nicht wie es der Schriftsteller vorgesehen hat. Und Stoffe sind keine guten Erzähler, das kann ich Ihnen versichern, dazu sie sind viel zu selbstsüchtig.
Mindestens ebenso wichtig, wie der richtige Umgang mit einem Stoff, ist es für den Schriftsteller, die richtigen Stoffe auszusuchen. Die Stoffe, die zu ihm passen. Was selbstverständlich und banal daherkommt, ist alles andere als eine einfache Angelegenheit. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts lässt sich ein exponential ansteigendes Stoffwachstum beobachten. Von Schriftstellerverbänden anfangs begrüsst, werden schon seit einigen Jahren kritische Stimmen laut, die sich gegen den unkontrollierten Stoffwachstum erheben. Die Stoffe haben im ständigen Konkurrenzkampf mit ihresgleichen inzwischen derart geschickte Strategien der Tarnung und Täuschung entwickelt, dass selbst gestandene Schriftsteller nicht davor gefeit sind, daneben zu greifen und einen oberflächlichen Stoff, der sich nur geschickt genug verkleidet, für einen Jahrhundertstoff zu halten. Gerade jungen Schriftstellern sei es deshalb ans Herz gelegt, sich nicht von vermeintlich grossen Stoffen blenden zu lassen, sondern sich kleine, feine Stoffe auszusuchen, mit denen sie umgehen können.
 Lorenz Langenegger lebt und schreibt in Zürich und Wien. Davor einige Semester Theater- und Politikwissenschaft an der Universität Bern. Mitglied der Autören. Verschiedene Arbeiten fürs Theater mit Uraufführungen in Zürich, Mannheim und Berlin. Bei Jung und Jung in Salzburg erscheint im Frühjahr 2009 der erste Roman «Hier im Regen». 2014 erschien «Bei 30 Grad im Schatten» und 2019 der Roman «Jahr ohne Winter.
Lorenz Langenegger lebt und schreibt in Zürich und Wien. Davor einige Semester Theater- und Politikwissenschaft an der Universität Bern. Mitglied der Autören. Verschiedene Arbeiten fürs Theater mit Uraufführungen in Zürich, Mannheim und Berlin. Bei Jung und Jung in Salzburg erscheint im Frühjahr 2009 der erste Roman «Hier im Regen». 2014 erschien «Bei 30 Grad im Schatten» und 2019 der Roman «Jahr ohne Winter.
Beitragsbild © Richard Obermayr



 So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.
So herausfordern und beglückend für den Veranstalter, so schwierig für die Erwartete. Namen wie Herta Müller mobilisieren BesucherInnen, die sonst kaum zu locken sind. Und ist die Lesung vorüber, zieht Ruhe und Beschaulichkeit ein. Dabei verbergen sich hinter den Namen jener, die ohne Spektakel die Bühne betreten, die grossen Namen von morgen.
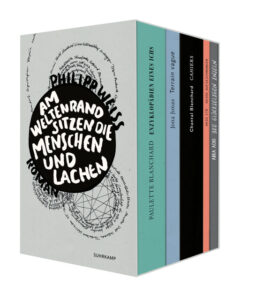 Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.
Zukunft auch anders gedacht werden als apokalyptisch? Reicht es, sich das Schlimmste vorzustellen, um für das gewappnet zu sein, was zu kommen droht? Gedanken darüber, warum der Mensch das einzige Wesen auf der Erde ist, das etwas produziert, was es nicht braucht – Müll. Darüber, dass das, was der Mensch durch sein Tun unausweichlich verändert, nicht das Leben wirklich meint, sondern bloss verändert, wenn auch letztlich nicht zu seinem Vorteil.