Willi Achten gibt den einstigen Heimkindern der Bundesrepublik Deutschland mit seinem wuchtigen Roman „Die wir liebten“ eine literarische Stimme.

Im Gnadenhof
Gastbeitrag von Frank Keil
Vorab zur Einleitung und zum besseren Verständnis: Was für die Schweiz die „Verding-Kinder“ sind, das sind für die Bundesrepublik die „Heimkinder“. Kinder und Jugendliche, die im Nachkriegsdeutschland ihrer Freiheit beraubt wurden; die in meist kirchlichen Heimen beider Konfessionen, aber auch in kommunalen Heimen untergebracht wurden. Die dort arbeiten mussten, deren Schulpflicht zuweilen ausgesetzt war und denen Kontaktmöglichkeiten zu Eltern, Verwandten oder Freunden untersagt wurden – ohne das staatliche Stellen ihrer Pflicht der Kontrolle nachgingen; ohne dass es irgendeine unabhängige Instanz gab, an die sich die Kinder und Jugendlichen hätten wenden können. Bis weit in die 1970er-Jahre ging das, als sich zugleich die bundesdeutsche Gesellschaft unter dem Einfluss der so genannten Studentenrevolte immer mehr liberalisierte. Salopp gesagt: Während in der Öffentlichkeit über antiautoritäre Erziehung debattiert wurde, wurde in den Heimen noch handfest und unhinterfragt geprügelt.
Erst als ab etwa Anfang bis Mitte der 1970er-Jahre eine neue Generation von Erziehern und Erzieherinnen in der staatlichen wie privaten Jugendhilfe auftauchte, änderten sich die Heime; viele wurden nach und nach geschlossen; neue Lebens- und Wohnformen für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familiensituationen entwickelten sich.
Und dennoch dauerte es weitere 30 Jahre, bis die Geschichte der repressiven, jahrzehntelang gültigen Heimerziehung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde und besonders die längst erwachsenen und zugleich tief traumatisierten einstigen Heimkinder gehört und dann befragt wurden. Es war interessanterweise ein Buch, das diesen Prozess einleitete: „Schläge im Namen des Herrn“ des SPIEGEL-Journalisten Peter Wensierski, 2006 (!) erschien es.
Seitdem wurde nach anfänglich erheblichen Widerständen der beiden Kirchen verschiedene Entschädigungsfonds für die einstigen Heimzöglinge aufgelegt. Seitdem gibt es auch eine tiefgehende historische Forschung – aktuell wird etwa untersucht, in wieweit an den Heimkindern nicht zugelassene Medikamente erprobt wurden und in wie weit sie wichtigen Unternehmen zuarbeiten mussten, ohne je dafür entlohnt worden zu sein. Es gibt zudem – wie bei den Verding-Kindern auch – eine Reihe von Erfahrungsberichten ehemaliger Heimkinder; Lebens- und Überlebensberichte, autobiografisch grundiert, oft in kleinen Verlagen erschienen oder in Selbstverlagen veröffentlicht.
Was aber bisher weitgehend fehlt, ist eine literarische Aufarbeitung – vergleichbar mit dem so genannten Internatsroman. Nun hat Willi Achten mit seinem Roman „Die wir liebten“ erste, wichtige Pflöcke eingeschlagen.
Und der schickt Edgar und Roman, die zwei Brüder, die Söhne des Bäckers, in die apokalyptische Heim-Welt. Die beiden Jungen kennen das Haus, vor dem sie nun stehen, zwangsweise hierher gebracht. Das Haus, das ein Heim beherbergt. Sie standen schon öfter davor; letzten Weihnachten erst, als sie den übriggebliebenen Kuchen ablieferten, eine Spende; an der Pforte hatten sie ihn abgegeben, weiter waren sie wie auch die Jahre zuvor nicht gekommen, und es war ihnen recht. Hatten dafür die Zigarre entgegengenommen, vom Heimleiter, auch wenn ihr Vater, der Bäcker, der den Kuchen spendete, der sich nicht mehr verkaufen liess, gar nicht rauchte. Aber das erzählten sie nicht, so wie sie auch nicht fragten, was das für ein Heim sei und wie es einem dort ergehe und wie man in dieses Heim komme, das „Gnadenhof“ heisst; besser nicht fragen, weil Fragen Wissen nach sich ziehen kann. Und dann – womöglich – Handeln.
Da sind wir sind Seite 253 angekommen. Alles, was wir zuvor gelesen haben, war notwendiges Vorspiel, war unverzichtbares Intro, einerseits. Ist die Vorgeschichte einer nun offen ausbrechenden Katastrophe, die notwendig zu erzählen ist, um zu verstehen, was auf den nun folgenden, etwas mehr als 100 Seiten geschieht.
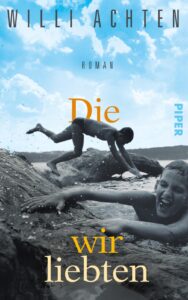
Denn sie sind anfangs eine ganz normale Familie. Im Grossen und Ganzen jedenfalls, in einem kleinen Ort, im Rheinland. Vater, Mutter, zwei Kinder. Eine Grossmutter noch dazu, ein Vetter der Grossmutter, der in der väterlichen Backstube arbeitet und hilft, dann noch die Grosstante Mia; die etwas anders ist, sehr eigen sozusagen, die für ihr Leben gern strickt, alles einstrickt, wirklich alles, sitzend unter einer Marienfigur. Die Mutter hat eine Art Kiosk, einen Lottoladen, auch sie arbeitet viel, und sie arbeitet gern. Es ist das Jahr 1971, als wir dazu kommen.
Ob es zwischen den Eltern die grosse Liebe ist, wohl eher nicht. Vielleicht war sie es mal. Vielleicht haben sich die beiden durchaus mehr erhofft, voneinander. Nun sind sie eine ganz normale, eine klassische Familie, in einer Zeit – ich erinnere das, es ist eine prägende Erinnerung –, als in den Nachrichten die Zahl der unehelichen Kinder vermeldet wurde, die stieg und stieg. Und entsprechend kommt alles ins Rutschen, als der Vater auf dem Dorffest mit der Tierärztin tanzt, zu Procul Harum, zu A Whiter Shade of Pale. Und sich dann mit ihr trifft. Und dann das erste Mal nachts nicht nach Hause kommt. Sondern woanders ist, wo er bleibt. Nicht gleich, aber bald.
Die beiden Jungs ahnen, was nun passieren wird. Auch wenn sie das Gegenteil hoffen. Und der Vater ist ja morgens da, steht in der Backstube; wann immer es möglich ist, helfen ihm die Söhne, springen ein, vielleicht kann das das Schlimmste verhindern. Und noch ist der Vater ja da, noch hören sie mit ihm gemeinsam Radio, wenn Fussball ist, bis die Ergebnisse feststehen. Über das, was geschieht, mit ihnen, im Einzelnen wie mit allen zusammen, wird nicht gesprochen. Es wird gehofft. Und das ist nicht genug; es ist bei weitem nicht genug.
Denn sie alle sind nicht allein auf der Welt. Es gibt den Dorfpolizisten, der schon vorher Dorfpolizist war und dem entsprechend eine gnadenlose Brutalität zu eigen ist. Und es gibt die Fürsorgerin, die die zerbrechende Familie nicht aus ihrem Blick lässt und die nur darauf wartet, dass sie einschreiten kann; aus eigenem Antrieb heraus wie von Amts wegen. Aber erst mal nimmt sie sich Mia vor, die zurückgebliebene Großtante, das schwächste Glied in einer sich auflösenden Kette, um die sich der Staat doch zu kümmern hat. Und dann ist es soweit und Edgar und Roman können nicht mehr entkommen.
Willi Achten erzählt das so kraftvoll wie schonungslos. Er verfügt über einen realitätssicheren und wahrhaft packenden Erzählstil, dass man zuweilen kaum weiterlesen mag, weil man das fürchtet, was auf den nächsten Seiten passieren wird und das passiert dann auch. Er holt uns in eine Welt zurück, die historisch gesehen, so lange her nicht ist und auf die oft genug nur verklärend geschaut wird, weil es damals besonders schaurige Popmusik gab und die regierenden Männer unförmige, schwarze und schwere Schuhe trugen und sich das dünne Haar mit Birkenwasser tränkten, ach, ist das lange her, so gefühlt, und was war das seltsam.
Was Willi Achten uns mit seiner eigentlich ganz klassischen Familiengeschichte dagegen nahe bringt, ist ein zuweilen fast körperlich zu fassendes Erschrecken über die eingangs kurz skizzierte Erziehungswelt der 1970er-Jahre; von prügelnden Lehrern bis nahezu allmächtigen Fürsorgerinnen, flankiert von oft hilflosen Erwachsenen, die gerade anfingen an der sich vorsichtig ausbreitenden Liberalität bei der Gestaltung von Lebensentwürfen zu erproben.
Und so ist der zweite Teil des Romans nichts geringeres als eine geradezu apokalyptische Reise in die Abgründe der westdeutschen Heimerziehung, die fast lückenlos und nahezu ungebremst, weil auch personell gestützt auf die Ideale und Abläufe der Nazizeit aufbaute und die sich jahrzehntelang ungeprüft und unhinterfragt austoben konnte, auch weil sie Gesetz war und niemand in die Speichen des sich drehenden Rades griff. Und die so spät in Frage gestellt wurde und die noch später endetet, nach der so genannten Heimkampagne kritischer Pädagogikstudenten, bei der nicht zuletzt eine gewisse Ulrike Meinhof eine nicht unwichtige Rolle spielte.
Dieser Zeit und besonders ihren Opfern hat Willi Achten mit seinem Roman ein überaus lesenswertes Dokument überlassen.
Willi Achten wuchs in einem Dorf am Niederrhein auf. Er studierte in Bonn und Köln. Seit den frühen 1990er-Jahren ist er als Schriftsteller tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Willi Achten lebt im niederländischen Vaals bei Aachen.
Beitragsfoto © Heike Lachmann / Piper Verlag



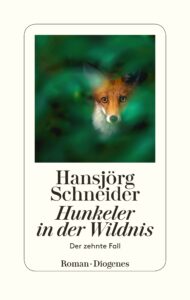
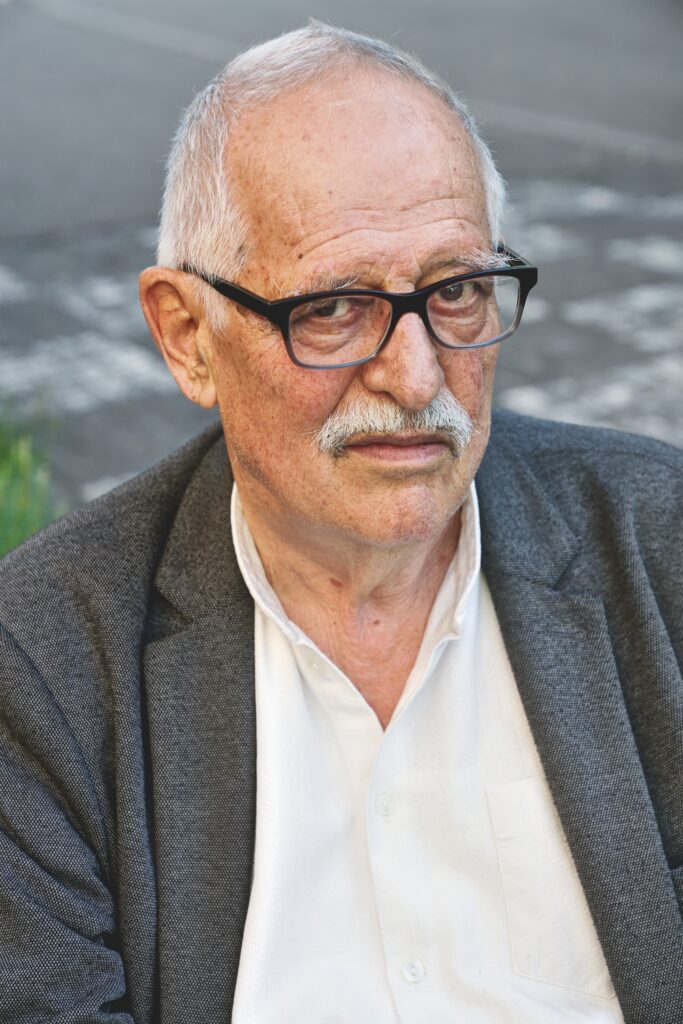

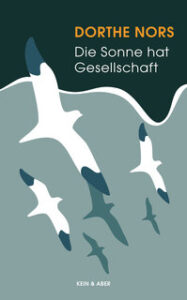
 Dorthe Nors wurde 1970 in Herning, Dänemark, geboren und studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Åarhus. Sie ist die Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Novellen. Bei Kein & Aber erschien 2016 ihr Roman «Rechts blinken, links abbiegen», der für den Man Booker International Prize nominiert wurde. Dorthe Nors lebt an der dänischen Westküste.
Dorthe Nors wurde 1970 in Herning, Dänemark, geboren und studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Åarhus. Sie ist die Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Novellen. Bei Kein & Aber erschien 2016 ihr Roman «Rechts blinken, links abbiegen», der für den Man Booker International Prize nominiert wurde. Dorthe Nors lebt an der dänischen Westküste.