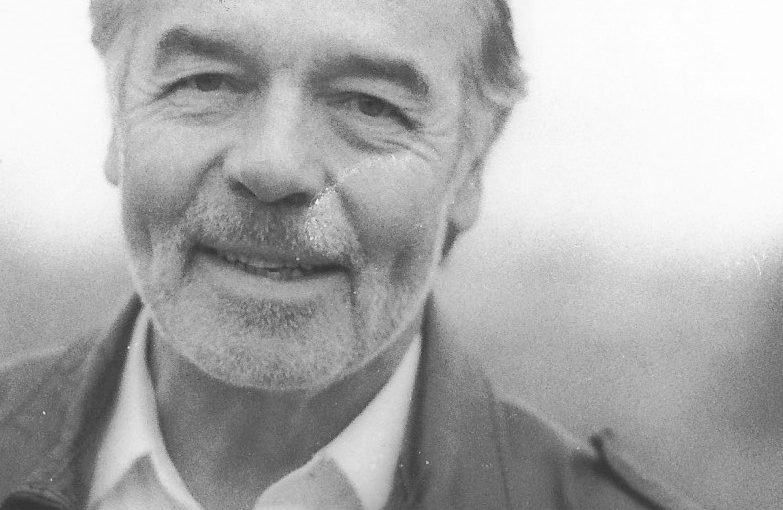Es gibt, und ich bin dankbar dafür, die unterschiedlichsten Lehrer auf dieser Welt. Oft schätzen und würdigen wir jene Lehrpersonen, denen es gelingt, uns mühelos etwas begreiflich zu machen, uns flugs zu Einsichten zu verhelfen, von denen wir zuvor nicht wussten, dass wir sie unbedingt haben wollen. Es finden sich jedoch auch Lehrer, denen es, obwohl nicht unsympathisch, nicht gelingen will, uns etwas beizubringen, die uns, nach einem staunenden, irritierten Zuhören, ratlos zurücklassen. Ich mag diese zweitgenannten Lehrkräfte eigentlich ganz gut, auch weil uns die Dinge, von denen sie erzählen, oft lange noch zärtlich hörbar durch die zelebralen Gänge kriechen.
Neulich bin ich einem Lehrer dieser Art begegnet; er stand, glänzend vor Stolz, vor der Landwirtschaftlichen Genossenschaft. Dieser Lehrer war ein Auto, ein frisch poliertes, auffallend bulliges Modell, wie es in den USA gerne gefahren wird; auf seiner Seitentür waren liebevoll verziert zwei Worte aufgedruckt, die ich gleich ein paar Mal lesen musste: Urban Cowboy.
Diese Worte, das ganze Auto, sein stolzgeblähtes Dastehen vor der mitten im Dorf sich befindenden Landwirtschaftlichen Genossenschaft – ich war paralysiert. Insbesondere das Urban Cowboy gab mir unverzüglich Hausaufgaben mit, die zu lösen ich bis heute beschäftigt bin.
Womöglich, das muss erwähnt sein, hängen das Auto und das Dorf, in dem es geparkt steht, kausal zusammen. Denn Pfaffwil, so das Dorf, gelegen auf knapp 700 Metern über Meer, hockt am Ende einer kleinen Talschaft wie ein beleidigter Erstklässler in der Ecke des Schulhofs; seit je her weht ein apokalyptisch angegammelter Wind um die hiesigen Hausecken. Die mit schnuckligen Steingärten, Sichtschutzwändchen, Plastikmöbeln und funzligen LED-Gartenlämpchen verunzierten Glücksschatullen von Einfamilienhäuschen schmiegen sich hier so eng wie kaum woanders an konventionell geführte Bauernhöfe, die seit Jahren dicht an der Grenze des wirtschaftlichen, kulturellen und seelischen Konkurses entlangschrammen. Trotz dieser Nähe gibt es keinerlei Verbindung zwischen den Einfamilien und den Bauern; die Landwirte produzieren für die Industrie und haben die Beziehung zu ihren Produkten verloren, die jeden Miststock weit von sich weisenden Einfamilien fahren in die nächste Kleinstadt, um ihre homogenisierte, standardisierte Nahrung im Supermarkt einzukaufen. Die letzte Kraft, die das Dorf vor dem Zerfall bewahrt, ist der Charme der Verkäuferin im Volg-Laden, eine Frau, die davon profitiert, ihre kulturellen Hintergründe nicht in der Schweiz eingesammelt zu haben.
Es ist Pfaffwil das Dorf meiner Mutter, und was sie dort seit über zwanzig Jahren macht – ich weiss es nicht. Sie wohnt dort, erledigt den Haushalt eines Mannes, der sich die Abende gerne mit Fernsehprogrammen füllt, während sie, weil sie jene Aufregungen nicht mag, die aus den Spielfilmen heraus in die Stube lärmen, an den Fernsehbildern vorbei auf die Nadeln blickt, mit denen sie Socken strickt. Socken, die sie mir schenkt, Socken, die ich gerne trage, obwohl ich sie nicht tragen kann, ohne daran denken zu müssen, wie meine Mutter lange Abende am Fernseher vorbei auf die Stricknadeln blickend vor dem Fernseher verbringt, in diesem Dorf, in dem in kalten Winternächten die Leblosigkeit aus den Gullideckeln dampft, in diesem Dorf, das zu verstehen mir vielleicht nie vergönnt sein wird.
So ist mir also auch meine Mutter eine gute Lehrerin. Während ich nicht verstehe, wie sie es seit über zwanzig Jahren in einem Dorf aushält, aus dem ich, wenn ich sie besuche, nach spätestens zwanzig Minuten flüchten möchte, scheint sie nicht die geringsten Schwierigkeiten zu haben, meinen nicht sehr bürgerlichen Lebenswandel zu verstehen. Ich möchte mit meiner Unbürgerlichkeit nicht kokettieren, Vieles wurde mir vom Schicksal kostenlos vor die Füsse gespült, aber ich stelle es mir doch etwas abenteuerlich vor, als bald 70-jährige Mutter einen Sohn zu haben, der, obwohl über 40, weder Frau noch Kind noch Auto noch Wohnung noch festen Job hat. Bloss eine Lehrstelle auf einem Bauernhof hat er, sein Stundenlohn beträgt zwei Franken achtzig, und dann ist er auch noch frech genug zu behaupten, er sei glücklich.
Ja, ich sehe ein, ich könnte, verstünde mich meine Mutter nicht so gut, meine Mutter viel besser verstehen, aber sie gehört eben zu diesem Pfaffwil, das ich nicht verstehen kann – kein Wunder eigentlich, dass dort jetzt noch ein Auto steht, das ich nicht verstehe.
Urban Cowboy; wahrscheinlich ist es ja ein Sanitärinstallateur, der dieses Auto fährt, oder ein Metallbauschlosser, viele andere Jobs sind auf dem Land nicht zu haben, und als Cowboy mag er sich fühlen, weil sein Vater noch einen Hof führt und er hin und wieder mit diesem grossen Auto zwei Säcke Ergänzungsfutter aus der Landi holt, während er sonst zum Beispiel sehr geschickt Aussentreppen und Handläufe zusammenschweisst, am Dorfrand, wo sie das Altersheim renovieren, in dem er später einmal wohnen wird.
Anfang zwanzig war ich, als ich, neu an der Uni eingeschrieben und ohne Geld, mit meiner Mutter in dieses Dorf zog. Für mich war Pfaffwil und die vollkommene Abwesenheit von Möglichkeiten, mit denen es gefüllt war, stets die beste Nahrung für phantastische Einfälle. Auch heute fände ich es nur logisch, würden die meisten jungen Menschen, die in hier aufwachsen, den Wunsch entwickeln, später einmal als Pilot in Asien, als Matrose auf dem Indischen Ozean oder als Robotik-Forschungsleiter in China zu arbeiten. Aber dieses Urban Cowboy zeugt von einer anderen Denkweise, es erinnert mich an einen Kollegen aus der Berufsschule, die ich Ende Mai abgeschlossen habe. Ein Kollege aus der Provinz hinter Winterthur war das, der nie zu sehen war ohne ein mit heroischen Silben bedrucktes Kleidungsstück. Meist waren das T-Shirts, die von einem Traktor schwärmten. Nothing runs like a deer, stand dann da zu lesen, und während ich lange noch an Rotwild dachte, war für alle anderen in meiner Klasse vom ersten Augenblick an klar, dass es um John Deere-Traktoren geht. In den letzten Schulwochen hatte er den Unterricht jeweils in einer sehr robusten, knallroten Arbeitshose besucht, die mit dem Schriftzug der Freiwilligen Feuerwehr Unter- und Oberstaffelbach bedruckt war. Ohne je mit ihm darüber zu sprechen, wussten wir also, dass er Mitglied ist in dieser Feuerwehr, und die Hose war so glänzend rot und tadellos sauber, dass er sie unmöglich an einer der Feuerwehrübungen, die er gewiss absolvierte, bereits getragen haben konnte. Er trug diese Hose nur mittwochs, auf der Schulbank, und ich weiss nicht, ob ich ihn beneiden soll dafür, irgendwo so sehr dazuzugehören.
Unter- und Oberstaffelbach sehen Pfaffwil vielleicht ziemlich ähnlich, im Gegensatz zu den meinen sind die Eltern dieses Berufsschulkollegen aber Landwirte, spezialisiert auf Schweinemast. Er hat mit zwanzig eine Lehre als Landmaschinenmechaniker abgeschlossen, hat auf dem Hof seines Vaters gearbeitet, hat geheiratet, ein Kind gezeugt, und bildet sich nun, mit sechsundzwanzig Jahren, im Kanton Bern, noch zum Landwirt aus. Auf einem Betrieb freilich, der Schweine mästet. In diesem ersten Schuljahr war er einer der besten unsere Klasse; so erfahren wie er ist keiner. Er wird, das ist klar, in zehn oder fünfzehn Jahren den elterlichen Betrieb übernehmen.
Wieso eigentlich, wurde er einmal von einem Klassenkollegen gefragt, wieso eigentlich betreibst Du den ganzen Aufwand, um von Winterthur nach Bern zu fahren, wenn Du Dein Lehrjahr auch auf dem elterlichen Hof hättest absolvieren können?
Ich wollte, so antwortete er, ich wollte noch einmal etwas anderes sehen, ehe der Ernst des Lebens beginnt.
Ich stand, wie er das sagte, gleich neben ihm. Gebannt blickte ich in sein Gesicht, suchte die Mundwinkel nach einem Lachen ab, suchte in seinen Augen nach Anzeichen der unbedingt in den nächsten Sekunden hervorbrechen müssenden Ironie. Aber da kam nichts, da war nichts, er meinte den Satz mit dem Ernst des Lebens vollkommen ernst, diese Lehrstelle auf einem bernischen Schweinemastbetrieb ist für ihn tatsächlich die letzte Chance, noch einmal etwas anderes zu erleben, ehe er, für den Rest seines Lebens, auf dem elterlichen Hof Schweine mästen und hin und wieder mit den anderen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr einen kurzweiligen Abend verbringen wird.
Am liebsten hätte ich ihn heute mitgenommen, damit er, ehe der Ernst des Lebens beginnt, noch die Dala-Schlucht oder eine Lesung von Gospodinov erlebt, aber damit wüsste er wahrscheinlich nichts anzufangen, nothing runs like a deer, und wenn fünf Meter hinter Deinem Schlafzimmer vierhundertfünfzig Mastschweine leben, hast Du andere Sorgen, als der Dala beim Rauschen zuzuhören. Das nächste Mal, wenn Sie im Supermarkt Schweinefleisch kaufen, können Sie also an Stefan denken, an Stefan aus Unter- oder Oberstaffelbach, ich weiss es nicht, aber ich bin sicher, er trägt seine schöne Feuerwehrhose nur, wenn es nicht brennt.
Noch immer aber versuche ich, dieses Urban Cowboy zu verstehen. Um meinen Blick zu wenden, um die Worte von ihren Stühlen zu bitten und sie im Kopfstand vor mir zu haben, stelle ich mir ein Auto vor, das mitten in Bern geparkt steht und auf dem rural officeboy zu lesen ist. Das müsste, weil doppelt entgegenstehend, semantisch wieder dasselbe sein.
Ich nehme also an: Der urban cowboy lebt ein städtisch geprägtes Leben, er kennt die PIN seiner Kreditkarte, weiss, wann welche Ampel auf Grün schaltet, hat aber nicht vergessen, wo, wenn es um eine Kuh geht, vorne und hinten ist. Beim rural officeboy verhält sich das ähnlich: Er kümmert sich zwar jetzt um Software, weiss aber noch immer, wie weich der Fladen einer Kuh ausschaut, deren Darmflora gesund ist. Wieso aber erwartet der Mensch, der diesen Wagen beschriften liess, von den Worten urban cowboy so selbstsicher aus seiner Mitwelt nur positive Reaktionen? Wieso hat er nicht in Betracht gezogen, seine Inhalte in der deutschen Sprache zu transportieren? Städtisch geprägter Agrarpraktiker – wäre das nicht bestrickend?
Es ist anzunehmen, dass es noch andere Dörfer gibt, in welchen solche Autos stehen. Vielleicht zählen sogar Unter- und Oberstaffelbach dazu. Unnütz, in die Dörfer zu blicken, wenn man sieht, was in den Städten passiert? Würden die Menschen, die auf dem Dorf wohnen, nicht dauernd unsere Abstimmungen gewinnen, könnte man zu Recht monieren, es sei hinfällig, über sie zu schreiben.
Um eine Übersicht über das Dorfleben in der Schweiz zu gewinnen, stelle ich mir gerne Landeskarten vor, thematisch koloriert: Verschiedene Farben kennzeichnen durch die Jahre hindurch die verschiedensten kulturellen Einflüsse und machen sichtbar, bis wohin welche Einflüsse haben vordringen können.
Dort, wo Pfaffwil eingetragen ist, sind nicht besonders viele Farben zu finden. Es gibt dort Internet-Anschlüsse, fast so viele wie in den Städten auch, aber das Internet ist bloss ein Kanal, über den Transport von Inhalten, über die Verbreitung von Einsichten sagt das nichts aus. So fühlen sich Pfaffwil und seine Nachbardörfer, die Karte belegt es, seit Winnetou und Old Shatterhand mit Faust und Flinte für Gerechtigkeit gesorgt haben, dem so genannten Wilden Westen kulturell sehr viel näher als zum Beispiel Zürich. Von Brüssel gar nicht zu sprechen. Country music klingt eben auch viel besser als Ländler. Und während die Berliner gegenwärtig von den Koreanern und deren Restaurants schwärmen, sind die Dörfler freilich nicht auf Fremde angewiesen, um ihren Saloon zu betreiben. Man muss nur einen alten Revolver, ein paar Dollar-Noten und ein Bild von einer Harley-Davidson über den Tresen hängen, und alles ist klar. Nach den Abenteuern Winnetous, von denen Pfaffwil nachhaltig beeinflusst wurde, blieb das Dorf lange ohne kulturellen oder mentalitätsgeschichtlichen Wandel. Das änderte sich erst, als der Autohersteller Subaru sich entschied, von einem ihrer Modelle werbewirksam zu behaupten, es sei speziell für die Schweiz entwickelt worden. Bald fuhren so viele Dörfler einen Subaru, dass sich unterbewusst der Glaube etablierte, es handle sich um ein einheimisches Fahrzeug. Das war in den 80er-Jahren. Seither hat sich in diesen Dörfern, einmal abgesehen von der Umstellung auf den verkapselten Kaffee, nichts geändert.
Nein, stimmt nicht ganz: In einigen Dörfern, so die Karte, hat sich noch die Einsicht verankert, dass es sich, wie Bundesrat Adolf Ogi einst im Fernsehen darlegte, lohnt, einen Deckel auf die Pfanne zu legen, wenn man ein Ei kocht.
Fassen wir zusammen: Drei wesentliche kulturelle Einflüsse in fünf Jahrzehnten – das kann nicht erstaunen, denn Bescheidenheit war hier schon immer ein überlebenswichtiger Charakterzug. Daran wird sich offenbar auch demnächst nicht viel ändern, denn die Dorfjugend bleibt dem Motorrad treu und will nichts wissen von den E-Bikes; an einer Batterie gibt es schliesslich nichts zu frisieren!
Nothing runs like a democracy: Zum Glück hört, denke ich jetzt, zum Glück hört der Ernst des Lebens mit dem Witz des Sterbens auf, und ehe das eintritt, soll noch jede und jeder Gelegenheit haben, kluge und wichtige, womöglich identitätsstützende Worte auf Autotüren zu schreiben.
Urs Mannhart hat als Velokurier, Nachtwächter, Journalist und in der Landwirtschaft gearbeitet. 2004 erschien sein Erstling »Luchs«, 2006 dann »Die Anomalie des geomagnetischen Feldes südöstlich von Domodossola«. Als Reporter berichtet Mannhart aus Ungarn, Serbien, Kosovo, Rumänien, Russland, Weißrussland und der Ukraine. »Bergsteigen im Flachland« ist sein dritter Roman, für den er 2016 mit dem Conrad Ferdinand Meyer-Preis ausgezeichnet wurde.

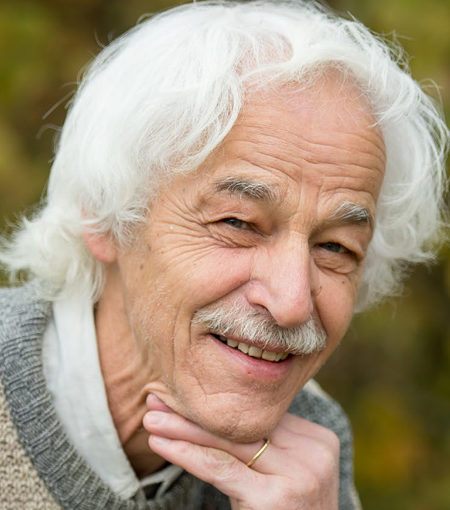


 Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo „Die Gebirgspoeten“. Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015). Im Verlag „Der gesunde Menschenversand“ erschien 2017 „Das Leben ist ein Steilhang“, ein sprachlicher Hochgenuss voller Witz und Doppelbödigkeiten!
Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo „Die Gebirgspoeten“. Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015). Im Verlag „Der gesunde Menschenversand“ erschien 2017 „Das Leben ist ein Steilhang“, ein sprachlicher Hochgenuss voller Witz und Doppelbödigkeiten!


 Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat.
Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat.