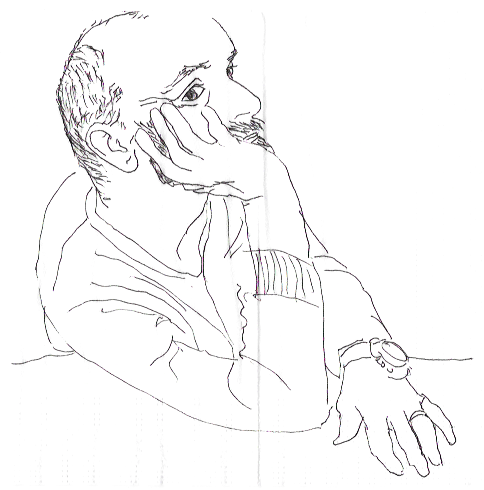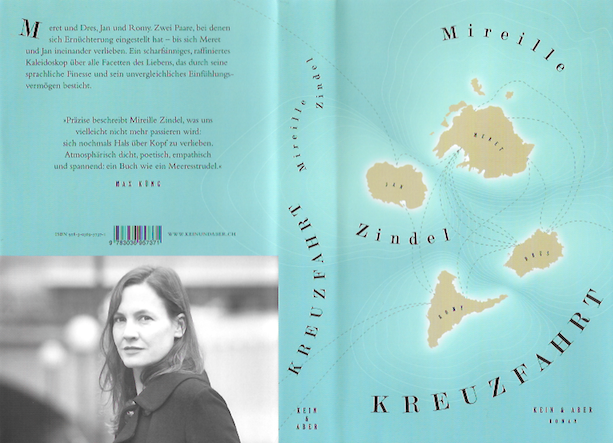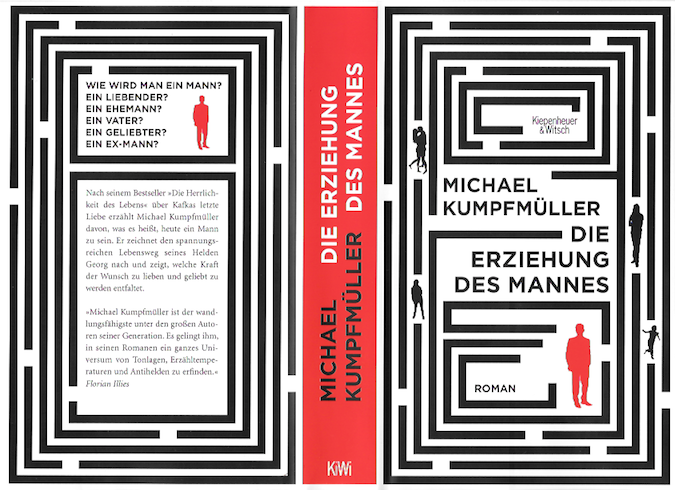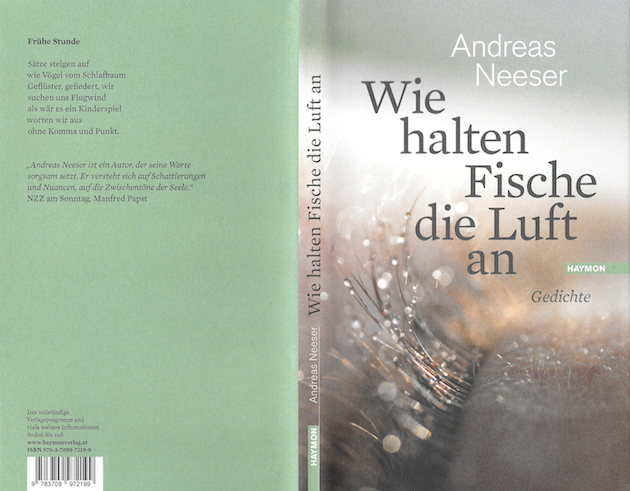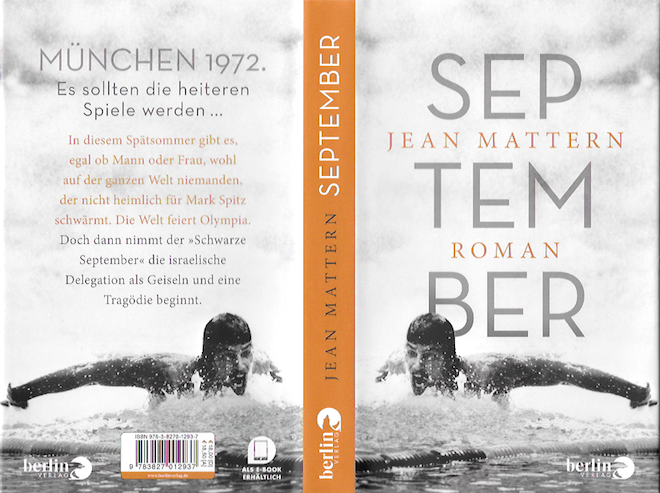Vom 31. März bis 3. April fanden die 8. St. Galler Literaturtage WORTLAUT statt, ein Festival des geschriebenen, gesprochenen und gezeichneten Wortes.
Hier meine ganz eigene Perlenkette, eine Hand voll gute Bücher:
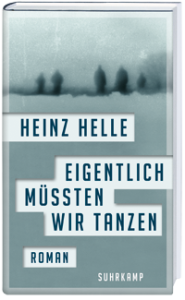 Heinz Helle «Eigentlich müssten wir tanzen», Suhrkamp
Heinz Helle «Eigentlich müssten wir tanzen», Suhrkamp
Fünf junge Männer verbringen ein Wochenende in den Bergen. Zurück im Tal sind die Ortschaften verwüstet, die Menschen tot, aufgequollen oder geflohen, die Häuser und Geschäfte geplündert, die Autos ausgebrannt, Kühe noch im Sterben an Melkmaschinen hängengeblieben. Zu Fuss unterwegs, aller Ziele beraubt, wird das Leben reines Funktionieren, Handeln jedem Sinn beraubt.
Im Gespräch bei der Lesung meinte Heinz Helle, die Gruppe junger Männer sei ein Versuchsanordung gewesen. Was passiert, wenn alles verschwindet, wegbleibt, wenn Menschen nur noch Körper sind? Sie werden Teil der Natur, haben Zivilisation aufgegeben, erst recht die verklärte, romantische Vorstellung, was ein Leben in und mit der Natur sein könnte. Einzig der Wille treibt sie, überleben zu wollen, obwohl niemand unter ihnen ein Warum und Wozu beantworten kann. Auch wenn der Roman düster erscheint, ist allein die Sprache es wert, dieses Buch zu lesen. Und der Autor ein Versprechen für die Zukunft!
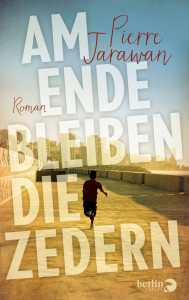
Pierre Jarawan «Am Ende bleiben die Zedern», Berlin
Vor Samirs Geburt sind seine Eltern aus dem Libanon nach Deutschland geflohen. Mit acht verschwindet sein geliebter Vater, plötzlich, unerwartet. Zwanzig Jahre später, nachdem ihm seine Verlobte das Letzte verweigert, macht sich Samir auf in das Land der Zedern, auf die Suche nach sich selbst und seiner Herkunft. Ein Buch über Risse in der Familie, im Heimatland Libanon und jene in der eigenen Seele. Pierre Jarawan schrieb ein Buch über seine Liebe, über ein Land, das noch über Generationen an Missverständnissen leiden wird, über ein Land, dass sich nicht traut, über die Vergangenheit nachzudenken. Ein erstaunlich reifes Buch ganz in der Tradition wahrer Geschichtenerzähler! In seiner Lesung spürte ich sein Feuer, die verzehrende Leidenschaft des Autors für Land und Familie. Das Buch sei Fiktion, aber trotzdem 100%ige Wahrscheinlichkeit. Und weil Pierre Jarawan als Slam Poet das Publikum als Teil seiner Performance ernst nimmt, sprang der Funken umso mehr.
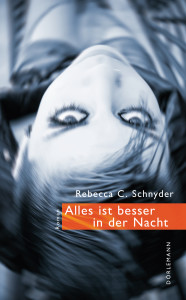
Rebecca C. Schnyder «Alles ist besser in der Nacht», Dörlemann
Alles an Billy ist Protest, jede Faser, jede Geste, jedes Wort. Protest gegen alles. Billy hat zwar schon einmal ein Buch geschrieben, aber nicht einmal das ist es wert, aufrecht zu gehen. Sie geht geduckt durchs Leben, gequält von den Anrufen ihrer Mutter, vom Drängen ihres Verlegers, selbst von der Liebe Noes, der ausgerechnet Theologie studiert. Rebecca C. Schnyder erzählt in ihrem ersten Roman vom inneren Kampf einer jungen Frau gegen sich selbst. Zugegeben, das Buch mag auf den ersten Seiten abschreckend wirken. Schon der zweite Satz schlägt in die Magengrube und es dauert eine ganze Weile Lesen, bis ich Mitgefühl für die Heldin aufbringen kann. Aber das ist Programm, braucht dieses Buch, diese Geschichte, um glaubhaft von einem Leben zu erzählen, das aus der Spur geraten ist. Kein Buch zur Erbauung, aber ein Buch, das einem eine Tür öffnen kann. Rebecca C. Schnyder, bisher mehr bekannt als Dramaturgin («Erstickte Träume – St. Gallens stilles Erbe», UA 7. November 2015 Theater St. Gallen) überzeugt auch im Roman mit scharfen, gut inszenierten Dialogen, rotzfrech. Billy ist ein erfrischendes Ekel.
Radek Knapp «Der Gipfeldieb», Piper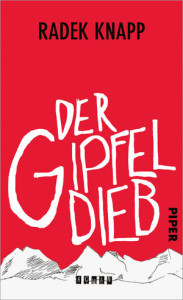
Jedes Mal, wenn Ludwik seine polnische Mutter besucht, tischt sie ihm eine ganze Palatschinken-Pyramide auf. Sie wissen nicht, was Palatschinken sind? Etwas von dem, was Ludwiks Mutter von Polen mit nach Wien genommen hat, was ihr selbst nicht schmeckt, ihrem Sohn aber ungefragt zu schmecken hat, erst recht bei schwierigen Entscheidungen. Und weil Ludwik Junggeselle ist und sich seine Mutter immer wieder höchst engagiert in das Leben ihres einzigen Sohnes einmischt, ist Palatschinken-Essen eine Art sich nahezukommen, manchmal auch auszusöhnen. Vor allem, wenn Ludwik nach 15 Jahren «Warten» Österreicher werden soll und man ihm die Staatsbürgerschaft wie einen Orden für ein «Leben im Griff» verleihen will. Leider meldet der Staat aber unvermittelt eine Gegenleistung und der Vierunddreissigjährige soll zur Armee. Radek Knapp ist eine Fabulierer, ein begnadeter Geschichtenerzähler, bei dem man nie ganz sicher ist, wie ernst er den Ernst des Lebens nimmt. Sein Roman ist aber nicht bloss ein Schwank, sondern von bissigen Kommentaren durchsetzt, bei denen nicht nur die Wiener einige Hiebe abbekommen: «Das Gesindel ist arm. Und wenn der Westen nicht hinüberfährt und der Armut vor Ort unter die Arme greift, kommt die Armut hierher und hilft sich selbst. Wenn sich also jemand schämen sollte, dann der Westen.» Die 40 Minuten Lesung waren köstliche Unterhaltung. So witzig der Protagonist im Roman, so witzig der Autor. Da werden Buch und Autor eins und für eimal gerät die Frage nach der Grenze zwischen Realität und Fiktion augenblicklich in den Hintergrund, erst recht nachdem der Autor in einem einzigen Satz die fünf meist gestellten Fragen bereits beantwortete.
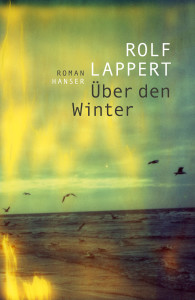 Rolf Lappert «Über den Winter», Hanser
Rolf Lappert «Über den Winter», Hanser
Lennard Salm ist fünfzig und Künstler, wenn auch verunsichert. Als seine älteste Schwester stirbt, kehrt er von der einen mit Strandgut überzogenen Küste am Mittelmeer zurück nach Hamburg an die andere «Küste» mit dem Strandgut seiner Familie, von der er immer entkommen wollte. Auf der Suche nach dem eigenen Leben begegnet er seiner Familie. Aber was ist das, das eigene Leben? Es ist kalt im Winter in Hamburg! Er lernt seine Eltern und Geschwister neu kennen. Rolf Lappert beschreibt genau, poetisch und mit einem ungeheuren Zug in seiner Sprache. Dass er am 9. April bei uns in Amriswil lesen wird, freut mich ungemein!
PS Lea, meine Tochter, zeichnete auf eine Papierserviette im Papiersaal Zürich.