Bei der Lesung der Grande Dame der Holländischen Literatur Margret de Moor sassen eine Mutter mit ihrer Tochter in der Reihe vor mir, beide mit Brillen im Haar, die Junge mit schulterfreier, weisser Bluse. «Ich bin masslos enttäuscht. Ich habe geschrieben und angerufen. Aber alle hatten sie eine Ausrede. Ich bin enttäuscht von meiner Generation.»
 Ich konnte mich ihrer lautstarken Entrüstung nicht entziehen. Die Lesung würde gleich beginnen. Sie, die junge Frau vor mir, wetterte weiter in Richtung ihrer Mutter. «Hast du gesehen, wer hier ist und wer hier fehlt? Meine Generation. Jene, die dauernd hausieren, was sie alles gelesen haben. Ich bin enttäuscht.» Nicht viel hätte gefehlt, und ich hätte mich eingemischt, hätte der Enttäuschung der jungen Frau beigepflichtet. Nicht um sie zu beschwichtigen, sondern um Öl ins Feuer zu giessen.
Ich konnte mich ihrer lautstarken Entrüstung nicht entziehen. Die Lesung würde gleich beginnen. Sie, die junge Frau vor mir, wetterte weiter in Richtung ihrer Mutter. «Hast du gesehen, wer hier ist und wer hier fehlt? Meine Generation. Jene, die dauernd hausieren, was sie alles gelesen haben. Ich bin enttäuscht.» Nicht viel hätte gefehlt, und ich hätte mich eingemischt, hätte der Enttäuschung der jungen Frau beigepflichtet. Nicht um sie zu beschwichtigen, sondern um Öl ins Feuer zu giessen.
Die junge Frau hat recht. Auch wenn die Organisatorinnen und Organisatoren der 40. Solothurner Literaturtage nicht einmal in den Windeln waren, als das Festival vor 40 Jahren ins Leben gerufen wurde, sind die Besucher und Besucherinnen durchschnittlich deutlich im Rentenalter; durchaus frisch und jung geblieben, beweglich und offen. Aber ganz offensichtlich die aussterbende Generation derer, die sich von der Literatur aus der Komfortzone locken lassen. Keine Generation las so viel wie die junge heute. Aber es scheint nicht zu reichen für die Geheimnisse der Literatur.
Dabei sind sie da, die Stimmen, die Aktualität mit Literatur verbinden. Auch in den frischen Stimmen der Schweizer Literatur. Zwei Beispiele:
Alice Grünfelder, einst Buchhändlerin, dann Studium der Sinologie und Germanistik in Berlin und China, arbeitete lange beim Unionsverlag Zürich als Herausgebende der «Türkischen Bibliothek». Ihre Leidenschaft ist 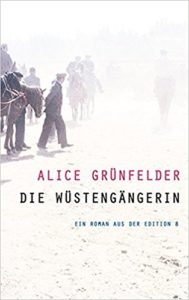 Asien. Eine Leidenschaft, die sie einen ersten Roman schreiben liess – «Die Wüstengängerin».
Asien. Eine Leidenschaft, die sie einen ersten Roman schreiben liess – «Die Wüstengängerin».
Anfang der 90er Jahre reist die Studentin Roxana entlang der Seidenstrasse, um unbekannte buddhistische Höhlenmalereien zu erforschen als Beweis dafür, dass die Region dort nicht «immer» islamisch war. Zwanzig Jahr später reist Linda wegen eines Entwicklungsprojekts ebenfalls nach Xinjiang und stösst dabei auf die Spuren Roxanas.
So sehr das Schicksal der Uiguren aus dem Bewusstsein des Westens gefallen ist, so leidenschaftlich verpackt die Autorin die letzten zwanzig Jahre Geschichte eines Volkes, das vergessen von der Weltöffentlichkeit um seine Rechte kämpft. Das Gebiet der Uiguren war über Jahrhunderte immer wieder Durchgangsland, sowohl wirtschaftlich wie militärisch. Die chinesischen Repressalien heute und in den vergangenen Jahrzehnten sind strategisch. Die Gegend muss «ruhig» bleiben, um all die geopolitischen Absichten Chinas durchzusetzen.
Alice Grünfelders Auftritt im schmucken Stadttheater Solothurns hat Eindruck gemacht. Nicht nur weil das orange Vorsatzpapier ihres Romans, das textile Buchzeichen, ihr pelziger Fingerring und die orange Hose mit chinesisch anmutenden Stickereien Ton in Ton zueinander passten. Eine Wüstengängerin erzählt von «der Wüstengängerin», eine leidenschaftliche Frau von einer leidenschaftlichen Frau. Ein Roman, der eine politische Dimension beinhaltet, ohne zu belehren, der nicht nur dokumentieren will, ebenso unterhalten. Ein Roman, der fasziniert und mehrfach erstaunt.
Auch bei der 1979 geborenen Regula Portillo ist das Stadttheater proppenvoll. Ob Heimspiel, weil sie im Kanton Solothurn aufwuchs oder angelockt vom Mut einer jungen Frau, die ein Stück Geschichte Lateinamerikas aus der Sicht von Schweizern erzählt, bleibe dahingestellt.
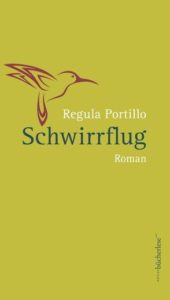 Eine Parallelerzählung von Eltern und Töchtern, von einem zehnmonatigen Aufenthalt eines Ehepaars in Nicaragua während der Revolution, den Kämpfen zwischen Sandinisten und von den USA unterstützten Contras. Und den Töchtern, die nach dem Tod der Eltern das Haus räumen und erst da entdecken, dass die Eltern in ihrer verschwiegenen Vergangenheit ganz andere Leben führten. Sie entdecken die Hinterlassenschaft zweier Brigadisten aus der Schweiz, eines Paars, das in einer ganz anderen Welt an den Umständen von Revolution und Zerrissenheit zu zerbrechen drohte.
Eine Parallelerzählung von Eltern und Töchtern, von einem zehnmonatigen Aufenthalt eines Ehepaars in Nicaragua während der Revolution, den Kämpfen zwischen Sandinisten und von den USA unterstützten Contras. Und den Töchtern, die nach dem Tod der Eltern das Haus räumen und erst da entdecken, dass die Eltern in ihrer verschwiegenen Vergangenheit ganz andere Leben führten. Sie entdecken die Hinterlassenschaft zweier Brigadisten aus der Schweiz, eines Paars, das in einer ganz anderen Welt an den Umständen von Revolution und Zerrissenheit zu zerbrechen drohte.
Viva Nicaragua! Viva la Revolución! Eine Mission voller Enthusiasmus, die an der Wirklichkeit zu scheitern drohte. Eine zehnmonatige Reise der Eltern in den 90ern in ein Land, in dem Umsturz, Revolution und neue Ideen das erreichen sollten, was in vieler Hinsicht nicht einmal im Heimatland zu erreichen war.
«Warum verschwand Jahrzehnte später das, was zuvor eine ganze Generation beschäftigte?», war eine der Motivationen der jungen Autorin Regula Portillo. 800 Schweizerinnen und Schweizer zogen damals nach Nicaragua, in der Absicht, sich an historischen Prozessen zu beteiligen. Eine Revolution, die in Lateinamerika stattfand, aber in den Herzen eingeschlossen in viele Länder zurückgetragen wurde, eingehüllt von Enttäuschung und Kränkung.
Nicht einfach ein Roman über die Revolution in Nicaragua! Wie weit dürfen wir uns in die Geschicke eines «fremden» Landes einmischen? Was nehmen Eltern mit dem Sterben mit ins Grab? Wo bleiben all die Geschichten, die unwiderruflich dem Vergessen drohen? Auch ein Roman über die Rolle der Frau, über ein Paar, das sich aussetzt, das Scheitern, über den Tod.
Ich bin nicht enttäuscht. Aber im Grunde genauso ratlos wie die junge Frau im Landhaussaal in der Reihe vor mir. Während Solothurn unter der Vorsommersonne voll mit jungen Menschen ist, die am Ufer der Aare ihre Seele baumeln lassen, bleiben die «Alten» unter sich. Und wenn die Solothurner Literaturtage dereinst auch das Pensionsalter erreichen sollten, bleibt die Frage existenziell, wie die jungen Generationen von Literatur erfolgreich infiziert werden sollen.
Titelbild: Alice Grünfelder und Moderatorin Bernadette Conrad



 Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.
Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.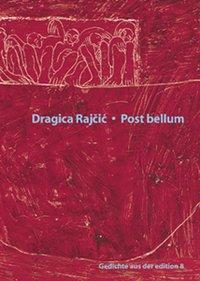 Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.
Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem. Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.
Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache. Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.
Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.