Ein Zug fährt von Westen nach Osten, quer durch ganz Russland. Der Zug der Transsibirischen ist vollbesetzt, Rekruten auf dem Weg in die Ausbildung, Menschen auf der Reise, eine junge Französin, eine Touristin auf der Flucht vor ihrem alten Leben. Aber unter den zukünftigen Soldaten sinnt auch Aljoscha auf Flucht, jedes Mal, wenn der Zug hält.
Hélène fährt in ihrem Abteil erster Klasse. Sie ist aus einer spontanen Eingebung eingestiegen, war mit Anton in Moskau unterwegs, als Begleitung, um dann plötzlich alles in eine Tasche zu stopfen, um Distanz zu dem Leben zu bekommen, in dem sie sich festgefahren fühlte. Sie spricht nicht einmal Russisch, hat keine Vorstellung davon, was dort, irgendwo im Osten sein wird, nur weg.
Aljoscha wurde zwangsrekrutiert, sitzt mit vielen anderen in diesem Zug, Rekruten zur Ausbildung, Männern, die er nicht kennt, zu denen er nicht gehören will, weil er nicht sein will, wozu man ihn machen will. Aljoscha wollte nicht weg und schon gar nicht zu einem Soldaten ausgebildet, Kanonenfutter werden. Jede Haltestelle auf der tagelangen Bahnfahrt ist Aufforderung genug, die Flucht zu ergreifen, abzuhauen, auch wenn er weiss, dass es kein Zurück geben wird.
Am Ende der Schienen wird die Kaserne stehen und die dedowschtschina, das Schikanieren der Wehrpflichtigen, und wenn er dort ist, wenn die Rekruten im zweiten Jahr ihm mit der Zigarette den Schwanz verbrennen, ihn die Latrinen auslecken lassen, ihn am Schlafen hindern oder in den Arsch ficken, wird er allein sein, niemand wird ihm helfen können.
Der Zug rattert gen Osten, Kilometer für Kilometer, Stunde für Stunde. Für Hélène genauso in eine ungewisse Zukunft, wie für Aljoscha. An den Haltestellen, an denen sich die Reisenden die Füsse vertreten, auch die angehenden Soldaten dem Zug entlang von ihren Vorgesetzten beobachtet werden, schnuppert Aljoscha nach der einen Chance, die ihn aus dem Würgegriff eines Alps entlassen soll. Aber bei jedem Versuch fehlt der Mut, die letzte Entschlossenheit, aber auch das Glück.

Hélène spürt die Not des jungen Mannes, sieht seinen Blick, die Augen, die das Weite suchen. Sie begegnen sich immer wieder auf den schmalen Gängen des Zuges, wenn er seine Stirn an die Scheibe drückt. Zwischen den beiden wächst ganz zaghaft eine Verbundenheit, eine Mischung aus Mitleid und Verliebtheit, aus Faszination und Hilflosigkeit. Bis Aljoscha alles auf eine Karte setzt und ein weiterer Fluchtversuch zu scheitern droht. Es gibt keine Versuche, nur Scheitern oder Gelingen. Hélène zieht den jungen Mann in ihre Kabine und versteckt ihn dort, wo man sonst die Koffer in einen Zwischeraum schiebt. Die körperliche Nähe wird zur Notwendigkeit, nicht nur in seinem Versuch, sich vor seinen Vorgesetzen und dem Personal des Zuges unsichtbar zu machen, sondern weil der Raum zwischen und um die beiden mit einem Mal auf das reduziert wird, was eine Kabine mit zwei Pritschen hergibt.
Das Hemd verlangt er, weil es um seine Freiheit geht.
Aus Hélène und Aljoscha werden Verbündete ohne gemeinsame Sprache. Aljoscha braucht seine Verbündete und Hélène hat sich an ein Schicksal gehängt, dem auch sie nicht mehr entfliehen kann. Während der Zug unaufhaltsam Richtung Osten rollt, spinnt sich ein Verhältnis, dass die beiden mehr und mehr aneinander fesselt. Werden sie es schaffen? Gibt es ein Danach?
Maylis de Kerangal schafft einen klaustrophobischen Raum, einen Zug in die Verdammnis, einen Weg, den es nur in der einen Richtung gibt. „Weiter nach Osten“ ist ein schmales Buch mit erstaunlichem Tiefgang. Ob in seiner Dramatik oder in seiner Sprache. Lange, mäandernde Sätze, die das Rattern der Räder aufnehmen, die den Zug imitieren, den Zug des Geschehens, den Zug auf Rädern. Maylis de Kerangal schafft Erstaunliches. Es ist das Psychogramm einer Not. Man riecht den Schweiss der Angst, den Zwang des Kollektivs, das lauernde Misstrauen, das Reissen der Verzweiflung.
Irgendwie Liebesgeschichte und doch nicht. Irgendwie Antikriegsgeschichte und doch nicht. Irgendwie Thriller und doch nicht. Aber ein absolut beklemmendes Kammerspiel!
Maylis de Kerangal, geboren 1967 in Toulon, zählt zu den einflussreichsten Gegenwartsautorinnen Frankreichs. Sie hat zahlreiche Romane, Essays und Erzählungsbände veröffentlicht. Für ihren 2010 erschienenen Roman Die Brücke von Coca wurde sie mit dem Prix Médicis ausgezeichnet, Die Lebenden reparieren gewann zahlreiche Preise und wurde 2016 verfilmt. Kerangal lebt mit ihrer Familie in Paris.
Andrea Spingler, geboren 1949 in Stuttgart, ist seit 1980 als freie Übersetzerin tätig. Sie hat unter anderem Werke von Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Patrick Modiano, Jean-Paul Sartre, André Gide ins Deutsche übertragen. 2007 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis für herausragende deutsch-französische Übersetzungen ausgezeichnet, 2012 mit dem Prix lémanique de la traduction. Sie lebt in Oldenburg und Südfrankreich.
Beitragsbild © F. Mantovani / Editions Gallimard / Suhrkamp Verlag



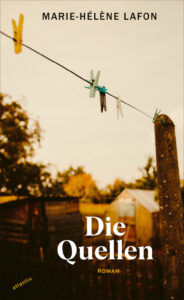

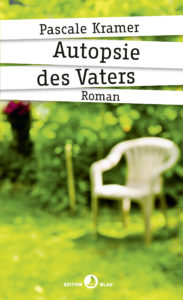 Wider Willen kehrt Ania in ein Leben zurück, von dem sie sich schon als Kind loszureissen versuchte, von einem Vater, der sie nicht verstehen wollte und konnte. Nicht ihre Mühen in der Schule, nicht ihre Distanziertheit in der Zeit im Internat, nicht ihre Liebe und Ehe mit Novak, einem Serben und schon gar nicht ihren tauben Sohn Théo. Ania kehrt zurück in ein Leben, von dem sie sich mit aller Kraft getrennt hatte, in die Nähe eines Vaters, der sich mit seinem Freitod ganz ihrem Verständnis entzog. Die zurückgelassene Unordnung ihres Vaters hatte sich mit seinem Tod noch weiter verschoben. Als hätte ein Erdbeben in bodenloser Tiefe die Schichten darüber so sehr verückt, dass nichts mehr zusammenfinden kann, nichts.
Wider Willen kehrt Ania in ein Leben zurück, von dem sie sich schon als Kind loszureissen versuchte, von einem Vater, der sie nicht verstehen wollte und konnte. Nicht ihre Mühen in der Schule, nicht ihre Distanziertheit in der Zeit im Internat, nicht ihre Liebe und Ehe mit Novak, einem Serben und schon gar nicht ihren tauben Sohn Théo. Ania kehrt zurück in ein Leben, von dem sie sich mit aller Kraft getrennt hatte, in die Nähe eines Vaters, der sich mit seinem Freitod ganz ihrem Verständnis entzog. Die zurückgelassene Unordnung ihres Vaters hatte sich mit seinem Tod noch weiter verschoben. Als hätte ein Erdbeben in bodenloser Tiefe die Schichten darüber so sehr verückt, dass nichts mehr zusammenfinden kann, nichts. Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman „Die Lebenden“ (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem „Die unerbittliche Brutalität des Erwachens“ (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.
Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman „Die Lebenden“ (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem „Die unerbittliche Brutalität des Erwachens“ (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen. Zur Übersetzerin: Andrea Spingler, geboren 1949 in Stuttgart, ist seit 1980 als freie Übersetzerin tätig. Sie hat unter anderem Werke von Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Patrick Modiano, Jean-Paul Sartre, André Gide ins Deutsche übertragen. 2007 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis für herausragende deutsch-französische Übersetzungen ausgezeichnet, 2012 mit dem Prix lémanique de la traduction. Sie lebt in Oldenburg und Südfrankreich.
Zur Übersetzerin: Andrea Spingler, geboren 1949 in Stuttgart, ist seit 1980 als freie Übersetzerin tätig. Sie hat unter anderem Werke von Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Patrick Modiano, Jean-Paul Sartre, André Gide ins Deutsche übertragen. 2007 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis für herausragende deutsch-französische Übersetzungen ausgezeichnet, 2012 mit dem Prix lémanique de la traduction. Sie lebt in Oldenburg und Südfrankreich.