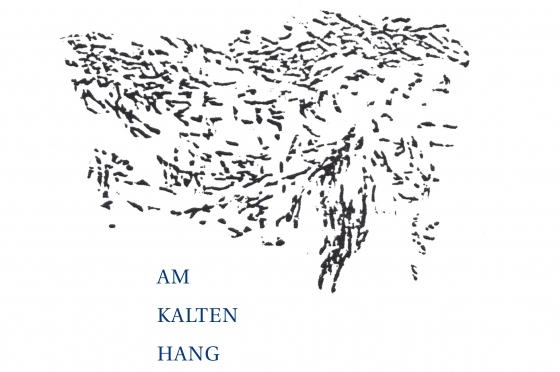Die 9. St. Galler Literaturtage WORTLAUT 2017 sind Erinnerung. Laute und leise Töne mit wenig und viel Publikum. Markige Sprüche, freche Zeichnungen, durchscheinende Lyrik und rundum Gespräche über Bücher und Literatur, Text und Kontur. Aber was blieb in Erinnerung? Was hat bewegt?
„Warum ist die Welt in Büchern nicht eine bessere als in der wirklichen Welt?“
Mein ganz persönliches literarisches Jahr beginnt mit den St. Galler Literaturtagen – jedes Jahr. Im Vorsommer dann die Solothurner Literaturtage, die Nabelschau der CH-Literatur und im Sommer dann das Literaturfestival in Leukerbad mit einem literarischen Blick weit über die Landesgrenzen hinaus. Es sind aber wie in jedem Bücher- und Literaturfest nicht so sehr die Bücher, die mich locken, sondern die Schöpferinnen und Schöpfer selbst. Vor allem jene, bei denen ich spüre, wie neugierig sie sind, was ihre Bücher mit mir machen.
„Warum hat die Literatur so viel Lust, den Antihelden scheitern zu lassen?“

Die diesjährigen Literaturtage begannen in der Provinz, mit einer Prologlesung des jungen Schriftstellers und Journalisten Frédéric Zwicker im Kulturforum Amriswil. Der Autor las aus seinem ersten Roman „Hier können sie im Kreis gehen“, der Geschichte des 91jährigen Johannes Kehr, der sich im Altersheim hinter einer vorgetäuschten Demenz vor den Menschen versteckt. Sein ernst zu nehmender Roman über den letzten Lebensabschnitt vieler Menschen, den man aber gerne verdrängt, mit dem man sich selbst meist erst kurz davor und nur ungerne auseinandersetzt. Die Geschichte eines alten Mannes, die erklären soll, warum sich jemand hinter einer vorgespielten Demenz vom Leben distanzieren will. Ein Unterfangen, das mit Bedacht und Vorbereitung angegangen werden muss, wenn Kehr sich nicht durch die Wirkung eines Medikaments oder einer unglücklichen Äusserung verraten will. Ein Abenteuer, das ihm ungeahnte Freiheiten eröffnet, weil niemand, nicht einmal seine Enkelin, deren Foto er seine Geschichte erzählt, sein Doppelleben erahnt. Eine Lesung, ein Gespräch, das sich mit vielen wichtigen Fragen auseinandersetzte; Was tun, wenn einem nichts mehr am Leben hält? Wie viel Freiheit braucht der Mensch, selbst dann, wenn er unberechenbar wird?
„Literatur mag Personal, das etwas riskiert.“
Bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung las Max Küng, bekannt durch seine Kolumnen im Tages-Anzeiger Magazin, ein letztes Mal aus seinem Roman „Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück“. Ein Roman darüber, was hinter der Fassade eines Zürcher Stadthauses passiert, wenn alle im Haus gleichzeitig die Kündigung ihres Mietverhältnisses zugeschickt bekommen. Max Küng ist gewiefter Beobachter, Journalist und Schriftsteller. Max Küng tut, was er wirklich kann. Er blickt mit dem Brennglas auf Grossstadtmenschen, Menschen, die nur dort leben können, bunte Kampffische im Aquarium. Ganz offensichtlich verlief die Dernière mehr nach den Vorstellungen des Autors als die Buchtaufe im vergangenen Herbst auf dem Dach seines Zürcher Verlags. Damals ass man Biosandwiches unmittelbar unter der Sonne, ein kleiner Haufen. Das Buch kam unter all den Kulturlöwen kaum zu Wort.

„Figuren die allzu positiv besetzt sind, interessieren die Literatur nicht.“
Und am Samstag, dem eigentlichen Haupttag des Festivals, waren es nicht die grossen Namen, die mich überzeugten. Dafür umso mehr jene, die es verstehen, aus Beobachtungen fein ziselierte Literatur zu schaffen. Die noch junge Franziska Gerstenberg, die über ihrem Erzählband „So lange her, schon gar nicht mehr wahr“ sagt: „Die Figuren sind alle ich, mit allen Fragen, allen Zweifeln.“ Sie gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt.
gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt.
Die noch immer junge Anna Weidenholzer: In ihrem neusten Roman „Weshalb die Herren Seesterne tragen“ erzählt sie von Karl. Karl fährt weg in einen Winterort ohne Schnee. Ein Mann, der nur forschen will und kann, sich auf dieser Reise ganz vom Zufall leiten lässt, davon überzeugt, dass es für alles und jedes mindestens zwei Möglichkeiten gibt. Bloss nicht für die Stimme in seinem  Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen.
Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen.
„Wir leben in einer postheroischen Gesellschaft.“
Und dann noch Nico Bleutge, ein Dichter aus dem Norden, aus Berlin, den ein Stipendium nach Istanbul am Bosporus schickte, eine Stadt, die er bereits aus früheren Besuchen kennt, eine Stadt, in der es brennt. Eine Stadt zwischen Zeiten, Fronten und Kulturen. Nico Bleutge schreibt Lyrik in langen, farbigen Bändern, in „Nachts leuchten die Schiffe“ Wortgemälde mit Sicht auf die grossen  Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.
Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.
Was bleibt? Ich hörte zu und es taten sich Horizonte auf!
(Die eingefügten Zitate sind Fetzen eines sonst missratenen Literaturgesprächs zwischen Sabine Gruber, Jonas Lüscher und Andrea Gerster.)



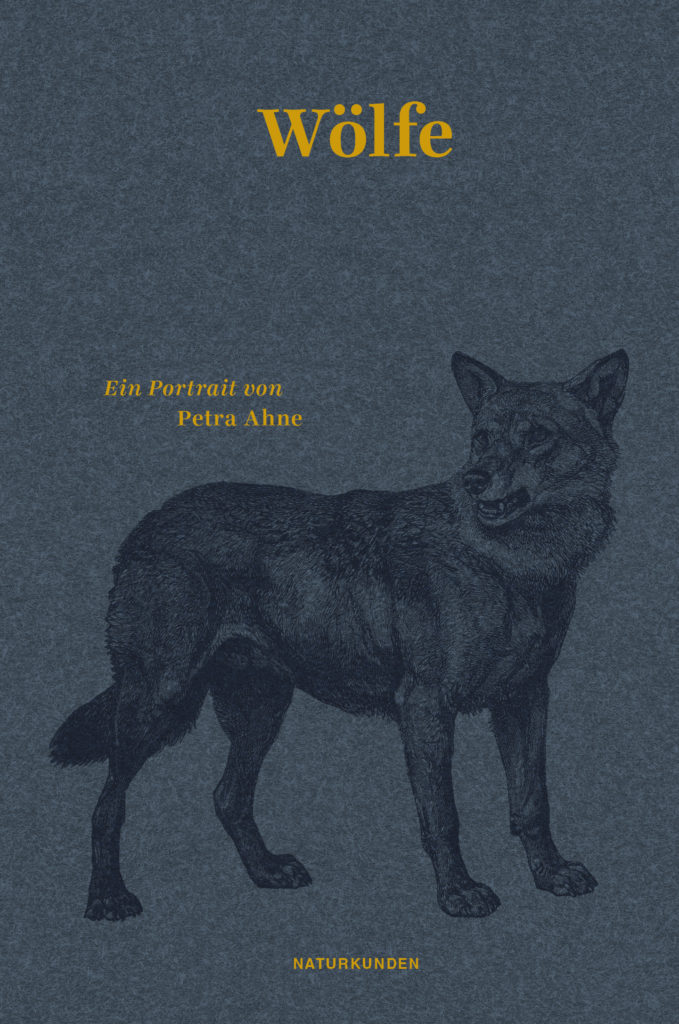 wetteifert er an Heisshunger, der selbst dem schlechtesten Hasen gierig nachstellt, an Tücke, Perfidie, während er dabei keine Spur vom Edelmuth des Löwen, von der frischen Tapferkeit des Eisbärs, vom Humor des Landbärs, von der Anhänglichkeit des Hundes hat.» Aber so sehr man den Wolf damals mit den Charakterzügen des Menschen beschreibt, so sehr ist der Wolf auch heute Sinnbild einer menschlichen Sehnsucht. Einst die Angst verkörpernd, die Angst vor der Unberechenbarkeit der Natur, ist der Wolf heute «personifizierte» Sehnsucht nach unmittelbarer Nähe zur Natur. Der Wolf als Medium.
wetteifert er an Heisshunger, der selbst dem schlechtesten Hasen gierig nachstellt, an Tücke, Perfidie, während er dabei keine Spur vom Edelmuth des Löwen, von der frischen Tapferkeit des Eisbärs, vom Humor des Landbärs, von der Anhänglichkeit des Hundes hat.» Aber so sehr man den Wolf damals mit den Charakterzügen des Menschen beschreibt, so sehr ist der Wolf auch heute Sinnbild einer menschlichen Sehnsucht. Einst die Angst verkörpernd, die Angst vor der Unberechenbarkeit der Natur, ist der Wolf heute «personifizierte» Sehnsucht nach unmittelbarer Nähe zur Natur. Der Wolf als Medium.