Kunst ist frei. Und weil sie frei ist, darf sich Literatur alles erlauben. «Schnitz» Marie-Jeanne Urechs dritter auf Deutsch erschienener Roman ist frei, voller Poesie und starker Bilder. Die gelernte Filmemacherin beweist ein besonderes Gespür für Inszenierung, hinterlässt einen bleibenden Eindruck!
Ist Kunst frei? Zumindest dort, wo man nicht dafür verfolgt oder eingesperrt wird. Die Welt abzubilden, wie sie ist, ist Aufgabe des Journalismus, der Reportage. Kein Mensch ermahnt einen Maler, sich an Fakten zu halten. Aber weil man dem geschriebenen Wort mehr als allem anderen zu glauben scheint, weil es Authentizität ausstrahlt, wenn man mit seinem Namen besiegeln kann, brechen selbst jene Grenzen, die bisher logisch waren. So macht sich gesteuertes Kalkül in Fake-News breit und zugleich werden Stimmen laut, die Literatur möge endlich Stellung beziehen, sich an aktuellen Fragen in Politik und Gesellschaft beteiligen. Aber Literatur soll Kunst sein, muss Kunst sein, muss frei sein. Wenn sie zu einem blossen Instrument wird, selbst dann, wenn nur noch Provokation in den Zeilen schreit, macht sich Geschriebenes, das sich als Literatur preist stutzig. «Schmitz» macht mich glücklich!
Marie-Jeanne Urech schafft Literatur, Literatur in der Totalen, Literatur im Kleinen. Die Autorin nimmt Realität und macht sie zur Kulisse. Ihr Personal sind Archetypen, holzschnittartig gezeichnet. Die Geschichte der Familie Kummer eine wilde Fahrt in eine abgrundtiefe Welt poetischer, in dunklen Farben gemalter Bilder, auch wenn die ganze Szenerie im Grellen Weiss eines ewigen Winters spielt.
Nathanel Kummer versucht mit aller Kraft, die Familie zusammenzuhalten, obwohl ihn Rückstände und Zahlungsaufforderungen von einer Katastrophe in die nächste treiben. Nathanel arbeitet täglich 21 Stunden, an drei verschiedenen Arbeitsstellen. Seine Frau Rose verkauft Pillen gegen die Traurigkeit, Vitaminkuren, die sich niemand in der heruntergewirtschafteten Stahlstadt mehr leisten kann. Serafin, der Grossvater, ein verwirrter Kriegsveteran, wacht entweder am Lichtschalter im Wohnzimmer oder macht sich auf auf die Suche nach dem «Schwarzen Mann», den er zu kennen glaubt, von früher, damals, der ihm und seiner Familie aus der Not helfen soll. Die beiden Kinder Yapakleu und Zobeline, die längst nicht mehr zur Schule gehen, streifen auf der Suche nach Brauchbarem durch die zerfallende Stadt, bis sie einen Pommes-Automaten entdecken, aus dem ein Riese steigt, zu ihrem Freund  wird und ihre Spielsachen verstecken hilft. Die letzte unter dem Dach der Familie ist Philantropie, die in ihrer unsäglichen Leibesfülle aus purer Menschenliebe besteht und wenn sie singt, Haus und Garten mit andächtig Lauschenden füllt, die für die Dauer des Gesangs all das Elend in der kaputten Stadt vergessen. Philanthropie ist so ausladend dick, dass sie sich nicht mehr vom Sofa stemmen kann. Einziges Nahrungsmittel, das sie noch verträgt, ist ein Blätterteiggebäck mit viel Puderzucker; Schnitz. Nathanel Kummer und seine Familie sind eine der letzten, die in der zweigeteilten Stadt noch nicht endgültig aus ihrem Haus vertrieben sind, auch wenn der Kommissar und Gerichtsvollzieher alles daran setzt, die Familie auf die kalte Strasse zu setzen. Der Kampf zwischen den Menschen in den eingeschlossenen Villen, den Glastürmen mitten in der Stadt und der darbenden Bevölkerung ist längst entschieden. So gesehen hat der dunkel-bunte Roman von Marie-Jeanne Urech durchaus eine real-politische Parallele. Aber ich glaube nicht, dass dahinter eine aufklärerische Absicht steckt. «Schnitz», Marie-Jeanne Urechs dritter Roman überzeichnet Realität wie die zwei vorangegangenen Romane. Die Autorin will nicht aufklären, nicht warnen, obwohl es indirekt dann doch geschieht, wenn über ihren Roman, über ihre Kulisse diskutiert wird. Sie erzählt von einer Klassengesellschaft , von den Superreichen in ihren Glaspalästen und den von Bilanzen Gestraften, von Schulden Erdrückten, von Armut Gepeinigten.
wird und ihre Spielsachen verstecken hilft. Die letzte unter dem Dach der Familie ist Philantropie, die in ihrer unsäglichen Leibesfülle aus purer Menschenliebe besteht und wenn sie singt, Haus und Garten mit andächtig Lauschenden füllt, die für die Dauer des Gesangs all das Elend in der kaputten Stadt vergessen. Philanthropie ist so ausladend dick, dass sie sich nicht mehr vom Sofa stemmen kann. Einziges Nahrungsmittel, das sie noch verträgt, ist ein Blätterteiggebäck mit viel Puderzucker; Schnitz. Nathanel Kummer und seine Familie sind eine der letzten, die in der zweigeteilten Stadt noch nicht endgültig aus ihrem Haus vertrieben sind, auch wenn der Kommissar und Gerichtsvollzieher alles daran setzt, die Familie auf die kalte Strasse zu setzen. Der Kampf zwischen den Menschen in den eingeschlossenen Villen, den Glastürmen mitten in der Stadt und der darbenden Bevölkerung ist längst entschieden. So gesehen hat der dunkel-bunte Roman von Marie-Jeanne Urech durchaus eine real-politische Parallele. Aber ich glaube nicht, dass dahinter eine aufklärerische Absicht steckt. «Schnitz», Marie-Jeanne Urechs dritter Roman überzeichnet Realität wie die zwei vorangegangenen Romane. Die Autorin will nicht aufklären, nicht warnen, obwohl es indirekt dann doch geschieht, wenn über ihren Roman, über ihre Kulisse diskutiert wird. Sie erzählt von einer Klassengesellschaft , von den Superreichen in ihren Glaspalästen und den von Bilanzen Gestraften, von Schulden Erdrückten, von Armut Gepeinigten.
Marie-Jeanne Urechs Roman lebt von den Gestalten und Bildern, die zwischen Alp und Traum pendeln, von Namen, zwischen bedeutungsvoll und verspielt, von den kleinen Geschichten im Roman. Von Nathanel Kummer, der seinen streusalzbeladenen Laster durch die ewig wintrige Stadt pflügt und nichts unversucht lässt, um seine Familie zu retten. Von der dicken Philanthropie, die auf dem Sofa im Wohnzimmer thront, ihren betörenden Gesang mit ausgebreiteten Armen in den Äther schmettert, sekundiert von zwei kleinen Engeln, Daphne und Tournov, die Philanthropie immer dann bewachen, wenn sie nicht singt. Von den beiden Kindern Yapakleu und Zobeline, die auf ihren Erkundungen durch die Stadt einen Pommes-Automaten entdecken, aus dem im Dunkeln, kurz vor acht, ein Riese aus einer kleinen Seitentür des Automaten entsteigt, sich entfaltet und im Dunst von Bratöl auf die andere Strassenseite geht. Der Riese wird zum Freund der Kinder, zum Hort und Hüter ihrer Geheimnisse. Es ist das Personal, das ich zu lieben beginne, selbst den Kommissar in seiner Verzeiflung, den der Winterwind in immer neuer Mission auf die Vortreppe des Hauses weht, um mit neuen Papieren das Ende des Hausfriedens anzukündigen.
Und es ist die Poesie, die Sprache, das unerschrockene Erzählen der Autorin, diese starke Stimme, die es schafft, ihr Erzählen immer wieder mit markigen Sätzen zu durchsetzen. Sätzen, die das Zeug zu Zitaten haben. «Schnitz» ist ein Buch, dass ich mit einem Stift hinter den Ohren lesen musste, um nichts zu versäumen. Eine erfrischende Stimme aus der Westschweiz, die unzimperlich erzählt und es verdient, in der deutschsprachigen Lesewelt entdeckt zu werden. Marie-Jeanne Urech zaubert, auch wenn die Bilder in düsteres Licht getaucht sind.
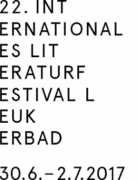 Marie-Jeanne Urech liest am Literaturfestival Leukerbad aus ihrem neuen Roman. Ebenfalls zu Gast am internationalen Literaturfestival im Wallis ist der zweite Literaturstern aus der Westschweiz, dessen neustes Buch im bigerverlag erschien: Quentin Mouron mit «Notre-Dame-de-la-Merci» (ebenfalls auf literaturblatt.ch besprochen!).
Marie-Jeanne Urech liest am Literaturfestival Leukerbad aus ihrem neuen Roman. Ebenfalls zu Gast am internationalen Literaturfestival im Wallis ist der zweite Literaturstern aus der Westschweiz, dessen neustes Buch im bigerverlag erschien: Quentin Mouron mit «Notre-Dame-de-la-Merci» (ebenfalls auf literaturblatt.ch besprochen!).
 Marie-Jeanne Urech wurde 1976 in Lausanne geboren. Nach einem Studium der Soziologie und Anthropologie in Lausanne machte sie 2001 ihren Abschluss an der London Film School und lebt heute als Regisseurin und Schriftstellerin in Lausanne. Im bilgerverlag erschienen 2006 «Mein sehr lieber Herr Schönengel» und 2013 «Requisiten für das Paradies». Alle Roman wurden aus dem Französischen übersetzt von Lis Künzli.
Marie-Jeanne Urech wurde 1976 in Lausanne geboren. Nach einem Studium der Soziologie und Anthropologie in Lausanne machte sie 2001 ihren Abschluss an der London Film School und lebt heute als Regisseurin und Schriftstellerin in Lausanne. Im bilgerverlag erschienen 2006 «Mein sehr lieber Herr Schönengel» und 2013 «Requisiten für das Paradies». Alle Roman wurden aus dem Französischen übersetzt von Lis Künzli.
Titelbild: Sandra Kottonau

