Man könnte auf den Roman „Die Wut, die bleibt“ mit einem Aufkleber „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie BuchhänderInnen oder RezensentInnen“ warnen. Drei Frauen; eine, die sich in die Tiefe stürzt, eine, die sich aufgibt und eine, die die Faust ballt. Mareike Fallwickls neuer Roman strotzt!
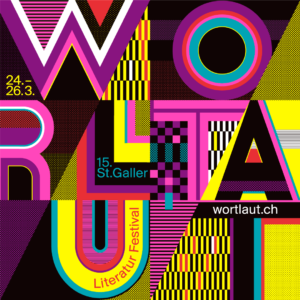 Meist muss ich mich für eine Besprechung, eine Rezension eines Buches gleich nach der Lektüre an die Tasten setzen, damit meine Eindrücke nicht durch neue Leseeindrücke verwischt werden. Bei Mareike Fallwickls neuem Roman „Die Wut, die bleibt“ fiel mir das schwer, weil mir die Autorin mit ihrem Roman einen ordentlichen Schlag versetzte. Nicht nur mit der Einstiegsszene, die auch nach fast 400 Seiten Lektüre nicht verrauchte, sondern mit der Thematik, die unter allen Szenen und Erzählsträngen des Buches liegt: Emanzipation.
Meist muss ich mich für eine Besprechung, eine Rezension eines Buches gleich nach der Lektüre an die Tasten setzen, damit meine Eindrücke nicht durch neue Leseeindrücke verwischt werden. Bei Mareike Fallwickls neuem Roman „Die Wut, die bleibt“ fiel mir das schwer, weil mir die Autorin mit ihrem Roman einen ordentlichen Schlag versetzte. Nicht nur mit der Einstiegsszene, die auch nach fast 400 Seiten Lektüre nicht verrauchte, sondern mit der Thematik, die unter allen Szenen und Erzählsträngen des Buches liegt: Emanzipation.
Zum einen ist da der noch lange nicht zu Ende ausgefochtene Kampf um gleiche Rechte, ebenbürtige Chancen und eine Gesellschaft, die noch immer nicht alles daran setzt, dass Familienarbeit nicht automatisch zu Ungunsten der Mütter verteilt wird. Zum andern sind es die Zusammenhänge einer noch immer männlich dominierten Sicht auf die Dinge, dass man Weiblichkeit automatisch mit Provokation gleichsetzt und junge Männer weit davon weg sind, ihre Aggressionen, Hormone und Dominanzansprüche in den Griff zu bekommen. Beispiele dafür gibt es in der Politik, in der sogenannte Staatsmänner ihr Machtgehabe auf dem Rücken von Millionen austragen oder in Diskussionen um Genderfragen, wo Aggressionen und Argumente aufkochen, die beweisen, wie unsensibel man(n) noch immer ist, wenn es darum geht Fehler, Schwächen und Missstände einzugestehen.
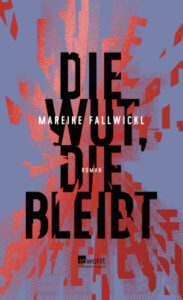
Lockdown. Zu Hunderttausenden sind Mütter gezwungen, ihre Kinder zuhause zu lassen, ihnen gar das Spielen auf dem Spielplatz zu verweigern, während die einen Väter Schlafzimmertüren zusperren mit dem Argument, sie hätten zu arbeiten und andere das Weite suchen als Finanzierer der Familie.
Helene sitzt mit ihrer Familie beim Abendessen. „Haben wir kein Salz?“ Nicht einmal eine Bitte. Helene steht auf, geht die drei Schritte bis zur Balkontür und stürzt sich in den Abgrund. Johannes, ihr Mann, Lola, Helenes älteste Tochter und die Kleinen Maxi und Lucius bleiben zurück, geschockt, traumatisiert und aus sämtlichen Selbstverständlichkeiten gerissen.
Weil Helenes Freundin Sarah vom schlechten Gewissen und der Sorge um die drei Kinder getrieben wird, nimmt sie sich ihrer an und verbringt die meiste Zeit an der Seite der Kinder, kocht, putzt, wäscht, streicht Pausenbrote, bringt die Kinder ins Bett, wickelt und tröstet. Sarah und Helene waren Freundinnen seit Kindertagen. Aber im Gegensatz zu Sarah, die sich eine eigenständige Existenz aufbauen konnte, erfolgreiche Krimiautorin wurde, ein Haus kaufte und den Wunsch nach einer eigenen Familie mit zunehmender Ernüchterung schwinden sah, musste Helene ihr Studium schwanger aufgeben, heiratete Johannes und tauchte mit zwei weiteren Kindern in scheinbares Familienglück. Und Johannes, der Witwer? Er nimmt hin, was ist, lebt sein Leben weiter wie in Trance. Vergisst, dass da jemand in der Wohnung hilft, ohne die die Familie zerfallen würde. Akzeptiert mit aller Selbstverständlichkeit, dass sich eine Frau hingibt für eine Frau, die sich hingegeben hat. Und während die Tochter Lola aus der Trauer erwacht, ihre Stimme genauso findet, wie ihre Kraft gegen jegliche Unterdrückung zu rebellieren, selbst im Rudel und hinter schwarzen Masken, wird aus dem aufgeladenen Nebeneinander zwischen Sarah und Helenes Tochter Lola eine Allianz.
Mareike Fallwickl zeichnet starke Frauenfiguren, auch wenn Helene ihren Kampf verloren hat. Johannes der Wittwer und Leon, Sarahs Lebenspartner, der sich mit aller dazugehörigen Selbstverständlichkeit in Sarahs Haus eingenistet hat, sind Prototypen jener Sorte Mann, die sich hinter scheinbaren Zwängen verstecken, die erst erwachen, wenn man sie schüttelt und prügelt. Mag sein, dass man als Mann bei der Lektüre stutzt, dass die Lektüre schmerzt, weil Selbsterkenntnis mitmischt. „Die Wut, die bleibt“ ist nicht nur in seinem Titel kämpferisch. Alles an diesem Roman ist ausgeführt bis zur letzten Konsequenz und macht mit der Keule bewusst, dass unsere Gesellschaft noch lange nicht ist, wo sie sein sollte.
„Die Wut, die bleibt“ ist tatsächlich ein wütendes Buch. Ein Roman, der mir in die Magengrube schlägt. Und doch ein Buch, vor dem ich mich tief verneige!
Mareike Fallwickl, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, arbeitet als freie Autorin und lebt mit ihrer Familie im Salzburger Land. 2018 erschien ihr literarisches Debüt «Dunkelgrün fast schwarz» in der Frankfurter Verlagsanstalt, das für den Österreichischen Buchpreis sowie für das Lieblingsbuch der Unabhängigen nominiert wurde. 2019 folgte der Roman «Das Licht ist hier viel heller«, dessen Filmrechte optioniert wurden. Sie setzt sich auf diversen Bühnen sowie Social-Media-Kanälen für Literaturvermittlung ein, mit Fokus auf weiblichen Erzählstimmen.
Beitragsbild © Gyöngyi Tasi



 verraten hat, der ihr nicht zur Seite stand, als andere Männer ihre Existenz vernichteten, so radikal, dass es nur die Flucht gab.
verraten hat, der ihr nicht zur Seite stand, als andere Männer ihre Existenz vernichteten, so radikal, dass es nur die Flucht gab.