Fred ist deutsche Konsulin, ehrgeizig, taff und eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Sie ist beruflich dort, wo sie immer hinwollte, hat das erreicht, wovon sie immer träumte. Aber war es das wirklich? Zu welchem Preis? Lucy Fricke trifft pfeilgenau in das wunde Herz einer Frau, eines Lebens, eines Systems. „Die Diplomatin“ reisst den Vorhang weg!
Fred heisst eigentlich Friederike Andermann. Sie tut das, was bis vor wenigen Jahrzehnten noch fest in Männerhand war; sie ist Diplomatin. Sie studierte, dachte eine Weile, Richterin werden zu wollen, begann dann aber eine Diplomatinnenkarriere im Auswärtigen Amt. Ursprünglich aus der Idee, etwas bewirken, sich einbringen, an etwas Grossem teilhaben zu wollen. Aber diese Idee geriet schon länger ins Wanken. Nicht erst in Uruguays Hauptstadt Montevideo, ihrer ersten Stelle als Botschafterin.
Über Wochen muss sie sich im Hinblick auf das Fest zur Deutschen Einheit Anfang Oktober in Montevideo mit Grillfleisch, Bratwürsten, Gästelisten und anderen Kleinigkeiten herumschlagen. Sicher auch deshalb, weil sie sehen muss, wie andere Frauen Mütter werden und sie einsam. Und als dann noch eine bekannte Verlegerin aus Deutschland anruft und von ihr verlangt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, weil sie seit 24 Stunden keine Nachricht mehr, keinen Post von ihrer Influencertochter erhalten habe und sich das Verschwinden nach ihrem Zögern als eine Entführung entpuppt, wird aus der Enge, in der sie sich fühlt, eine schlammig zähe Masse. Nachdem die junge Frau tot aufgefunden wird, sich das ganze zur Katastrophe mit unabsehbarem Ende auswächst, suhlt sich Fred in Schuldgefühlen, die ihr von niemandem genommen werden können. Bis sie versetzt wird, zuerst zurück nach Deutschland, später in die deutsche Botschaft in Istanbul.
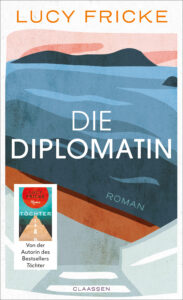
Aber so mondän die Räumlichkeiten und Einrichtungen der dortigen Botschaft sind, die Türkei hat sich unter dem jetzigen Präsidenten zu einem repressiven Staat entwickelt, dessen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, von Völkergemeinschaft und Europa ganz andere sind, als jene, die in Freds Seele noch immer als Idee herumschwirren. Istanbul, eine Stadt, die Fred gleichermassen liebt, fasziniert und überfordert. Wie ihre Arbeit.
Irgendwann taucht Barış (türkisch die ‚Versöhnung’) ein deutsch-türkischer Student auf, der seine Mutter in einem der türkischen Gefängnisse besucht. Jene Mutter geriet wegen Nichtigkeiten ins Visier der türkischen Polizei, wurde verhaftet und ohne Anklage und Verhandlung eingesperrt. In eine überfüllte Zelle, gezeichnet von den Strapazen, von mangelnder medizinischer Betreuung. Barış will seine Mutter frei, will Gerechtigkeit. Aber sein Besuch für die Mutter bringt keine Erleichterung. Auch er wird Ziel des türkischen Sicherheitsapparats, muss untertauchen, sich verstecken. Für Fred beginnt ein heikler Tanz auf Messers Schneide, ein Konflikt, den sie nicht nur auf diplomatischer Ebene verloren sieht, ein Konflikt, der ihr mit schmerzlicher Deutlichkeit zeigt, wie wenig Macht zur Veränderung nicht nur in ihren Händen liegt.
Dass Lucy Fricke ihren Roman zum grössten Teil in der türkischen Hauptstadt spielen lässt, dass sie Istanbul nicht bloss zu einer pittoresken Kulisse macht, dass sie glasklar zeigt, wie die Macht des türkischen Kontrollstaates eine Atmosphäre der Angst und permanenten Bedrohung erzeugt, dass hinter all den Fassaden aus Schein und Lügen Repression herrscht, ist mutig. Ich glaube kaum, dass Lucy Fricke, die mehrere Monate im Land und in dieser Stadt verbrachte, je wieder unbehelligt die Grenze wird überqueren können.
„Die Diplomatin“ ist ein Roman über eine Frau, die mitten in ihrem Leben ernüchtert und desillusioniert feststellen muss, dass jenes Leben, dass sie führt, jener Beruf, in dem sie zu wirken versucht, kaum mehr etwas davon hat, wovon sie einstmals träumte. Hoffnungen sind verschwunden, Leidenschaft erkaltet. Ein Kampf, den alle in ihrem Leben ausfechten müssen, Erkenntnisse, die allen drohen, unabhängig von Geschlecht, Stand oder Beruf. Was bleibt von den Idealen, die man einst wie Leuchtfeuer durch sein Leben trug? Wie schafft man es, dass jenes Feuer nicht erlischt? Auch die Sehnsucht nach Erfüllung und Liebe!
Lucy Frickes Roman ist mutige Literatur!
Interview
Ihr Roman lässt sich in verschiedene „Richtungen“ lesen. Zum einen ist es der Roman über die Ernüchterungen einer Frau, nicht nur in ihrer Arbeit, auch mit ihren Beziehungen, nicht zuletzt mit der Liebe. Und dann ist es auch ein Roman, der sich mit der Diplomatie direkt auseinandersetzt, wie sehr einem die Hände gebunden sind. Aktuell scheint es die Diplomatie noch schwieriger zu haben. Man verhandelt zwar irgendwie, aber im Ukrainekrieg sprechen beide mit einem Vokabular, dass vor 80 Jahren schon einmal Konjunktur hatte und mit Diplomatie rein gar nichts mehr zu tun hat. Ängstigt Sie das auch?
Es ist Angst gepaart mit Ohnmacht, die denkbar schlechteste Kombination. Wir, die wir nicht Macht haben, die grossen Entscheidungen zu treffen, können nur im Kleinen tun, was immer uns möglich ist. Humanitäre Unterstützung in jeder Form.
Ein grösserer Teil Ihres Romans spielt in der türkischen Hauptstadt, in der Sie mehrere Monate verbracht haben. Eine Stadt, in die man sich genauso verlieben wie verlieren kann. Eine Stadt mit pittoresker Kulisse, fest im Klammergriff eines rigiden Alleinherrschers. Ihr Roman nimmt kein Blatt vor den Mund. Befürchten Sie, in Zukunft nie mehr in die Türkei einreisen zu können?
Nie mehr, das würde ich nicht sagen. Auch dieser Präsident wird nicht ewig an der Macht bleiben. Aber den nächsten Sommer werde ich sicher nicht in Istanbul verbringen, das ist ein kleines Opfer im Vergleich zu dem, was den Figuren im Roman und so vielen Menschen in der Türkei widerfährt.
Fred fürchtet sich als Diplomatin permanent vor Fehleinschätzungen. Eine Furcht, die auch mich zuweilen lähmt. Wer weiss schon, welche Entscheidung die richtige ist. Diese Furcht schleicht sich bis in ihre Gefühlswelt, wenn sie nicht weiss, ob sie ihnen trauen kann. Mein Schwiegervater war ein Leben lang Bauer. Er meinte einmal, als ich mit ihm auf dem Feld bei der Aussaat mitfuhr, nichts garantiere ihm eine gute Ernte. Haben wir Instinkt und Urvertrauen verloren?
Vielleicht sind wir generell vorsichtiger geworden, oder auch umsichtiger. Meine Hauptfigur Fred hat dazu jeden Grund, ihre Entscheidungen und Einschätzungen betreffen das Leben anderer direkt. Das ist ein Fakt und kein Gefühl. Vertrauen ist schwierig, wenn Gespräche abgehört werden, Überwachung und Geheimdienst allgegenwärtig sind. Sie ist in ihrer Position einsam geworden, wie es oft einsam ist an der Spitze. Sie kann nie wissen, ob sich ihr Gegenüber für sie oder für ihre Funktion interessiert. Bevor sie Entscheidungen trifft, sammelt sie Informationen, sie muss permanent die politischen und menschlichen Konsequenzen ihres Tuns bedenken. Eine Diplomatin sollte nicht in erster Linie ihrem Instinkt vertrauen, aber sie darf in ihn auch nicht verlieren. Darin liegt eine grosse Herausforderung.
Die Gefängnisse auf der ganzen Welt sind mit Menschen gefüllt, die zu unrecht eingesperrt sind. Meist sind wir im scheinbar kultivierten Westen gezwungen, dies zähneknirschend hinzunehmen, auch wenn Unrecht und Willkür offensichtlich sind. Sie nehmen ein Schicksal stellvertretend in ihren Roman. Ein Schicksal, das ein „gutes“ Ende findet. Hätte es nicht ebenso viele Gründe gegeben, die „Befreiung“ scheitern zu lassen?
Noch vor dem ersten Satz war mir klar, dass dieses Buch mit Hoffnung enden wird. Hoffnung, die daraus entsteht, dass Menschen sich engagieren. Denn daran glaube ich, und es hat mich wirklich glücklich gemacht, während meiner Recherche solchen Menschen zu begegnen. Anwälte, Künstlerinnen, Journalisten und eben auch Diplomatinnen, die nicht aufhören zu kämpfen. Irgendwann kommt immer ein Sieg dabei heraus, und auch wenn es nur ein einzelner sein mag, ist dieser eine alles wert.
Hat Fred den Glauben an die Wirkung ihres Handelns nicht verloren? Und glauben Sie an eine positive Wirkung der Literatur?
Ich habe neulich gehört, dass mein Roman, in Verbindung mit Briefen an das Gericht, dazu beigetragen haben könnte, die drohende Abschiebung eines kurdischen Paares zurück in die Türkei zu verhindern. Sie wären nach ihrer Einreise dort direkt inhaftiert worden. Im besten Fall ist es so, dass Literatur den Blick auf die Welt oder auf einzelne Schicksale verändert und schärft. Wenn man sich mit diesem Anspruch ans Schreiben macht, hat man, glaube ich, einen guten Kompass für seine Arbeit.
 Lucy Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. Ihr Roman «Töchter» erhielt 2018 den Bayerischen Buchpreis, wurde in acht Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt.
Lucy Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. Ihr Roman «Töchter» erhielt 2018 den Bayerischen Buchpreis, wurde in acht Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt.
Beitragsbilder © Gerald von Foris



 Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.
Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt. Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.
Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.