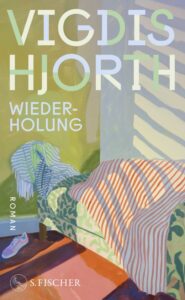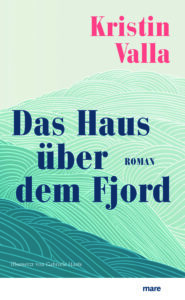Ach, wie wunderbar die norwegische Schriftstellerin Kristin Valla schreibend vom Schreiben erzählt! Man möchte ein Haus kaufen … aber erst einmal dieses Buch!
 Gastbeitrag von Frank Keil
Gastbeitrag von Frank Keil
Es gibt eine Art Schlüsselszene in Kristin Vallas wunderschönem Buch „Ein Raum zum Schreiben“, da kommt einiges mit einem Mal zusammen: das Gefühl, bald etwas Schwieriges geschafft zu haben, das Wissen, sie kann sich auf sich und sie kann sich auf die Welt verlassen, und eine tiefe Ruhe, auf der sich aufbauen lässt. Sie hat den Bus genommen, der vom Bahnhof aus fährt, in das kleine Dorf, in das sie muss; also sie hofft, dass er bis dorthin fährt, der Bus und sein Fahrer, die Schrift des Fahrplans ist so klein, dass sie die einzelnen, aufeinanderfolgenden Stationen nicht zu entziffern vermag, vermutlich fährt er nicht so weit, wie er für sie fahren muss. Und nun sitzt sie in dem Bus, der sie von Ort zu Ort schaukelt, längst ist es dunkel, am Ende ist sie der einzige Fahrgast, der noch in dem Bus sitzt, einen ganzen Bus hat sie für sich allein, und der Fahrer wird an den letzten Station, die er für heute anzufahren hatte, nicht anhalten, er wird weiterfahren zu ihrem Dorf, erst dort wird er stoppen, und er wird mit einem Lächeln sagen: „Ich konnte Sie ja nicht einfach da stehen lassen.“
Kristin Valla, die norwegische Schriftstellerin, die sich ein Haus in Südfrankreich angelacht hat, hat in diesem, ihrem Buch viel zu kämpfen: Wird sie es schaffen, sich einen Raum zum Schreiben zu besorgen, ihn zu gestalten und dann in ihm zu schreiben?
Gewiss, man denkt bei dem Buchtitel schnell an Virginia Woolf und ihr programmatisches Buch „Ein Zimmer für sich allein“, dass man als griffige Parole auch dann verwenden kann, wenn man es gar nicht gelesen hat – und natürlich werden wir noch Virginia Woolf begegnen. Erstmal aber geht es um einen Raum im umfassenden Sinne und bald um mehr als das: Es geht gleich um ein ganzes Haus, mit Küche und Badezimmer und Schlafgemach und über allem ein Dach, aus dem es leckt und tropft und rinnt, wenn es regnet, und es regnet auch in Südfrankreich oft und dann zuweilen recht ausgiebig, wie wir lesen werden, und kalt werden kann es auch, dass man sich alles anzieht, was man an Kleidung mitgebracht hat von daheim, wo man eigentlich lebt und wohnt und seine Familie hat (einen Mann, zwei Kinder, zwei Jungs).
Ein Haus lernen wir kennen, dass sich eine Schriftstellerin erst wünscht, dann sucht, dann kauft, auch wenn es Schulden-machen nach sich zieht (ihr Mann bürgt für den Kredit, aber es ist vor allem ihr Haus, ihr Risiko), und die dann nach und nach realisiert, was ein Haus zu besitzen bedeutet – um einen Ort für sich und ihr Schreiben erst zu finden und dann zu haben.

Aber erst einmal sind wir noch in Oslo, Kristin Valla, die recht erfolgreich als junge Schriftstellerin gestartet ist (gleich ihr erster Roman „Muskat“ wurde in mehrere Sprachen übersetzt, darunter ins Deutsche; auch der zweite Roman lief nicht schlecht), hat seit Jahren kein Buch mehr veröffentlicht und – was wichtiger ist – sie hat sei Jahres keines mehr geschrieben. Stattdessen hatte sie beizeiten für lange Zeit einen festen Job als Redakteurin angenommen; die Sicherheit, das monatliche Gehalt Jahr für Jahr, die Lebensverlässlichkeit, die damit einher geht, das hat nicht nur Charme, das ist auch gut, wenn man Kinder hat, die auf ihre Romane folgten. Nicht nur Schriftstellerinnen bleiben in dieser Falle hängen, aber meistens sind es doch die Frauen, denen es so ergeht. Immerhin hat sie diese Anstellung nun gekündigt, als wir lesend dazukommen, sie arbeitet jetzt frei und selbstständig für dieses und jenes Magazin, aber wer gut ist und wer schreiben kann, und das eine ist sie und das andere kann sie, der bekommt eben Auftrag nach Auftrag nach Auftrag, und auch so vergeht die Zeit. Literarisch schreiben? Es gibt da ein paar Ideen, auch Skizzen, erste Entwürfe, doch ein Buch wird daraus noch lange nicht. Man muss es auch schreiben.
Und dann gibt es diesen einen Abend (wieder ein Schlüsselmoment, wie überhaupt Schlüsselmomente sich durch dieses Buch ziehen), ein Abend, wo sie den großen amerikanischen Romancier John Irving moderieren darf, im örtlichen Literaturhaus, große Bühne also, viel Publikum. Und hinterher gehen sie etwas essen, das macht man so, ein junger Schriftsteller-Kollege kommt hinzu. Die beiden Männer unterhalten sich schnell über das Schreiben und also über das Leben, und sie hört still zu.
Und warum erzählt sie ihrerseits nichts, warum beteiligt sie sich nicht am Gespräch? Sie hätte durchaus etwas dazu beizutragen, sie ist doch eine von ihnen! Oder nicht oder nicht mehr? Und tief verstört über ihr eigenes sich-unwichtig-machen, geht sie nach diesem Abend-zu-dritt grübelnd nach Hause, und bald wird sie sich auf die Suche nach jenem Raum zum Schreiben machen, findet ihn in diesem seltsam verwohnten Haus in Südfrankreich (das einer Schweizer Familie gehörte, die es nicht mehr haben wollte, die es Hals-über-Kopf verliess, allen möglichen Krempel, liess die Familie zurück, nur weg! Ist das ein gutes Zeichen?) und dass sie nun gekauft hat, obwohl mehr als tausend Gründe dagegensprechen. Das Haus in seinem Zustand, etwa.
Sie wird viel weinen in diesem Haus. Und sie wird immer wieder aufstehen und sich die Tränen vom Gesicht wischen und dann irgendetwas machen: aufräumen (oder es wenigstens versuchen), die Wände streichen (die Küche etwa wird knallgelb), Vorhänge aufhängen (in einem Gebrauchtwarenladen erstanden und nicht bei IKEA, wie sonst manches, Decken und Kissen für das kommende Wohlbehagen); sie wird versuchen das Haus mal ordentlich durchzuwärmen, damit man es überhaupt in ihm aushält.
Und zwischendurch geht sie auf literarische Reisen und schaut nach schreibenden Frauen, die gleichfalls ein Haus oder manchmal auch ein ganzes Gehöft erworben hatten, in dem sie glücklich oder unglücklich wurden oder beides nacheinander oder beides zugleich: Tania Blixens und Suzanne Brøggers und Sigrid Undsets Häuser lernen wir kennen; das elterliche, zuvor in Konkurs gegangene Gut von Selma Lagerlöf wird uns nahegebracht; bei Marguerite Duras schaut Valla erzählend vorbei, die zeitweise einen alten Bauernhof auf dem Lande, eine Wohnung am Meer und noch eine Wohnung in Paris besass und die zwischendurch so runter war mit dem Leben und dann mit den Nerven, dass sie das Schreiben morgens mit dem Leeren einer ersten Flasche Rotwein begann, womit sie glücklicherweise eines Tages aufhörte. Und auch bei Virginia Woolf wird vorbeigeschaut (ebenso bei Doris Lessing, bei Patricia Highsmith, die zeitweise zurückgezogenst in einem verschrobenen Dorf lebte, ohne Laden, ohne Bäcker, ohne Schlachter), und immer wieder wird sie von diesen Ausflügen zurückzukehren in ihr eigenes Haus, immer auch ein wenig mehr als erholt, manchmal geradezu gestärkt von den imaginierten wie recherchierten Besuchen in den Leben und in den Häusern der Anderen.
Und wie sie davon erzählt, wie sie zwischen den Orten und den Leben schreibender und Häuser-besitzender Frauen hin und her switcht, das ist einfach ganz wunderbar, wie es überhaupt sehr tricky ist, dass Kristin Valla gar nicht viel über ihr Schreiben schreibt. Nicht, an was sie arbeitet, was das Thema ist, erfahren wir; was die Geschichte ist, die sie entwickelt, die Handlungsstränge, die sie auslegt, die Erzähl-Perspektiven, mit denen sie experimentiert, womöglich, solche Sachen. Kaum bis wenig bis zuweilen nichts wird davon erzählt, nur dass ein Roman erscheinen wird (der erste seit sechzehn Jahren!) erzählt sie uns zum Ende hin, als sie sich eingelebt hat in ihrem Haus, auch in dem Dorf, das zum Haus gehört, zu dem sie von Norwegen aus das Flugzeug nehmen muss und dann den Mietwagen, Oslo liegt nun mal nicht gerade um die Ecke, und in den Ferien kommt die Familie mit und stört sich nicht an dem Chaos, das sie umgibt, sondern genießt das sanfte Durcheinander, dass sie selbst so oft in den Wahnsinn wirft.
Stattdessen erfahren wir viel über feuchte Wände, in denen der Schimmel steckt, wie zu riechen ist, kaum ist man durch die Tür und hat man eingeatmet. Über Steckdosen, die nicht angeschlossen sind, schreibt sie; über Deckenbalken, die ausgetauscht werden müssen, was nicht so einfach ist, wenn es um darunter stehende, tragende Wände geht, was man da macht. Aber sie beisst sich durch, Kristin Valla wird eine richtige Handwerkerin (gleich zu Anfang kauft sie sich einen Bohrer und eine Latzhose), durchsetzungsstark auch gegenüber den professionellen Handwerkern, die sie immer wieder engagieren muss, weil das Haus mit seinen Schäden und Macken schlicht eine Nummer zu gross für sie zu seien scheint.
Und wenn sie so ziemlich gen Schluss, so viel soll verraten werden, kurz davor ist, dieses Haus zu verraten, fügt sich alles auf wundersame Weise, und man liest dieses Buch mit immer wachsendem Vergnügen und immer öfter ist da dieser heimlicher Gedanke, man sollte sich auch ein Haus kaufen oder wenigstens eines mieten, manchmal, vielleicht.
Kristin Valla, aufgewachsen im norwegischen Nordland, ist Autorin, Journalistin und Lektorin und schreibt u. a. für das Dagbladet Magasinet und das Kulturmagazin K der Zeitung Aftenposten. Mit ihrem Roman «Das Haus über dem Fjord» eroberte sie 2022 die Herzen deutscher Leserinnen und Rezensentinnen.
Gabriele Haefs, geboren am Niederrhein, studierte Volkskunde, Vergleichende Sprachwissenschaft und Keltologie. Heute lebt sie in Hamburg und ist seit vielen Jahren freie Autorin und Übersetzerin u.a. aus dem Irischen und Norwegischen. Ihre Arbeit wurde vielfach prämiert, u.a. mehrmals mit dem Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzungen.
Beitragsbild © Julie Pike