Florian Wacker zieht mich mit seinem neuen Roman „Weiße Finsternis“ in Schnee und Eis, auf eine lange, lebensgefährliche Reise durch den arktischen Winter, eine Reise um Leben und Tod, eine Reise weit über Grenzen hinaus.
1918 wurden Peter Tessem und Paul Knutsen, zwei junge norwegische Seefahrer, vom Polarforscher Roald Amundsen angewiesen, scheinbar unentbehrliche wissenschaftliche Aufzeichnungen und die Post durch einen arktischen Winter zu tragen. Amundsens Schiff, die Maud, war vom Eis eingeschlossen. Für Peter und Paul sollte es eine Reise ins Ungewisse, eine Reise in die unendliche Weite der arktischen Eis- und Schneewüste, eine Reise ins langsame Sterben werden.
Peter und Paul waren Freunde seit Kindertagen, beide in der norwegischen Hafenstadt Tromsø aufgewachsen, wo sie seit Kindesbeinen grosse und kleine Schiffe ins weisse Abenteuer wegsegeln sahen. Peter wurde Tischler, Paul Seemann. Zu den beiden Jungen gehörte Liv, in Kindertagen Kameradin, in der Jugend Freundin, später von beiden geliebt und umgarnt. Am liebsten hätten sie gemeinsam das Abenteuer gesucht. Aber weil sich Nachwuchs einstellte und Liv für ihre Familie einen sicheren Hafen wünschte, war es Peter, den sie heiratete, mit dem sie ein Haus in Tromsø bezog. Peter, Liv und die beiden Kinder. Und irgendwo Paul, die unruhige Seele, die sich nicht mit einem Leben ohne Bedeutung begnügen wollte. Auch das Meer blieb. Paul kam immer wieder zurück. Und als Roald Amundsen in Tromsø eine neue Crew für seine Forschung Richtung Nordpol suchte, schifften Peter und Paul mit ein, beide getrieben von der Hoffnung, im Schatten des grossen Forschers Ruhm, Ehre und eine sichere Zukunft zu erlangen.
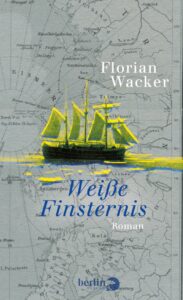
Zwei Jahre später, jedoch nicht im arktischen Winter, machte sich eine Gruppe Männer unterstützt durch Einheimische auf die Suche nach den Vermissten. Keine Suche, die auf Leben hoffte, auch wenn ein kleiner Rest Zweifel über deren sicheren Tod geblieben war. Aber eine Suche, die Antworten schaffen sollte und wohl nicht zuletzt ein Tribut des Gewissens den beiden jungen Männern gegenüber war. Man machte sich auf, hoffte auf Zeichen in Eis und Schnee, auf Zeugnisse, die in der weissen Einöde überdauern würden.
Florian Wacker will nachspüren, was es ist, dass Menschen an den Rand der Möglichkeiten und darüber hinaus nötigte. War es wirklich nur die Gier nach Ruhm und Ehre? Die Schlachtfelder des grossen Krieges schluckten die Massen ebenso wie Arbeit, Mühsal und Armut. Paul war schon als Kind vom Entdeckerhunger getrieben und Peter, eigentlich viel ruhiger und besonnener, stets mitgerissen. Dieses Mal würde es der eisige Norden sein, später dann die weissen Flecken auf der Karte Südamerikas. Oder war es einfach die Lust aufzubrechen aus dem Nest Tromsø, dem Einerlei, dem Vorbestimmten?
Aber Florian Wacker geht es nicht bloss um das Nacherzählen einer Geschichte, von der man bis heute vieles nur spekulieren kann. Die beiden jungen Männer waren Freunde, brachen gemeinsam zur Reise auf, liessen ihr Leben aber an verschiednen Orten im Eis. Was geschah zischen den beiden ungleichen jungen Männern? Was trug sich zu, als immer aussichtsloser wurde, was eine Heldentat hätte werden sollen? Und wie muss es Liv ergangen sein, die zurückblieb, die irgendwann aufgegeben hatte zu warten und von Tromsø wegzog, weil es dort kein Leben gab für eine Zurückgelassene. Was bleibt von Freundschaft, wenn man durch die Ketten von Pflichten und Mutterschaft zum Bleiben gezwungen wird? Die Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben nicht einfach diktieren lassen wollte!
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schien hinter der weissen Finsternis eine Verheissung zu liegen. Eine Verheissung, der viele Menschen ungenannt ihr Leben opferten.
Es wurde mir kalt bei der Lektüre. Florian Wacker ist ein Meister der Atmosphäre!
Interview:
Indirekt stellen Sie mit ihrem Roman die Frage, was Männer wie Roald Amundsen, Robert Falcon Scott oder Ernest Shackleton bewegte, sich mit Mannschaft und Material Gefahren auszusetzen, die aus der Sicht eines Menschen in unserem Jahrtausend halsbrecherisch, tödlich sein mussten. Warum zieht es Menschen auf Mond und Mars obwohl es unwahrscheinlich ist, dass der Nutzen für die Menschheit den finanziellen und menschlichen Aufwendungen entspricht?
Ich glaube, dass Menschen immer nach neuen Herausforderungen suchen, nach neuen Zielen und danach, Grenzen weiter zu verschieben; die Entdeckung Amerikas, die Erkundungen der Pole, die Expedition in die Regenwälder, und als Krönung sicher die Landung auf dem Mond: Menschen suchen die Extreme, die Ausweitung des Bekannten, weil sie neugierig, erfinderisch, kreativ – und auch zutiefst egoistisch sind. Es ging ja auch immer darum, der Erste zu sein, ein Wettrennen zu bestreiten und sich am Ende den Siegeskranz umzuhängen; diesem Ziel wurde alles untergeordnet, und es sind immer nur einzelne Namen, die dann herausstechen – Amundsen, Nansen usw. Die vielen Unbekannten, die diese Wettrennen z.T. mit ihrem Leben bezahlten, von denen spricht heute kaum noch jemand. Auch deshalb erzähle ich in meinem Roman die Geschichte zweier Unbekannter, um den Blick auf sie zu lenken, weg von den strahlenden Helden. Durch sie, diese meist Namenlosen, wurden die Expeditionen und daraus gewonnenen Erkenntnisse erst möglich.
Männer wollten entdecken, machten sich auf über Grenzen, über Bekanntes hinaus. Frauen blieben zuhause, im Hintergrund, die Erwartenden, die Geduldigen. Ist „Eroberung“ männliches Prinzip oder verfängt man sich mit der Frage allein in den Schlingen gefährlicher Argumentationen?
Dieses Prinzip ist historisch gewachsen, ich würde es heute nicht mehr gelten lassen. Früher waren die Verhältnisse so, dass Männer hinaus in die Welt gingen (Arbeit, Reisen usw.) und Frauen zuhause bei den Kindern und Alten blieben. Das wurde nur sehr langsam durchbrochen. Frauen erkämpften sich gegen grosse Widerstände nach und nach ihre Rechte (Wahlrecht usw.), aber das Bild der „sorgenden“ Frau trägt sich bis heute durch, was man gerade während der Pandemie gut beobachten kann, wo es meistens Frauen sind, die zuhause den Laden am Laufen halten, also Sorgearbeit leisten, und dazu noch einer Erwerbsarbeit nachgehen. Das Prinzip männlicher „Eroberung“ halte ich heute für einen Anachronismus, für längst überholt. In meinem Roman beginnt sich Liv auch gegen dieses Prinzip zu wehren, sie will nicht warten, nicht die Rolle spielen, die man ihr zuschreibt.

Konde, ein Nganasane, ein Polarmann sagt: „Die Leute aus dem Westen und Süden. Sie haben keine Ahnung von den Rentieren, sie können nicht jagen und wissen auch mit der Kälte nichts anzufangen. Aber sie kommen trotzdem und beschweren sich und schimpfen über das Eis, und dann sterben sie. So ist es immer.“ Waren Ignoranz und Arroganz nicht schon bei der Franklin-Expedition 60 Jahre zuvor auf der Suche nach einer Nordwestpassage die Ursache des Scheiterns?
Ja, Ignoranz und Arroganz waren sicher verantwortlich für das Scheitern grosser Expeditionen, wo mit immensem Materialaufwand versucht wurde, ein Ziel gegen alle Widerstände zu erreichen; so ähnlich wie ein trotziges Kind, das mit dem Kopf durch die Wand will. Man hielt sich für überlegen und die Inuit für einfältige Wilde. Tausende sind auf den Schiffen jämmerlich umgekommen, verhungert, erfroren, an Skorbut gestorben. Erst Nansen und Amundsen begannen, sich von den Einheimischen Verhaltensweisen abzuschauen, trugen entsprechende Kleidung, fuhren mit kleinen, wendigen Schiffen, nutzten Schlittenhunde. Aber auch sie waren nicht frei von Arroganz und einem Gefühl der Überlegenheit, sie traten in ihrem Eroberungsdrang nur etwas subtiler auf.
Sie schildern eine Freundschaft, die im Angesicht des Todes zu zerbrechen droht. Weil im Wahn durch Unterernährung, Entkräftung und Hoffnungslosigkeit alles aufbricht. Nicht zuletzt Eifersucht, Enttäuschung und Verdächtigung. Klar, Literatur labt sich an Extremen, selbst wenn Karl Ove Knausgård über die absolute Normalität schreibt. Ist Lesen die Gier nach fremdem Leben?
Ich denke schon, dass wir beim Lesen immer auch etwas vom Anderen, vom Gegenüber erfahren wollen. Da wird dann selbst das „Gewöhnliche“ wie bei Knausgård aufregend; ein gewisser Voyeurismus ist ja beim Lesen immer dabei; der Blick in fremde Leben, in Existenzen, die mit unseren auf den ersten Blick nichts gemein haben. Gute Literatur schafft dann beides: Den Blick auf das Gegenüber, der uns aber immer auch zu uns zurückführt.
„Weiße Finsternis“ spielt in der absoluten Kälte. Ihr Roman zuvor, „Stromland“ in schweisstreibender Hitze. Welches Verhältnis haben Sie zur Extreme? Ist Schreiben ein Zustand der Extreme?
Schreiben ist nur in seltenen Momenten ein Extrem im Sinne eines Rausches; es ist meist monoton, wenig aufregend, man arbeitet sich Tag um Tag durch den Text, schreibt, überarbeitet, schreibt wieder. Da ist viel Routine drin, strukturiertes Arbeiten. Aber klar, manchmal gibt es diese Situationen, in denen es einen plötzlich packt, in denen plötzlich alles stimmt, jedes Wort, jeder Satz und man wirklich in einen rauschähnlichen Zustand gerät. Meist hält der nicht lange, spätestens beim Überarbeiten ist dann Schluss damit. Aber trotzdem, es sind diese Momente, für die ich auch schreibe.
Welches Buch würden Sie unbedingt empfehlen und warum?
Die Romane von William Faulkner, die Texte sind überwältigend, anstrengend, dicht. Aktuell beeindruckt hat mich „Die Dame mit der bemalten Hand“ von Christine Wunnicke, ein schmaler, historischer Roman voller Witz und Poesie, grossartig!

Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, Studium der Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Mehrjährige Tätigkeit in der Kinder-und Jugendpsychiatrie, der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe. Er schreibt Prosa, Dramatik und Code und veröffentlicht Texte in FAS, Merian, Frankfurter Rundschau, Junge Welt, BELLA triste, Das Magazin u.a.
Für seine Arbeiten wurden er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Robert Gernhardt Preis, dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg, dem Limburg-Preis und dem „Feuergriffel“ für Kinder- und Jugendliteratur Mannheim.
Rezension von «Stromland» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Melina Mörsdorf Photography

