Das Buch lag in Evas Schoss. – Ingeborg Bachmann schaut auf Fotos nicht selten auf den Boden, ging es Eva beim Betrachten des Umschlags durch den Kopf. Und: Ist es Scheu, die sie so blicken lässt?
Ein weisser Fleck vor der Scheibe des langsam fahrenden Zugs liess Evas Kopf nach rechts schnellen. Ein weisser Esel stand da, kurz vor Arth Goldau. Genau da, wo am 2. September 1806 der Rossberg zu Tal gefahren war und drei Dörfer mit 457 Menschen, 323 Stück Vieh, ihren Häusern und Kirchen unter sich begraben hatte.
Der weisse Esel blickte nach Osten. Keine drei Meter von ihm entfernt, Steiss gegen Steiss, stand auf einem kuppelförmigen Stück Grünfläche ein schwarzer Esel und blickte nach Westen. Zwischen Häuserfassaden, Geleisen und Brocken von Urgestein ein Bild wie aus der Zeit geschnitten.
Die Lokomotive zog an. Der Wagen, in dem Eva sass, tauchte ein in eine dunkle Tunnelöffnung, um kurz darauf am Bahnhof zu stoppen. Evas Körper ruckte in die Gegenwart zurück. Sie hörte den Rentner mit dem spärlichen Blondhaar im Abteil rechts schräg vis-à-vis vor sich zu seiner Frau sagen, indem er Satzteile aus dem Magazin mit eigenen Gedanken mengte:
«Das gloubsch jo ned, de Ueli Murer zeigt sis wohre Gsecht. Das Staatsoberhoupt het vo de Krise be de CS Bank gwösst ond nüt onderno.»
Seine Frau genervt: «Die spenne jo! So eine aus Bondesrot z’ wähle.»
Ihr Mann, mit Ironie in der Stimme: «Met em Xi Jingping hett er öberus fröndschaftlechi Gspröch gfüehrt. Ond d’ Finanzmineschter vo Saudi Arabien ond Katar het er 2022 ou bsuecht, för bilaterali Gspröch zo pikante Theme.»
Seine Lippen kräuselten sich erneut, bevor er tiefernst anhängte: «Ond denn esch er chorz druf, öberraschend z’roggträte. Das get’s jo ned!»
Er vertiefte sich wieder in das Magazin.
«Hey, so cool», drang plötzlich seine Frau in seine Lektüre ein, «do vore esch grad de Papscht igstege! E Voralpe-Expräss! Dass ich das darf erläbe. – Do esch aues dra», warf sie nach ein paar Minuten wieder ein. «Wahnsenn! De muess i fotografiere.»
Sie ging nach vorn zum Wagenausgang. Der Papst sass in seinem weissen Papamobil. Es war Schmutziger Donnerstag. «So cool, Herr Papscht!»
– «Wie mer’ s aluegt,» grinste der Kirchenfürst. Der gutaussehende Mittfünfziger läutete mit einem Glöcklein und liess sich fotografieren. Eva bemerkte mehrere gedrehte Hälse von Passagieren, die sich wie sie nach dem gelungenen «Fasnachtsgrend» umsahen.
Evas Gedanken kehrten zurück zu Ingeborg Bachmann und deren Erzählung «Der Kommandant». Die Schriftstellerin erzählt in diesem Text von einem Mann, der aus schwerem Schlaf erwacht und sich nicht mehr zurechtfindet. Verängstigt will er Licht machen, aber die Müdigkeit ist zu gross.
S., nennt die Autorin diesen Mann, der im Traum ohne Ausweispapiere auf einer tiefroten, breiten Strasse singend Richtung Grenze ausschreitet und ohne Legitimation zum neuen Kommandanten avanciert. Einem Kommandanten, der vergeblich seine Identität sucht und dabei zu einem herrschsüchtigen Anführer mit demütigen Befehlsempfängern wird, die ihm, dasselbe Liedchen auf den Lippen, munter in der Kolonne folgen.
Vom Wagenausgang her ertönte erneut das Glöcklein. Der Papst war aus dem Papamobil gestiegen und schüttelte seine Glieder. Goldene Plaketten um seinem Hals stiessen aneinander und erzeugten Klänge, die an die Segnung des Opfers vor der Kommunion erinnerten.
Von diesem Augenblick an galt Evas ganze Aufmerksamkeit dem faszinierenden Papst. In Luzern, an der Endstation, fotografierte sie den Fasnächtler mit seinem Papamobil beim Aussteigen aus dem Voralpen Express. Mühevoll war sein Gesichtsausdruck dabei.
An der Bushaltestelle fragte sie den Fahrer, ob das der richtige Bus nach «Möischter» sei. Der Ausländer schaute Eva aus dunklen, erloschenen Augen an. Er verstand nicht, was sie wollte. «Beromünster», wiederholte sie auf Hochdeutsch. Er nickte ausdruckslos. Unwillig stellte Eva fest, dass die Namen der Bushaltestellen ihm nichts sagten. Ja, der ganze Rummel dieses Landes vermochte ihn auch am Tag des Urknalls, wie die Luzerner ihren Fasnachtsbeginn nennen, nicht zu berühren.
Sie nahm gleich rechts vom Fahrer hinter der Frontscheibe Platz. Ausgangs Luzerns schweifte ihr Blick aus dem Fenster und blieb an einer alten ovalen Tafel aus gut erhaltenem, lackiertem Nussbaumholz haften, die ein geschichtsträchtiges Haus zierte. Darauf stand die Inschrift «Deo et Pauperibus».
Sie vergewisserte sich auf ihrem Handy, ob sie die Inschrift mit «Gott und Armut» richtig übersetzte, las den Eintrag «Pauperismus (von lateinisch pauper «arm») bezeichnet die zunehmende Verarmung der Arbeiterschicht und die Verelendung großer Bevölkerungsteile unmittelbar vor der Industrialisierung». –
Sie blickte mitfühlend zum Chauffeur und dachte, der Mann hat andere Sorgen im Kopf als die Fasnacht und Ortsnamen, die ihm nichts bedeuten.
Der Bus fuhr an einer grünen Ampel vorbei und tauchte in den Tunnel ein.
Der Lenker fuhr in dem engen Stollen auf der rechten Spur. Eva schaute aus dem Fenster. Angst durchzog sie, weil die Räder des Fahrzeugs haarscharf an der Trottoirkante im dunklen Strassenrand klebten. Zum Glück war das unterirdische Autobahnstück nur kurz: Eva atmete auf.
Der Bus fuhr durch graue Peripherie, an der da und dort farbige Fasnachtswagen standen und diverse Maskenträger – Indianerhäuptlinge und aufgetakelte Blondinnen schienen nie aus der Mode zu kommen – die Strasse kreuzten.
Auf der linken Strassenseite fiel ihr der starke Gegenverkehr stadteinwärts auf.
Aus einer Seitenstrasse kamen drei breite Militärfahrzeuge. Der Bus hielt nach rechts und holperte über eine Trottoirkante. Der Fahrer hat Angst vor Gegenverkehr, dachte Eva sofort. Sie betrachtete die schweren Hände am Steuer. Die um das Rad geballte Rechte des Lenkers zog wieder nach rechts. Noch zweimal überfuhr der Bus die Fussgängerkante. Erst als sie die städtische Agglomeration Wiesland erreichten, beruhigte sich der Fahrstil. Evas Gedanken tauchten ein in die Zeit des Jugoslawienkriegs. Sie sah den Fahrer im Morgendämmer an Trümmern und toten Menschen vorbei westwärts flüchten. –
Fürchtet der Fahrer Gegenverkehr aus vergangenen Tagen? Das könnte gefährlich werden!
Du hängst mittendrin im Zeitrad der Geschichte, dachte sie. Dieses Rad dreht zu schnell, weil sein Treibstoff das Produkt unverdauter Konflikte ist.
Beatrice Häfliger studierte Soziale Arbeit, Philosophie und Soziologie. Modellieren, zeichnen und schreiben prägen seit 1990, ihrem Umzug ins Toggenburg, ihren Künstleralltag. 2019 erschien anhand von Zeichnungen aus der Erinnerung ihr Debütroman «Das Mädchen mit dem Pagenschnitt». Er wurde mit einem Werkbeitrag gefördert und von Ruth Schweikert lektoriert. Aktuell ist sie auf der Suche nach einem neuen Verlag für ihr zweites Buch «Eva blickt zurück», vom Magnetismus des Schicksals.
Beitragsbild © Stefan Bösch




 Gastbeitrag von Urs Abt
Gastbeitrag von Urs Abt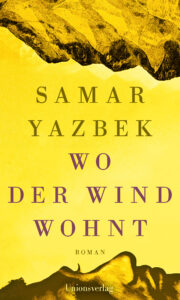
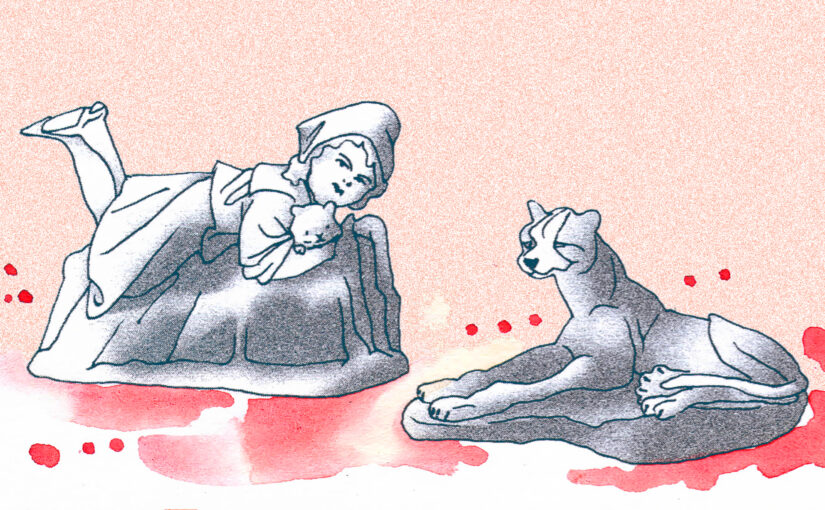
 Horst-Werner Klöckner, 1952, hat Philosophie und Deutsch studiert, arbeitete als Pfleger, Physiotherapeut und Osteopath, war Lehrer für Physiotherapie und für Osteopathie unterwegs, als Osteopath immer noch beschäftigt. 2011 Erzählung „
Horst-Werner Klöckner, 1952, hat Philosophie und Deutsch studiert, arbeitete als Pfleger, Physiotherapeut und Osteopath, war Lehrer für Physiotherapie und für Osteopathie unterwegs, als Osteopath immer noch beschäftigt. 2011 Erzählung „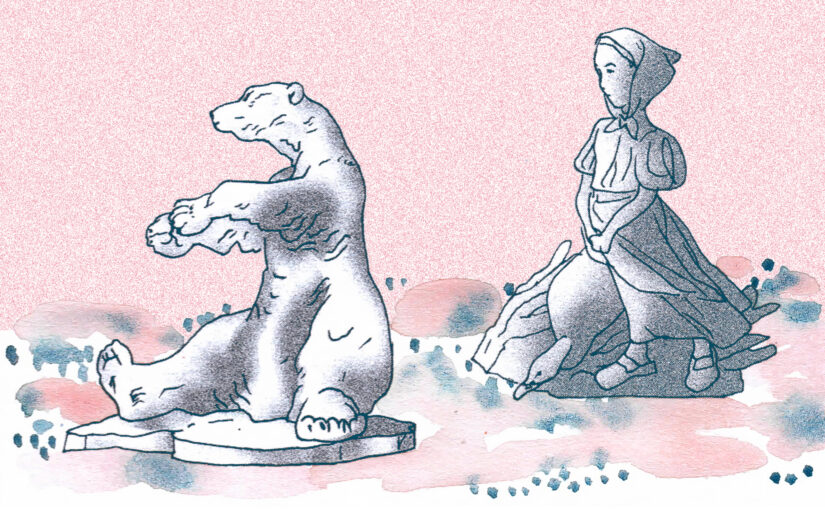
 Gabriela Cheng-Voser, schreibt vor allem in Mundart lyrische Texte, 2022 mit «Acht Gramm» in der Shortlist des 27. Deutschen Kurzgeschichtenwettbewerb, 2022 Literaturblatt.ch „gluät of dä huut“, unschöne Weihnachtsgeschichten, 2023 «Realisierbar Steinen», erstmalige musikalisch untermalte Lesung im Duo Iggy&Nic, 2024 Texte von 10 Autor:innen zum Thema „Generationen“.
Gabriela Cheng-Voser, schreibt vor allem in Mundart lyrische Texte, 2022 mit «Acht Gramm» in der Shortlist des 27. Deutschen Kurzgeschichtenwettbewerb, 2022 Literaturblatt.ch „gluät of dä huut“, unschöne Weihnachtsgeschichten, 2023 «Realisierbar Steinen», erstmalige musikalisch untermalte Lesung im Duo Iggy&Nic, 2024 Texte von 10 Autor:innen zum Thema „Generationen“.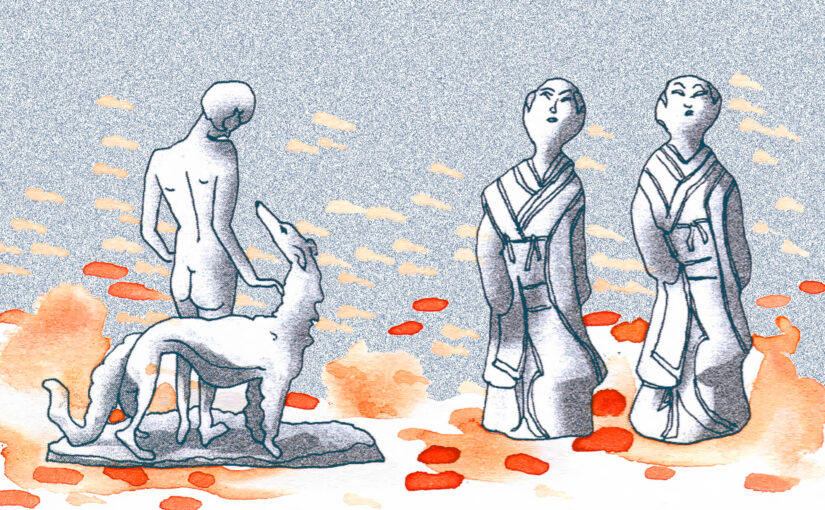
 Flavia Naef, 1991, arbeitet seit jeher mit Sprachen und Büchern. Zurzeit besucht sie den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich.
Flavia Naef, 1991, arbeitet seit jeher mit Sprachen und Büchern. Zurzeit besucht sie den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich.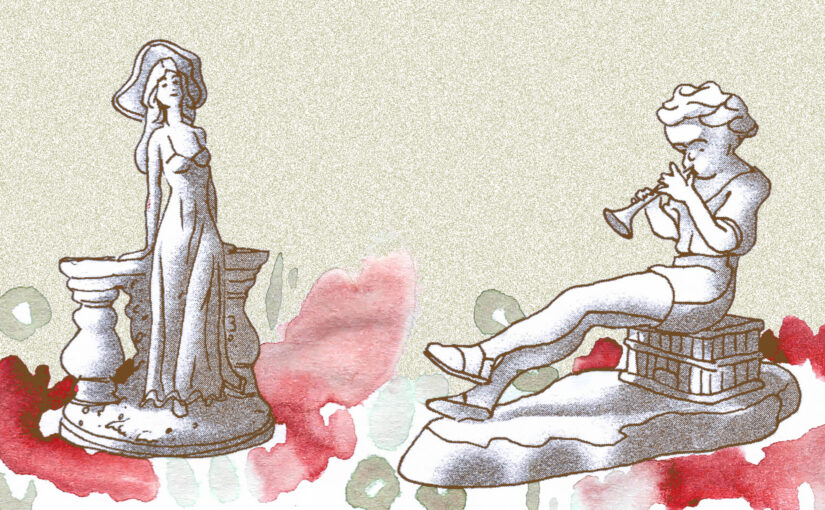
 Ruth Geiser, 1956, Ausbildung zur Primarschullehrerin, ab 1983 Studium an der Universität Zürich, 1984 Diagnose Parkinson, 1989 Abschluss in Geschichte, Anglistik und Europäische Volksliteratur, 2005 Aufgabe der Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen. Sie schreibt Gedichte, Kurzgeschichten, sowie autobiografische Texte.
Ruth Geiser, 1956, Ausbildung zur Primarschullehrerin, ab 1983 Studium an der Universität Zürich, 1984 Diagnose Parkinson, 1989 Abschluss in Geschichte, Anglistik und Europäische Volksliteratur, 2005 Aufgabe der Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen. Sie schreibt Gedichte, Kurzgeschichten, sowie autobiografische Texte.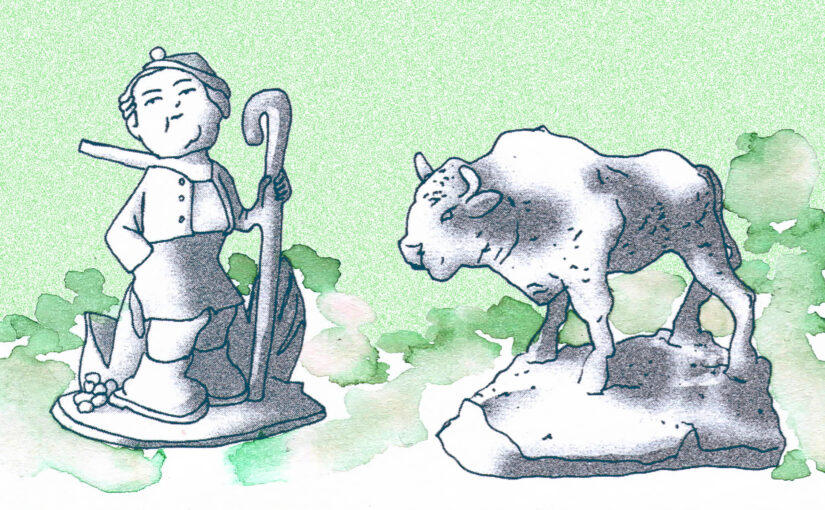
 Daniel Zahno, 1963 , lebte zehn Jahre in New York. Clemens-Brentano-Preis, Preis der deutschen Wirtschaft, Freiburger Literaturpreis. Stipendiat Ledig House New York, Writer-in-Residence Deutsches Haus New York University, Stipendiat Istituto Svizzero Venedig. Zuletzt erschienen: «Mama Mafia», «Manhattan Rose», «Die Geliebte des Gelatiere». Arbeitet an den Prosa-Miniaturen «Sinfonie der Flöhe».
Daniel Zahno, 1963 , lebte zehn Jahre in New York. Clemens-Brentano-Preis, Preis der deutschen Wirtschaft, Freiburger Literaturpreis. Stipendiat Ledig House New York, Writer-in-Residence Deutsches Haus New York University, Stipendiat Istituto Svizzero Venedig. Zuletzt erschienen: «Mama Mafia», «Manhattan Rose», «Die Geliebte des Gelatiere». Arbeitet an den Prosa-Miniaturen «Sinfonie der Flöhe».



 Katharina Michel-Nüssli, 1964, war früher Primarlehrerin, ist heute freiberuflich tätig. Ihr erstes Buch «Sommersprossen und Kondensstreifen» enthält Kurzgeschichten, Miniaturen und Gedichte. Bisher hat sie bei der «Goldenen Schreibfeder» in Bischofszell TG zwei Preise für ihre Texte gewonnen. Der Text «Feierabend» erschien in einer Anthologie. «Heimweg» wurde vom Schulmuseum Amriswil prämiert. Erstmals plant sie ein Schreibprojekt über Kindheitserfahrungen ihres Vaters und seiner Geschwister.
Katharina Michel-Nüssli, 1964, war früher Primarlehrerin, ist heute freiberuflich tätig. Ihr erstes Buch «Sommersprossen und Kondensstreifen» enthält Kurzgeschichten, Miniaturen und Gedichte. Bisher hat sie bei der «Goldenen Schreibfeder» in Bischofszell TG zwei Preise für ihre Texte gewonnen. Der Text «Feierabend» erschien in einer Anthologie. «Heimweg» wurde vom Schulmuseum Amriswil prämiert. Erstmals plant sie ein Schreibprojekt über Kindheitserfahrungen ihres Vaters und seiner Geschwister.