In irgendeiner Weise werden Indianer immer zu Helden. Wohl am meisten bei Kindern in Geschichten, Bilder von Indianern, später aus Filmen und noch später gar mit angelesen Ideologiefetzen. So sehr das Indianersein verklärt und glorifiziert wird, so sehr leidet der Indianer selbst an der Wirklichkeit.
«Ein Urgrossvater, dessen Identität nicht zweifelsfrei feststand, konnte mir keine Heimat sein; wenn es um Herkunft ging, konnte man nicht sagen ich glaube, Herkunft musste eindeutig sein.»
Er, der erzählt, weiss nicht wirklich, warum er die Reise in den us-amerikanischen Norden, nach Washakie im Bundesstaat Wyoming macht, erst recht nicht mehr, nachdem er von der Reise zurückgekehrt zu schreiben beginnt, unsicher darüber, ob mehr gewonnen oder nicht viel mehr das wenige zerstört wurde. Zum einen war da die Recherche, ein paar Wochen abgeschiedenes Leben in einer Hütte im kanadischen Manitoba, zum andern die Lust nach Klarheit über eine Familienlegende, nach der die Urgrossmutter einen stolzen indianischen Krieger vom Stamm der Arapaho zum Mann nahm und er nun als Achtelindianer wissen wollte, ob nachzuforschen sei, was aus dem verlorenen Familienteil geworden war. Andererseits war die Reise eine Flucht vor den emotionalen Wirren um die Trennung von seiner Frau Hanna. «Wie konnten sich zwei Menschen, die ihr Innerstes in gemeinsame Schwingungen versetzen konnten, nicht mehr lieben? Ich weiss es nicht. Aber wir konnten es. Wir konnten einander nicht mehr lieben.» Und dann noch sein ebenfalls schreibender Sohn, der mit seinem Erstling jenen Erfolg hatte, der ihm zu fehlen schien.
 Ein Mann, der sich abkoppelt, nun auf der Suche nach Herkunft, weil die Gegenwart zu kollabieren drohte, auf den Spuren seiner Herkunft, die letztlich auch nicht durch Stammbäume und Gentechnik zu klären sind. Und nicht zuletzt eine Flucht mit Fluchthelfern, Tabletten gegen Herzrhythmusstörungen, Hilfe für einen aus dem Tritt geworfenen, der als Preis dafür mit langen, heftigen und fremden Träumen zu kämpfen hat. Vater und Sohn weit voneinander entfernt, verbrüht durch Verletzungen, falsch verstanden und im entscheidenden Moment alleine gelassen. Für mich als Leser vielleicht eine der stärksten Szenen im Roman: Der Vater früher zurück aus den Staaten an der Preisverleihung zu Ehren seines Sohnes schlussendlich sitzen gelassen, weil die Festgesellschaft ohne ihn weitergezogen war.
Ein Mann, der sich abkoppelt, nun auf der Suche nach Herkunft, weil die Gegenwart zu kollabieren drohte, auf den Spuren seiner Herkunft, die letztlich auch nicht durch Stammbäume und Gentechnik zu klären sind. Und nicht zuletzt eine Flucht mit Fluchthelfern, Tabletten gegen Herzrhythmusstörungen, Hilfe für einen aus dem Tritt geworfenen, der als Preis dafür mit langen, heftigen und fremden Träumen zu kämpfen hat. Vater und Sohn weit voneinander entfernt, verbrüht durch Verletzungen, falsch verstanden und im entscheidenden Moment alleine gelassen. Für mich als Leser vielleicht eine der stärksten Szenen im Roman: Der Vater früher zurück aus den Staaten an der Preisverleihung zu Ehren seines Sohnes schlussendlich sitzen gelassen, weil die Festgesellschaft ohne ihn weitergezogen war.
«Manitoba» ist jenseits aller Rührseeligkeit auch ein Buch über die Begegnung mit Indianern, die unter dem Deckmantel der Missionierung von Menschen mehr als nur zu leiden hatten. Vielleicht auch von der aus der innerschweizerischen Enge geflohenen Urgrossmutter des Erzählers. Indianer, die für ihr Anderssein bestraft wurden. In nordamerikanischen Schulen, in der die Urgrossmutter unterrichtete, schon dafür, dass die Kinder heimlich in der Sprache ihrer Eltern flüsterten. Was waren die Beweggründe jener Frau damals? Warum reiste sie wenige Jahre später wieder zurück ins Stauffacherdorf Steinen im Kanton Schwyz? Während er fährt, nachfragt und sucht, liest er Urgrossmutters spätes Tagebuch, einen niedergeschriebenen Erklärungsversuch, den sie als alte Frau kurz vor ihrem Tod niederschrieb und Quell vieler neuer Geheimnisse wurde.
Linus Reichlin spannt den Bogen von Steinen bis in die Wälder Kanadas, von den Alteingesessenen hier und da. Ein Buch über die Hoffnung nach klärender Distanz und distanzierter Klärung, ein Protokoll des Schreibens und Scheiterns, darüber, dass eben doch nur Geschichten ein Ende haben.
 Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman »Die Sehnsucht der Atome« erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman »Der Assistent der Sterne« wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010/Kategorie Unterhaltung gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman »Er« schrieb der Stern »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien »Das Leuchten in der Ferne«, ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan – »das ist große Literatur, und dann auch noch spannend erzählt« (FAZ).
Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman »Die Sehnsucht der Atome« erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman »Der Assistent der Sterne« wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010/Kategorie Unterhaltung gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman »Er« schrieb der Stern »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien »Das Leuchten in der Ferne«, ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan – »das ist große Literatur, und dann auch noch spannend erzählt« (FAZ).




 Kunst sein, Kunstwerk. Bei jeder anderen Kunstgattung ist die mögliche Provokation mit eingeschlossen. Und ausgerechnet in der Literatur gibt man sich dupiert, ja fast beleidigt, wenn man als Leser und erst recht als Kititker verunsichert wird. Dabei sind Autoren wie Christian Kracht genau das, wonach es schreit; Autoren, die wagen, die verunsichern, irritieren, vielleicht sogar polarisieren. Und die Kritik ist irritiert. Irritiert von der Geschichte, weil sich Christian Kracht nicht um Konventionen und Gepflogenheiten zu kümmern scheint. Irritiert vom Ton, der sein Schreiben so eigen-artig macht. Irritiert, weil man vergeblich nach einer Message sucht, weil Verunsicherung zum Programm gehört. Irritiert, weil sich Christian Kracht auch schon nach seinem letzten Roman «Das Imperium» nicht um die kruden Behauptungen eines Spiegelberichts kümmerte, der seinem Schreiben einen Rechtsdreh andichten wollte.
Kunst sein, Kunstwerk. Bei jeder anderen Kunstgattung ist die mögliche Provokation mit eingeschlossen. Und ausgerechnet in der Literatur gibt man sich dupiert, ja fast beleidigt, wenn man als Leser und erst recht als Kititker verunsichert wird. Dabei sind Autoren wie Christian Kracht genau das, wonach es schreit; Autoren, die wagen, die verunsichern, irritieren, vielleicht sogar polarisieren. Und die Kritik ist irritiert. Irritiert von der Geschichte, weil sich Christian Kracht nicht um Konventionen und Gepflogenheiten zu kümmern scheint. Irritiert vom Ton, der sein Schreiben so eigen-artig macht. Irritiert, weil man vergeblich nach einer Message sucht, weil Verunsicherung zum Programm gehört. Irritiert, weil sich Christian Kracht auch schon nach seinem letzten Roman «Das Imperium» nicht um die kruden Behauptungen eines Spiegelberichts kümmerte, der seinem Schreiben einen Rechtsdreh andichten wollte.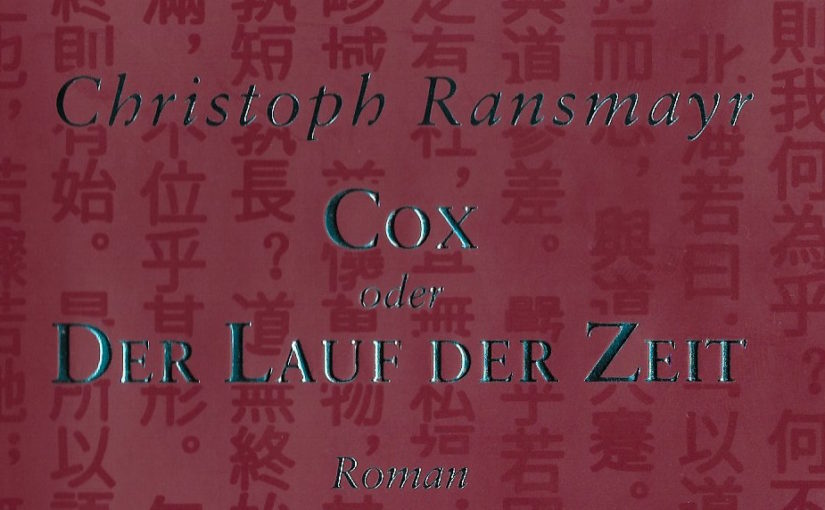
 Christoph Ransmayrs Absicht war mit Sicherheit nicht einen historischen Roman zu schreiben. Christoph Ransmayr bedient sich der Historie, um vom Dilemma des schöpferischen Menschen zu schreiben. Davon, dass man am einen Ende erschafft, um am anderen Ende zu zerstören. Davon, dass es bei all den vielen Reisen, die der Autor unternimmt, nicht ums Verstehen geht. Ransmayr beschreibt, geschult durch den Blick des Nomaden, wie durch Kraft und Leidenschaft das scheinbar gleichmässige Ticken der Zeit ins Stocken geraten kann, auch durchaus beabsichtigt.
Christoph Ransmayrs Absicht war mit Sicherheit nicht einen historischen Roman zu schreiben. Christoph Ransmayr bedient sich der Historie, um vom Dilemma des schöpferischen Menschen zu schreiben. Davon, dass man am einen Ende erschafft, um am anderen Ende zu zerstören. Davon, dass es bei all den vielen Reisen, die der Autor unternimmt, nicht ums Verstehen geht. Ransmayr beschreibt, geschult durch den Blick des Nomaden, wie durch Kraft und Leidenschaft das scheinbar gleichmässige Ticken der Zeit ins Stocken geraten kann, auch durchaus beabsichtigt. Christoph Ransmayr (1954) wuchs als Sohn eines Volksschullehrers auf. Er besuchte das Stiftsgymnasium der Benediktiner in Lambach und studierte von 1972 bis 1978 Philosophie und Ethnologie. Seit 1982 ist er freier Schriftsteller, lebt in Wien und Irland. Sich selbst bezeichnet er als «Halbnomaden» aufgrund seiner vielen Reisen. Ransmayr verbindet in seiner Prosa historische Tatsachen mit Fiktionen. Charakteristisch für Ransmayrs Romane sind die Schilderung grenzüberschreitender Erfahrungen, die literarische Bearbeitung historischer Ereignisse und deren Verknüpfung oder Brechung mit Momenten aus der Gegenwart. Die Verbindung von spannenden Handlungen und anspruchsvollen Formen haben vor allem in seinen ersten beiden Romanen «Die Schrecken des Eises und der Finsternis» und «Die letzteWelt» viel Lob eingebracht.
Christoph Ransmayr (1954) wuchs als Sohn eines Volksschullehrers auf. Er besuchte das Stiftsgymnasium der Benediktiner in Lambach und studierte von 1972 bis 1978 Philosophie und Ethnologie. Seit 1982 ist er freier Schriftsteller, lebt in Wien und Irland. Sich selbst bezeichnet er als «Halbnomaden» aufgrund seiner vielen Reisen. Ransmayr verbindet in seiner Prosa historische Tatsachen mit Fiktionen. Charakteristisch für Ransmayrs Romane sind die Schilderung grenzüberschreitender Erfahrungen, die literarische Bearbeitung historischer Ereignisse und deren Verknüpfung oder Brechung mit Momenten aus der Gegenwart. Die Verbindung von spannenden Handlungen und anspruchsvollen Formen haben vor allem in seinen ersten beiden Romanen «Die Schrecken des Eises und der Finsternis» und «Die letzteWelt» viel Lob eingebracht.