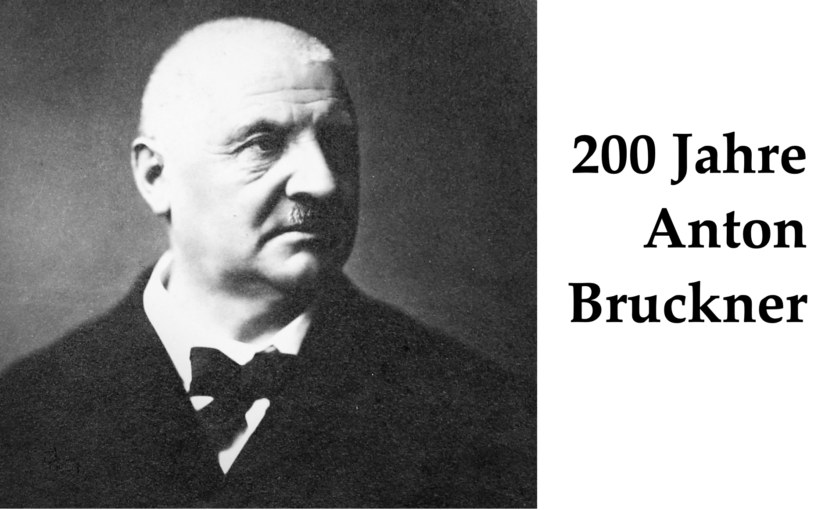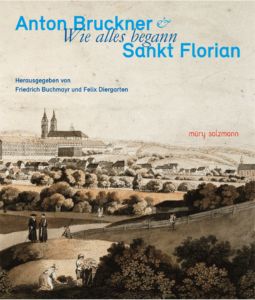Baschar al-Assad ist gestürzt und nach Moskau geflohen. In Syrien jubeln die Menschen und hoffen auf ein Leben in Freiheit. Die ganze Welt sorgt sich: Ist die Nacht in Damaskus vorbei? «Nacht in Damaskus» von Shukri Al Rayyan ist ein Buch, das nachdenklich stimmt und aufwühlt.
 Gastbeitrag von Urs Abt
Gastbeitrag von Urs Abt
Durch die aktuellen Ereignisse wird dieser Roman hochaktuell, indem er einzigartig aufzeigt, welches Schreckensregime in Damaskus herrschte und nun hoffentlich zu Ende geht. Es ist keine demokratische, sondern eine militärische Revolution mit ungewisser Zukunft, bisher aber ohne grosses Blutvergiessen. Mit diesem Buch fühle ich mich mitten im Geschehen, fiebere mit und stelle mir vor, was diese Ereignisse für die verschiedenen Protagonisten des Buches bedeuten.

«Nacht in Damaskus» ist ein Buch ohne Orient-Romantik, sondern voll bitterer Realität. Auf den verschlungenen Wegen des Romans begegnen wir bei jeder neuen Wendung dem wahren Schuldigen, den Verhältnissen, die das tyrannische Regime der Assad-Familie zu verantworten hat, in dem Syrer entweder zu Kriminellen oder zu Opfern gemacht wurden. (aus dem Vorwort des Autors)

Der 2014 aus Syrien in die Schweiz geflohene Schriftsteller Shukri Al Rayyan bringt uns die beklemmende Atmosphäre in Damaskus im Jahr 2011 anschaulich und vielschichtig näher. Die Geschichte des jungen Ingenieurs Dschawad und der schönen, ambitionierten Lamis wird mit vielen Nebenfiguren bereichert. Als roter Faden steht ein Geld-Diebstahl von Dschawad im Zentrum. Zufällig findet er den unbeliebten Chef in seinem Büro tot auf, daneben ein Sack mit einem Haufen Geldnoten, den er zu sich nimmt. Bald verschwindet aber das Geldpacket. Die Beziehung des frisch verliebten Paars Dschawad und Lamis wird auf die Probe gestellt, die Beamten von Polizei und Geheimdienst versuchen ihrerseits ihr Glück, ans Geld heranzukommen.
Ist es ein Liebesroman? Ist es ein Krimi? Wer ist Opfer, wer Täter? Der Autor macht es mir nicht leicht. Es ist schwierig, sich mit einem Helden, einer Heldin zu identifizieren. Die Hauptrolle spiegeln die Verhältnisse, da auch die Liebe zwischen Dschawad und Lamis (er Sunnit, sie Alawitin) durch Misstrauen und Hass gefährdet ist und erst durch eine Flucht etwas Hoffnung aufkommt. Das Klima der Angst und Verunsicherung beherrscht sowohl Opfer wie auch Polizei und Geheimdienst.
Die politischen Ereignisse von 2011 mit der blutigen Niederschlagung des «Arabischen Frühlings» durch Truppen des Diktators verursacht Angst und Schrecken. Aufmüpfige werden gnadenlos gefoltert und ins Gefängnis geworfen. Jedermann ist sich selbst der Nächste. Die multiethnische Bevölkerung ist gespalten. Angst und Misstrauen beherrscht die Bevölkerung. Die Minderheit der Alawiten (wie Assad) besetzen die Ämter der Regierung, die Mehrheit der Bevölkerung sind Sunniten. Politische und religiöse Unterschiede bestimmen entscheidend das Leben der Menschen in Syrien.
Das Leben ist sehr grosszügig und verteilt immer wieder neue Chancen. Das Problem liegt allerdings bei jenen, denen sie geboten werden. Erkennen sie die Chance? Oder meinen sie, es handle sich lediglich um den Versuch, einem toten Körper Leben einzuhauchen?
Die gesamte Welt hat in den letzten Jahren in Syrien den Einsturz ganzer Gebäude, Viertel und Städte miterlebt. Dabei war dies bloss die skandalöse Offenbarung dessen, was bereits seit Jahrzehnten im Verborgenen geschah. Innerhalb kürzester Zeit hatte in den 1980er-Jahren ein Niedergang eingesetzt, ein lautloser unsichtbarer Horror. Nicht auf die Gebäude hatte man es abgesehen, nicht auf Steine, sondern auf die Menschen. Niemand weiss, welcher Groll und welcher Hass einen einzigen Mann dazu brachten, ein Land mit einer mehrere Tausend Jahre alten Kultur innerhalb weniger Jahrzehnte so zuzurichten.
Es gibt vielerlei Arten von Bestien. Nach landläufiger Meinung sind Bestien gross und hässlich, geben ein donnerndes Gebrüll von sich und stinken. Doch das ist eine voreilige Meinung. Man erkennt Bestien nämlich weniger an ihrer Grösse als vielmehr an ihren Handlungen. Genau genommen muss man sich nur ansehen, wie gross der Schaden ist, den sie jemandem zufügen.
Hoffentlich gelingt Syrien der schwierige Weg in die Freiheit. Die Lektüre dieses Buches ist sehr empfehlenswert und ich wünsche mir weitere Übersetzungen ins Deutsche von Shukri Rayyan.
Shukri Al Rayyan, 1962 in Damaskus geboren, verbrachte den längsten Teil seines Lebens unter der Herrschaft der Assad-Dynastie, was vor allem bedeutete: Zu überleben. Nach einem Maschinenbaustudium an der Universität Damaskus arbeitete er für verschiedene Verlage, als Autor und Drehbuchautor für Kinderbücher und Fernsehprogramme und schließlich als TV-Produzent. Shukri Al Rayyan floh 2014 mit seiner Familie aus Syrien in die Schweiz. Im Gepäck hatte er den Entwurf zu einem Roman, an dem er seit dem Ausbruch der syrischen Revolution im Jahr 2011 arbeitete. «Nacht in Damaskus» ist das erste ins Deutsche übertragene Werk des Autors, der auch unter weiterschreibenschweiz.jetzt, dem Portal für Exil-Autorinnen, publiziert. Heute lebt Shukri al Rayyan mit seiner Familie in Burgdorf bei Bern.
Kerstin Wilsch hat Übersetzen und Dolmetschen für Arabisch und Englisch in Leipzig und Deutsch als Fremdsprache in Berlin studiert. Sie lebt seit vielen Jahren im Ausland (UK, Marokko, Ägypten, Jordanien), wo sie u.a. zwei Übersetzerstudiengänge aufgebaut sowie Deutsch und Arabisch als Fremdsprachen unterrichtet hat. Zurzeit leitet sie ein Auslandsstudienprogramm für Studierende aus den USA in Amman/ Jordanien und ist zudem als Übersetzerin und Übersetzungslektorin für arabische Literatur tätig.
Foto © Ayse Yavas