Eine grössere Vision aus kleinen Dingen
Dieses Buch ist ein sprachliches Kunstwerk. In einer unverbrauchten, genauen Sprache arbeitet sich hier ein Autor an den Gewalten und Zumutungen der Welt ab. Als Briefroman konzipiert, richtet sich der Text an eine Mutter die Analphabetin ist und den langen Brief des Sohnes wohl nie lesen wird. Bereits im zweiten Satz des Romans heisst es: «Ma, ich schreibe, um dich zu erreichen – auch wenn jedes Wort auf dem Papier ein Wort weiter weg ist von dort, wo du bist.»
Der angeschlagene Tonfall ist direkt und trifft den Leser/die Leserin ungeschützt. Emotional aufgeladene Szenen voller Rauheit und Brutalität lösen Szenen voller Schönheit und Zartheit ab. Eine Dringlichkeit, ja Notwendigkeit, ist diesem Buch eigen – sie verstört und reisst mit. Erzählt wird sequentiell, bruchstückhaft – ganz im Sinne des Autors: «Ich erzähle dir weniger eine Geschichte als ein Schiffswrack – die Teile dahintreibend, endlich lesbar.»
Nach der Lektüre von Roland Barthes‘ «Tagebuch der Trauer» und dem darin stehenden Satz «Ich habe den Körper meiner kranken, dann sterbenden Mutter gekannt», beschliesst der Autor den Brief an die Mutter zu schreiben.
1988 in Saigon geboren, zog Ocean Vuong, vor seinem Romandebüt eher bekannt für seine lyrischen Arbeiten, mit zwei Jahren in die Vereinigten Staaten, in ein Land, das ihn, neben den heiklen Familienverhältnissen in denen er aufwuchs, in vielerlei Hinsicht prägte. Stoff genug für einen gesellschaftskritischen, die Verhältnisse anprangernden Roman mit einer unglaublichen Sogwirkung.
Warum nun aber dieser Text? Diese spezifische Form? Was treibt den Autor an? Ist es Selbstbehauptung? Selbstermächtigung?
Bei der Lektüre spürt man die immense Kraft die von Vuongs Worten ausgeht. Da ist eine Präzision und Tiefe, die beeindruckt. Hier legt einer Schichten frei, Schichten von Gewalt und Krieg und Zurichtung, aber auch von Freiheit und 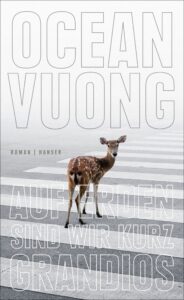 Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.
Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.
Neben der Gewalt die von Männern ausgeht, sei es im Krieg oder als überforderte Väter, die trunksüchtig und ohne Arbeit ihr Leben im amerikanischen Nirgendwo fristen, spielt die Gewaltbereitschaft und Unzulänglichkeit der eigenen Mutter eine zentrale Rolle im Roman. Nach schmerzlichen Szenen häuslicher Gewaltausbrüche – die Mutter prügelt immer wieder auf den Jungen ein, in der Wohnung, auf der Strasse, die Angst des Jungen übergross, der nicht mehr weiter weiss, und irgendwann auch wegrennt – endet die Gewalt mit seinem Aufbegehren gegen die Mutter und einem Ende der Schläge nach dreizehn langen Jahren. Was bleibt ist eine Mutter, die nicht mehr schlägt, aber Geschlagene bleibt. Als Zugewanderte und Analphabetin steht sie am Rande der Gesellschaft, arbeitet weiterhin bis zur Erschöpfung in Fabriken und Nagelstudios, und kennt nur dieses eine Leben – ein Leben bestehend aus Arbeit und Schlaf. Diese (zugerichtete) Mutter, so schreibt der Autor, ist damit «Zuflucht und Warnung» zugleich. Wie liebevoll, aber auch hilflos diese Mutter sein kann, zeigt Vuong in einer längeren Sequenz; hierbei schildert er den Unfalltod eines geliebten Cousins und das vermeintliche Wiedererkennen dieses Cousins in der New Yorker Subway. Eine Panikattacke befällt Little Dog und er beschliesst umgehend seine Mutter anzurufen. Zuerst sagt sie kein Wort, dann beginnt sie die Melodie von «Happy Birthday» zu summen, des einzigen englischen Liedes, das sie kennt. «Und ich lauschte, das Telefon so fest an mein Ohr gepresst, dass noch Stunden später ein rosa Rechteck in meine Wange geprägt war.»
Neben dem ambivalenten Verhältnis zu seiner Mutter, schildert Vuong, ausführlich und mit grosser Empathie, die Beziehung zu drei weiteren, ihm wichtigen Menschen: Zum einen ist da die Grossmutter Lan, die mit ihm und seiner Mutter in einer viel zu kleinen Wohnung in einem ärmeren Viertel der Stadt (Hartford) wohnt und deren Tod er ebenfalls schreibend im letzten Drittel des Buches zu bewältigen versucht. Sie war es, die ihm Geschichten erzählte. Er war es, der ihr die grauen Haare mit einer Pinzette auszupfte. «Der Schnee in meinem Haar (…) mein Kopf juckt davon. Bist du so gut und zupfst mir die juckenden Haare aus, Little Dog? Der Schnee schlägt Wurzeln in mir.» Die zweite Bezugsperson: Paul, sein Grossvater, ein amerikanischer Soldat, der in Vietnam im Einsatz war, bei dem sich letztlich herausstellt, dass er nicht der leibliche Vater seiner Mutter Rose ist. Dennoch bleibt er für Little Dog der Grossvater, schliesslich hat er nur den einen. Dritte wichtige Person ist Trevor, ein Durchschnittsamerikaner, Sohn eines abgehalfterten Trinkers, zwei Jahre älter als Little Dog und bald nicht nur wichtigster Freund und Begleiter sondern auch über alle Massen Geliebter. Als Vierzehnjähriger lernt Little Dog ihn bei der Arbeit auf einer Tabakplantage kennen. Als Trevor, nach jahrelangem Drogenkonsum, mit zweiundzwanzig Jahren einsam und verlassen in seinem Zimmer stirbt, fühlt sich Little Dog schuldig, hat er ihn doch allein gelassen in all seiner Kaputtheit, Versehrtheit, Verzweiflung. Trevor, unschuldig süchtig geworden – als Jugendlicher verschrieb man ihm wegen eines Knochenbruchs Schmerzmittel (Oxycontin) mit hohem Suchtpotenzial – hat es, wie viele Andere in den USA (Vuong: «Die Wahrheit ist eine Nation unter Drogen…») nicht geschafft zu überleben, und ist damit ein weiteres Opfer der Verhältnisse in einem Land, wo die Chancen auf Glück so ungleich verteilt sind und die Armut so gross.
Ocean Vuong übt harsche Kritik an den sozialen Verhältnissen in den USA. In seinem Roman leuchtet diese Kritik immer wieder hell auf. Er weiss, aus nächster Nähe, wovon er spricht. Viele seiner Freunde sind jung gestorben. Vier an einer Überdosis. Trevor war also keine Ausnahme. Nicht zuletzt geht es Vuong in seinem brillanten Text um den Krieg und das was der Krieg mit Menschen anstellt, welche Traumata zurückbleiben und Menschenleben prägen. Gewalt gebiert Gewalt. Vuong blickt zurück, zurück in eine weit entfernte Vergangenheit, seine eigene Familiengeschichte, den Krieg in Vietnam.
Was die Besonderheit der Sprache angeht: Auf nahezu jeder Buchseite finden sich Formulierungen, die einem deutlich machen, wie beweglich die Sprache Vuongs sein kann, wie nah er den Dingen kommt durch seine gedrechselten Sätze. An dieser Stelle zwei Beispiele für die Kunstfertigkeit dieser Prosa. Bei der Tabakernte heisst es da: «…das Geräusch ihrer Klingen wurde lauter und lauter, bis man sie beim Schneiden keuchen hörte, während die Stiele hellgrün um ihre gebeugten Rücken herabspritzten. Man meinte das Wasser im Innern der Stängel zu hören, wenn der Stahl die Membranen aufbrach, und die Erde färbte sich dunkel, wo die Pflanzen ausbluteten.» Oder wie hier, auf einem Feld, nachdem der Protagonist ein Geräusch (wahrscheinlich ein Tier) gehört hat und diesem nachgeht: «Das Heulen kommt wieder, der Klang tief und hohl, als hätte er Wände, etwas, in dem man sich verstecken kann. Es muss verwundet sein. Nur etwas, das Schmerzen leidet, kann einen Ton hervorbringen, in den man eintreten kann.»
So sehr diese Sprache trägt und so überzeugend die Figurenführung, eine kleine Kritik an diesem Roman soll nicht unerwähnt bleiben. So ist es aus ästhetischen Gründen durchaus nachvollziehbar, dass der Autor seiner Mutter seine elegante Sprache angedeihen lässt, glaubwürdig ist die Figur dadurch bei weitem nicht: «Das Vietnamesisch, das ich spreche, habe ich von dir, eines, dessen Diktion und Syntax nur das Niveau der zweiten Klasse erreichen.» Es ist ein wenig ärgerlich, dass sich hier ein Widerspruch offen zeigt. Doch es bleibt dem Leser/der Leserin überlassen, das zu bewerten.
Alles in allem sticht das Buch aufgrund seiner Klasse und Eigenständigkeit aus der Vielzahl von Neuerscheinungen heraus. Da ist jemand ein Wagnis eingegangen. Für die Kunst. So viel steht fest. Und dafür gebührt Ocean Vuong mehr als Respekt. Dass hier ein Debüt vorliegt, würde man nicht meinen. Ein feines, ein kluges Buch.
Text: Karsten Redmann
 Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.
Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.
Übersetzt von Anne-Kristin Mittag

