Georgi Gospodinov hat seinen todkanken Vater während des Sterbens nicht nur mit seiner Anwesenheit begleitet, sondern mit Stift und Papier. So wie Sterben und Tod immer auf ganz eigene Weise mit dem Leben konfrontieren, so nehmen mich die Gedanken des Autors mit in meine eigene Erinnerung und in die Konfrontation mit dem, was auch bei mir dereinst kommen wird.
Georgi Gospodinov liebte seinen Vater, liebt ihn noch immer. Nur deshalb konnte der Schriftsteller ein solches Buch schreiben. Ein Buch, das nicht in erster Linie von seiner Trauer und seinem Schmerz erzählt, sondern von seiner Liebe, seinem Respekt und den vielen Erinnerungen, von denen der Autor genau weiss, dass sie in seinem eigenen Leben und in den Leben seiner Familie zu Samen geworden sind, die irgendwann zu Keimlingen und zu Pflanzen werden, so wie Geschichten, wenn sie denn erzählt oder gelesen werden immer etwas weiterleben lassen in den Leben jener, die den Kern dieser Geschichten in sich aufnehmen.
Ja, mein Vater war Gärtner. Jetzt ist er ein Garten.
„Der Gärtner und der Tod“ ist ein ganz und gar persönliches, intimes Buch. Georgi Gospodinov lässt mich an seinem Innersten teilhaben, als wäre ich sein Freund, ohne Absicht, einfach nur um sich mit dem Schreiben, dem Festhalten und Nacherzählen dem zu vergewissern, was sonst wie heisser Dampf im Äther zu verschwinden droht. „Der Gärtner und der Tod“ ist eine buchlange Liebeserklärung an den Vater, an das Schreiben, an die Sprache, die aus den Wunden, die Sterben und Tod aufreissen, etwas werden lassen, das wächst und gedeiht und wieder mit einer Pflanze verglichen werden kann. Es ist ein Akt gegen das Vergessen, gegen das Verschwinden, wissen wir doch alle, wie viel Leben, wie viele Geschichten mit dem Tod weggerissen werden, unwiederbringlich. Da stirbt jemand und mit ihm alles, was er an Erinnungen, Namen, Gefühlen und Bildern mit sich herumgetragen hat, alles ein Leben lang wie ein Schatz gehütet.
Es ist wichtig, ihre Hand zu halten, während sie sterben, sage ich zu einem Freund, der ebenfalls seinen Freund verloren hat.
Wichtig ist, dass wir sie danach loslassen, antwortete er nach kurzem Schweigen.
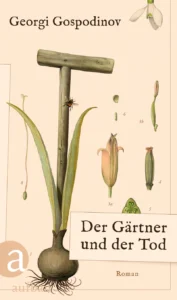
Auf Seite 104 stirbt Georgi Gospodinovs Vater, morgens um 5.17. Er sitzt am Bett seines Vaters, hält seine Hand, vier Tage vor Weihnachten, im Winter 2023. Es beginnt die Zeit danach. Die Zeit davor beschreibt Gospodinov im ersten Teil des Buches. Von einem starken Mann, der mehr und mehr nur noch ein Schatten seiner selbst war, der vor fast zwei Jahrzehnten schon einmal durch Krebs das Leben zu verlieren drohte, damals aber obsiegte. Nicht zuletzt durch seinen unerschütterlichen Lebenswillen, durch seine Liebe zu seiner Familie und seinem grossen Garten, in den er bis zuletzt viel investierte. Der ihm viel mehr war als ein Lebensmittellieferant, der Zeichen seiner Liebe zu seiner Familie war, einer Liebe, die mehr als deutlich lesbar war.
Der zweite Teil seines Buches ist die Auseinandersetzung mit dem Danach, mit all den Fragen, die der Tod mit einem Mal in den Vordergrund stellt, nicht zuletzt jene, warum wir uns so tunlichst dagegen wehren, uns zu Lebzeiten mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Wie mit einem Mal alles wieder zum ersten Mal wird, zum ersten Mal ohne jene Person, die ein Eckpfeiler des eigenen Lebens war. Die Selbstvergewisserung eines neuen Kapitels, das letzte Hineingeworfensein in einen Abschnitt ohne Fangnetz.
Ich weiss, dass mit dem Tod meines Vater nicht nur eine, sondern mehrere Welten gestorben sind.
Dieses Buch ist viel mehr als Literatur, Unterhaltung. Es gab für mich derart viele Lese- und Gedankenpausen, bei denen das Buch zum Katalysator, zum Brennglas, zum Ansporn und Multiplikator wurde, dass ich dem Buch viel mehr verdanke als Genuss und Genugtuung. In zugänglicher Sprache umarmt mich dieses Buch, dabei ist er es, den man während der Lektüre brüderlich zur Seite nehmen will. Georgi Gospodinov beschenkte mich zu tiefst – und dafür kann ich ihm nur innig danken.
Vielleicht war das die Mission meines Vaters … ohne dass es ihm selbst bewusst war: Hirte einer kleinen Herde von Geschichten zu sein, die er von Hand aufgezogen hatte und die ihm überallhin folgten. Oder einfach Gärtner – dort, dort im Garten mit den Geschichten und den Familienstammbäumen.
Georgi Gospodinov wurde 1968 in Jambol, Bulgarien, geboren. Einem großen internationalen Publikum wurde er mit seinem ersten Roman bekannt, dem «Natürlichen Roman» sowie dem Roman «Physik der Schwermut», die in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurden. Gospodinov wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweifach mit dem Bulgarischen Buchpreis und dem Jan Michalski-Preis. Für seinen Roman «Zeitzuflucht» erhielt er 2023 den International Booker Prize. Er lebt und arbeitet in Sofia.
Alexander Sitzmann studierte Skandinavistik und Slawistik in Wien, forscht und lehrt an der dortigen Universität. Seit 1999 ist er als literarischer Übersetzer aus dem Bulgarischen, Mazedonischen und den skandinavischen Sprachen tätig.
Beitragsbild © Tihomira Krumova


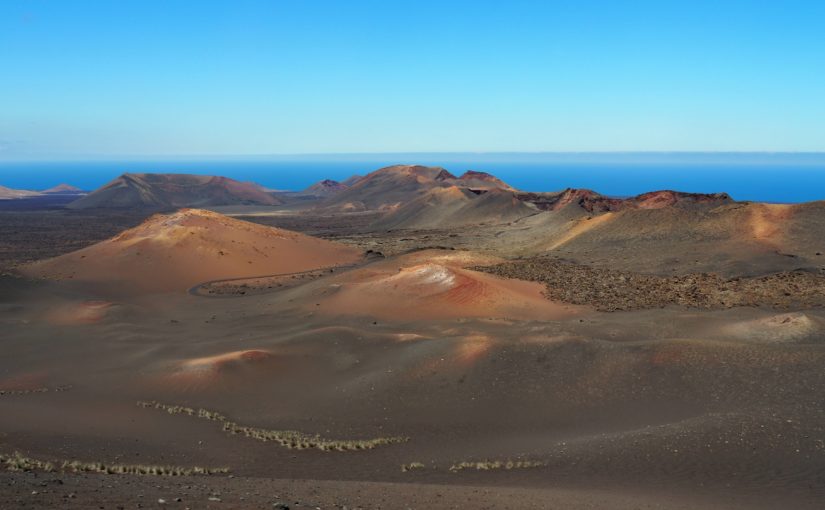
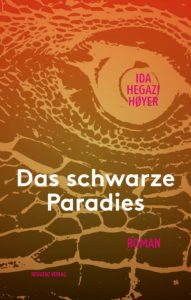 richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters.
richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters. Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.
Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.