„Fast wie ein Bruder“, der neue Roman von Alain Claude Sulzer, ist nicht nur ein Buch über Freundschaft und die Scham einer Schuld. Dieser Roman wirbelt auf, was die Gesellschaft seit Jahrzehnten zu verbergen versucht: Die Angst der Heimsuchung. Die Angst, dass uns dereinst etwas offenbart, die Augen dort verschlossen zu haben, wo man hätte hinschauen und etwas tun sollen.
Er liest in der Zeitung von einer Ausstellung in einer Berliner Galerie, von den Bildern eines unbekannten Künstlers. Und weil er eine der abgebildeten Skizzen in jener Zeitung als jene seines schon lange verstorbenen Freundes Frank erkennt und alle abgebildeten Gemälde mit der Initiale F signiert sind, weil die Bilder die unverwechselbare Sprache seines alten Freundes sprechen, reist er nach Berlin und besucht jene Galerie. Dort sieht er sich selbst, sieht in sein junges Gesicht, die Nacktheit seines Körpers und die unmissverständlich aufgeladene Gestik eines Alleine-Gelassenen. Eigentlich müssten sämtliche Bilder verschwunden sein, denn sein Freund, der zu Lebzeiten fast nichts verkaufen konnte und in der Masse all der unbekannten Talente versank, orderte seinen Nachlass kurz vor seinem Tod zu ihm von New York nach Frankreich, wo er die Bilder ungesehen und verpackt im Schuppen neben seinem Wohnhaus einlagerte mit der jahrelang verschobenen Absicht, sich irgendwann den Bildern, der Hinterlassenschaft seines Freundes anzunehmen. Bis die Bilder aus seinem Schuppen verschwanden. Bis das lautlose Verschwinden aller Bilder alte Wunden aufriss, eine schlummernde Schuld, ein schlechtes Gewissen, die Scham über das mehrfache Sterben seines Freundes. Bis ein Artikel voller Begeisterung und Verwunderung auf einen bisher unbekannten Künstler aufmerksam macht, einen grossen Unbekannten, ein Genie.

Frank und er wuchsen wie Brüder im Ruhrgebiet der Siebzigerjahre auf, Wohnung an Wohnung. Nicht nur sie waren befreundet, auch ihre Eltern. Ein Leben ganz nah, Tür an Tür. Eine Art paradiesischer Urzustand, aus dem sie der fast gleichzeitige Tod ihrer Mütter vertrieb. Beide Frauen raffte Krebs aus den Leben und hinterliess alleinerziehende Väter, die sich nicht mehr zurechtfanden. Die Leben der beiden Familien trennten sich. Aus dem Gleichschritt wurden zufällige Treffen und als Frank mit seinem unauslöschlichen Wunsch und Drang, dereinst ein grosser Künstler zu werden, nach New York zog, verloren sich die beiden Leben, dünnte aus, was einmal unzertrennlich schien.
Erst als Frank sich Anfang der Neunzigerjahre aus einem Schöneberger Krankenhaus meldet und verrät, dass er unheilbar krank auf das Erscheinen seines ehemaligen Freundes wartet, bricht auf, was über Jahre schlummerte. Frank hat zu einer Zeit Aids, als es noch kaum Medikamente gab und die Diagnose einem Todesurteil gleichkam. Als man an Aids Erkrankten den Körperkontakt verweigerte, nicht einmal mehr die Hand geben wollte. Als man von Seuche sprach und nicht einmal hinter vorgehaltener Hand von der gerechten Strafe Gottes sprach, angesichts der vielen Opfer unter den Schwulen.
Er reist nach New York und sie treffen sich ein letztes Mal, weil jene Freundschaft, aus der sie wuchsen, die sie als Kinder wie Brüder verband, etwas blieb, was trotz der so gegensätzlichen Biographien stets geblieben war, wenn auch begraben, verdrängt, fast vergessen.
Plötzlich sind die Bilder wieder da. Die Bilder eines Mannes, der einst wie sein Spiegelbild war, der sich ganz in seine Leidenschaften stürzte, sei es seine Malerei, sein Leben selbst, in seiner Kompromisslosigkeit. Auch die Bilder jenes einen Moments, der nicht nur die beiden Freunde auseinandertrieb, sondern die beiden Familien, eine Freundschaft, die für eine Ewigkeit hätte reichen sollen. Als Frank aus seinem Leben verschwand, man ihn gebrandmarkt hatte, für immer aus dem Paradies vertrieben.
„Fast wie ein Bruder“ ist auch ein Roman über Wahrnehmung. Wie sehr sich unterscheiden kann, was wir als real empfinden. Darüber, dass wir unter dem Zwang stehen, uns ein Bild von allem zu machen, ob als Künstlerin oder Künstler, ob als irgendwer. Wir sehen und interpretieren, senden Signale. „Fast wie ein Bruder“ ist ein Erklärungsversuch, warum man die Dinge nicht zu lesen verstand.
Und Alain Claude Sulzer erzählt mit der Stilsicherheit eines Meisters! Ein ungemein starkes Buch!
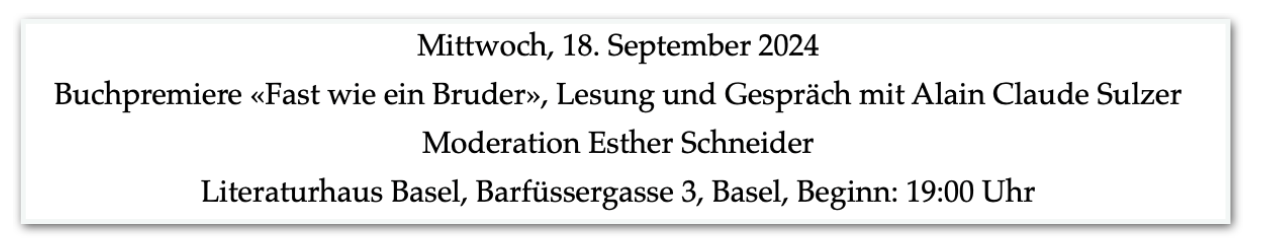
Interview
Zwei Freunde, die in ihrer Kindheit wie Brüder aufwachsen, durch einen Donnerschlag voneinander getrennt werden und sich doch nie ganz verlieren. Vielleicht bewegt dein Roman auch deswegen, weil wir diese Geschichte alle selber kennen; Freundschaften, die einst elementar waren, die unzertrennlich schienen, sich in den Wirbeln der Zeit verlieren und einen Zustand der immerwährenden Scham hinterlassen. So wie ich selbst einst einen Mann im Bus traf, den ich als Freund aus Kindertagen erkannte, aufgeschwemmt und laut mit sich selbst redend. Ich sprach ihn nicht an, aus Feigheit und der Furcht vor Konsequenzen. Wie ungern beschäftigen wir uns mit der Feigheit!
Ist die Frage nicht eher: Wie ungern beschäftigen wir uns mit dem, was vergangen ist, mit dem, was mal einen Wert darstellte, der heute einfach verloren ist. Von Feigheit würde ich nicht unbedingt sprechen, wenn man sich voneinander entfernt hat. Kinder- und Jugendfreundschaften halten selten, wir haben ja manchmal genug an unseren eigenen Familien zu nagen, das ist für viele Vergangenheit genug. Da stellt sich eher die Frage, wie feige man ist, sich ihr zu stellen. Oder wie «zurückhaltend» oder meinetwegen «ängstlich» man ist, es zu tun. Uns trennen oft Welten von «damals». Sie hinter sich gelassen zu haben, ist nicht feige, sondern doch eher befreiend.
Frank erkennt bei einem Ausstellungsbesuch, dass die Malerei seine Stimme sein muss. Von dem Moment ist klar, er muss Maler werden. Alles, fast alles in seinem Leben, richtet sich danach aus. Erst sein Zeichnen, später sein Malen, seine Kunst, seine Form des Ausdrucks wird zur Manie. Ein Drang, bei dem das New York der Achtzigerjahre der einzig mögliche Ort des Gedeihens sein kann. Du beschreibst sehr eindrücklich, wie nah einem diese Manie an den Abgrund führen kann, ein Abgrund, dem du als Schriftsteller bestimmt immer wieder begegnest. Wie schafft man es, sich nicht zu verlieren?
Ich frage mich eher, wie man es schafft, sich als Autor zu verlieren und trotzdem arbeiten zu können. Wenn ich regelmässig am Abgrund gestanden hätte, gäbe es mich als Autor wohl längst nicht mehr. Ich lebe wie wohl die meisten anderen Autoren auch, ein eher «durchschnittliches» Leben, in dem die Arbeit zwar vielleicht der wichtigste Aspekt ist, aber keiner, der mich verschlingt. Das ist mir ohnehin eine zu romantische Vorstellung des Künstlers. Natürlich gab und gibt es, insbesondere bei den Bildenden Künstlern, immer wieder welche, die von ihren Manien fortgerissen wurden, aber zu ihnen zähle ich mich sicher nicht. Ich nehme mir – wenn ich denn danach suchen müsste – eher ein Beispiel an Nabokov, dessen grösster Wunsch es stets gewesen war, in vornehmen Hotels zu wohnen, um dort über Menschen zu schreiben, die – getrieben ihren fixen Ideen – von billigem Motel zu Motel hinterherhechelten.
Frank malt, der Erzähler in deinen Roman macht Filme. Du schreibst, du schreibst auch immer wieder über Musiker. Ob Maler, Schriftsteller, Dichter oder Musiker – sie alle erzeugen Bilder, Bilder, die keine Wahrheiten abbilden wollen. Und trotzdem wird die Kunst immer und immer wieder am Grad ihres realen Spiegelbilds gemessen. Ein ewiger Kampf. Und gerade der Film wirbt dann auch noch gerne mit dem Untertitel „Nach einer wahren Begebenheit“. Höhlen diese permanenten Erklärungsversuche, das Erschaffene am Realen messen zu müssen, nicht irgendwann aus?
Nicht, wenn sie für den Autor gar nicht entscheidend sind. Auch er erzeugt Wahrheiten, egal worauf sie basieren; seine Fantasie und deren Produkte sind ja genauso real wie das Kind, das über die Strasse geht und von einem Auto überfahren wird. Jetzt genau wird es in der Fantasie des Lesers überfahren, also real. Dieser Satz ist also wahr, solange ihn jemand liest, zumindest kurzfristig. Es ist völlig egal, ob sein Inhalt auf einer wahren Begebenheit beruht oder nicht, ob der Erzähler uns eine Lüge auftischt oder nicht. Das Kind wird überfahren, weil es nicht aufpasst. Gerade noch einmal – diesmal mit einem erklärenden Nebensatz. Es ist am Leser zu entscheiden, für wie wahr er diese Geschichte hält, und am Autor liegt es, sie glaubhaft erscheinen zu lassen. Die Frage nach der «wahren Begebenheit» oder dem Faktencheck ist also nicht die Frage, die die Literatur sich stellen muss.
Frank schafft es nie, sich als Maler einen Namen zu machen. Das Meer all jener, die es in der Welt der Kunst trotz Leidenschaft und Akribie nie zu lebensnotwendiger Aufmerksamkeit schaffen, ist riesig. Posthum scheinen es seine Bilder für einen kurzen Moment zu schaffen, um dann wie in einem Traum wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Eine Form der natürlichen Verschwendung?
Würde Frank nicht früh sterben, hätte er sich vermutlich den Namen gemacht, den er verdiente. Seine Geschichte als Maler ist eine Geschichte reduzierter Möglichkeiten. Er hat zu wenig Zeit, und die Zeit, in der er lebt, ist wohl auch nicht die Zeit, in der es jene Menschen gibt, die er auf sich aufmerksam machen kann. Natürlich Verschwendung? Vielleicht.
Franks Bilder sind laut. Sie schreien. Sie provozieren. Dass Provokation ein Teil der Kunst ist, scheinen die wenigsten zu verstehen. Lieber wäre vielen Kunst bloss als nette Verzierung, hübscher Schmuck. Was war das Urmotiv, als Du Dich ans Schreiben dieses Romans machtest, steckt doch in deinem Roman ganz offensichtlich auch Provokation?
Ich sehe die Provokation nicht, lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Das Urmotiv ist wohl die Geschichte meines Vaters, der während seines Lebens immer wieder Phasen hatte, in denen er malte – und keineswegs als Dilettant. Er malte, hat aber nie ausgestellt. Seine Bilder existierten also nicht und hatten keinen Marktwert. Nach seinem Tod haben wir Brüder einen letzten Effort unternommen und einen jungen Galeristen gefunden, der für diese Bilder regelrecht entbrannte und eine Ausstellung organisierte, die sehr erfolgreich war. Plötzlich waren die Bilder, die vorher kaum jemand kannte, da. Sie wurden gesehen, es wurde darüber geschrieben, sie wurden verkauft. Eine späte Genugtuung, ähnlich jener, die Frank in meinem Roman «erfährt», auch er erst nach seinem Tod.
Noch vor wenigen Jahren erklärte man Aids zur Volksseuche. Eine Tatsache, die viel mehr Opfer forderte als die Krankheit selbst. Heute ist Aids aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden. Es gibt Medikamente. Du beschreibst die ganz persönliche Scham deines Erzählers. Geht es aber nicht viel mehr darum, dass man sich nie mit den tatsächlichen Folgen von Aids auseinandersetzte?
Die Betroffenen setzen sich auf die eine oder andere Weise bis heute damit auseinander. Dass die Nichtbetroffenen das nicht tun, ist nachvollziehbar. Alles in allem hat man die «Seuche», die keine «Volksseuche» war, sondern zunächst vor allem ganz bestimmte Menschen – eigentlich nur Männer – betraf, gut gemeistert. Das lag an besonnenen Politikern – es gab auch andere – und Medizinern, die sich nicht hysterisieren und manipulieren liessen.
Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, u.a. «Ein perfekter Kellner», «Zur falschen Zeit», «Aus den Fugen» und zuletzt «Doppelleben«. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er u.a. den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel.
«Die Jugend ist ein fremdes Land», Rezension
«Unhaltbare Zustände», Rezension
Beitragsbild © Lucia Hunziker.

