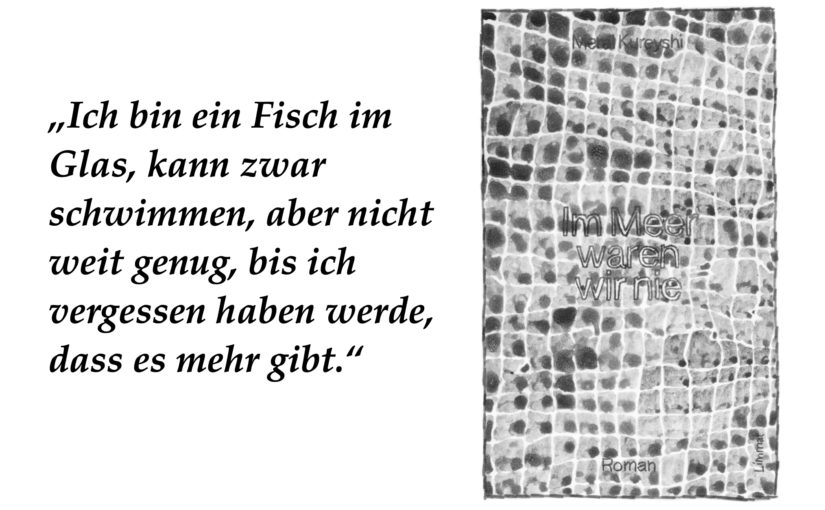«Im Meer waren wir nie» ist ein Familienroman, wenn auch nicht Abbild jener klassischen, idealisierten Familie; Vater, Mutter, Kind. Ein Bild, das lange genug alles andere zur Ausnahme, zum Sonderfall machte. Ein Roman über Befreiungsversuche – und eine würdige Nomination zum besten Buch in der Schweizer Literaturlandschaft.
In „Im Meer waren wir nie“ passiert nur wenig. Kein Roman, der sich plottorientiert um Spannung und Unterhaltung bemüht. Nicht dass dieser Roman nicht unterhalten würde. Aber er tut dies auf eine ganz eigene Weise. Es sind die Innenansichten der beschriebenen Personen und ihrer Welten. Es ist die Atmosphäre, die Meral Kureyshi mit viel Feingefühl und Empathie zeichnet. In einer Sprache, die in ihrer Tonalität, ihrer Zerbrechlichkeit genau das widerspiegelt, was die Protagonistinnen auszuhalten haben; ihr Gefangensein in einer Situation, ihre Beinahe-Ausweglosigkeit, dieses Gefühl, nicht dort zu sein, wo die Frauen eigentlich sein wollen.
Die Erzählerin und ihre Freundin aus Kindertagen leben in zwei Wohnungen übereinander. Weil Sophie als alleinerziehende Lehrerin Unterstützung braucht, hat es sich über die Jahre irgendwie ergeben, dass die Erzählerin für Sophies Sohn Eric schaut, wenn seine Mutter nicht da ist, oder keine Kraft mehr hat, sich um ihren Sohn zu kümmern. Eric ist acht, vorlaut und voller Leben.
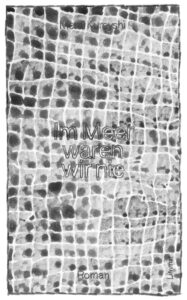
Und weil die Erzählerin so sehr zur Familie gehört und sich aus Ermangelung einer eigenen, die sich irgendwo zwischen ihrer einstigen Heimat 2000 Kilometer entfernt und der Schweiz verloren hat, ist es für sie selbstverständlich, als man sie bittet, Sophies Grossmutter Lili im Altersheim beizustehen, ihr Gesellschaft zu leisten, sie zu begleiten, ihr vorzulesen. Man bezahlt sie dafür. Sie wird zu einer Stütze in einem filigranen Familiengefüge, aber ebenso zu einer Selbstverständlichkeit. Zu der, die immer Zeit hat, die sich allem stellt, die zum Dreh- und Angelpunkt wird. Auch in ihrer ursprünglichen Familie, denn Nuri, ihre jüngere Schwester zieht vorübergehend bei ihr ein, geflohen aus einem Leben in Bedrängnis.
Lili begleitete vor Jahren ihren pflegebedüftig gewordenen Ehemann Emil ins Altersheim. Als er starb, blieb sie. Und als auch sie immer mehr Hilfe benötigt, aber niemand aus der Familie jene Zeit aufbringen kann, ist die Erzählerin gerade richtig, um jene Rolle einzunehmen. Zwischen Lili und ihr entsteht eine seltsame Beziehung, weder Freundschaft noch etwas wie Verwandtschaft. Genauso die Beziehung zu dem kleinen Eric, der sich ihr gegenüber ebenso ablehnend wie Nähe suchend zeigen kann. Auch die Freundschaft zu Sophie, Erics Mutter, ist eine andere geworden oder die Beziehung zu ihrer jüngeren Schwester Nuri. Es sind alles Beziehungen in der Schwebe. Nicht zuletzt darum, weil in allen Beziehungen Unausgesprochenes liegt, Geheimnisse, die nach Klärung rufen.
Die Erzählerin weiss, dass sie ihnen allen sagen muss, dass sie eine Stelle weit weg gefunden hat. Lili schleppt eine Schachtel mit Briefen mit sich herum, Zeugnisse einer alten Liebe, von der sie ihrer treuen Begleitung nur häppchenweise erzählt. Sophie von einer Beziehung, einem neuen Mann an ihrer Seite. Und Lilis Leben gibt mehr als deutliche Signale, dass es nicht mehr lange dauern würde, dass es Dinge gibt, die ausgesprochen und noch getan werden müssten.
Meral Kureyshis Roman beschreibt einen Typus Familie, der immer mehr dem entspricht, was bleibt, wenn aus Träumen und Erwartungen nicht wird, was hätte werden sollen. Familien, aus denen sich die Männer in ganz unterschiedlicher Art und Weise entfernen, die Pflichten aber an den Frauen hängen bleiben. „Im Meer waren wir nie“ beschreibt Frauen, deren Lebensentwürfe sich in der Maschinerie der Realitäten verheddern. Sei es Lili, die statt ihrer Liebe die Sicherheit wählt und nie darüber hinwegkommt, seien es Sophie und ihre Mutter, die sich ein Stück Freiheit erkaufen, in dem sie eine bezahlte Begleitung engagieren. Sei es die Erzählerin selbst, die erst mit Lilis Tod den letzten Schritt aus dem Hamsterrad schafft.
Beeindruckend an diesem Roman ist die Sprache, die Kunst der Schriftstellerin, aus unglaublicher Nähe jene Welt zu zeichnen, aus der es fast kein Entkommen gibt. Bilder, die mit wenigen Sätzen ganze Geschichten öffnen. Sätze, die in ihrer Poesie nachhallen. Kein Roman der lauten Töne, dafür einer tiefen Wärme!
 Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.
Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.
Illustrationen © Lea Le / literaturblatt.ch