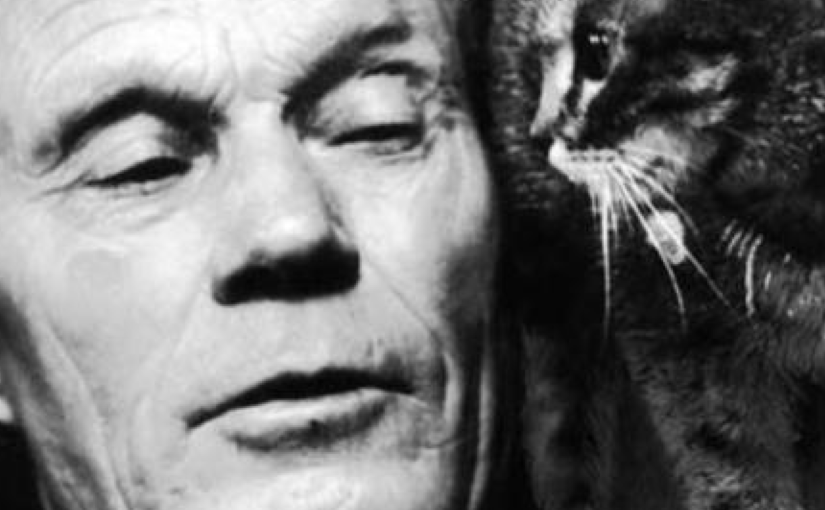Doris Lessing schrieb über diesen Roman: So feinsinnig. So stark. So anders als alle anderen. Er ist einzigartig. Er ist unvergesslich. Er ist aussergewöhnlich. «Das Eis-Schloss» von Tarjei Vesaas – unbedingt lesen. Ein Roman über die Kälte eines Versprechens.
Ist Literatur haltbar? Man kann diese Frage mehrdeutig verstehen. Aber so wie bei Lebensmitteln, und Literatur zählt zumindest für mich zu den unverzichtbaren Lebensmitteln, Haltbarkeit eine entscheidende Rolle spielt, zeigt es sich auch bei Büchern, dass nicht jeder Text über Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte haltbar ist. Heute, wo vieles auf dem Schaffot der Kulturellen Aneignung hingerichtet wird und Gendersensibilität Texte aus der Vergangenheit ungeniessbar zu machen droht, muss Literatur ganz vielen Parametern genügen, um haltbar bleiben zu können.
Ja, es gibt Literatur, die anderen Haltbarkeitsgesetzen unterworfen ist, als andere. Vielleicht sind es die Klassiker. Aber ganz offensichtlich passiert es immer und immer wieder, dass Literatur, KünstlerInnen im kollektiven Bewusstsein vergessen gehen. Nicht, weil das, was sie erschufen, nicht mehr zeitgemäss ist, sondern weil die schiere Masse von immer Neuem das eine oder andere wegspült. In der Literatur nicht anders wie in allen anderen Kunstsparten.

Glücklicherweise gibt es immer wieder VerlegerInnen, die sich genau jenen Namen annehmen. Nicht auszudenken, was aus dem Werk Franz Kafkas geworden wäre ohne den Verleger Kurt Wolff. Nicht ganz so dramatisch verhält es sich mit dem norwegischen Schriftsteller Tarjei Vesaas, der dank dem Verleger Sebastian Guggolz und seinem 2014 gegründeten Guggolz-Verlag eine deutsche Bühne bekommt, der bislang drei Romane des einstmals für den Nobelpreis vorgeschlagenen und ausserhalb Norwegens fast vergessenen Autors herausbrachte. Romane, die nichts von ihrer Kraft verloren haben. Romane, die, obwohl sie von vergangenen Zeiten erzählen und Technik nur ganz am Rande eine absolut nebensächliche Rolle spielt, nichts von ihrer Gültigkeit eingebüsst haben, die mit einer Intensität erzählen, die selten ist und sich ganz auf Innenwelten konzentrieren, selbst dann, wenn die Landschaft, die Kulisse eine entscheidende Rolle spielt.
„Das Eis-Schloss“ von Tarjei Vesaas, das 1963 in Norwegen und 1966 erstmals auf Deutsch erschien, zählt zum Spätwerk des Autors, der sich bereits in den Zwischenkriegsjahren über Norwegen hinaus einen Namen machte. Bei Guggolz erschienen „Der Keim“ (in Norwegen 1940), „Die Vögel“ (1957) und „Das Eis-Schloss“, das auch verfilmt wurde. Zu hoffen ist, dass noch mehr vom umfangreichen Werk dieses Dichters in den wunderschönen Ausgaben aus dem Hause Guggolz erscheint.
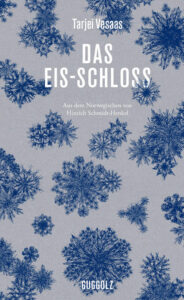
In „Das Eis-Schloss“ erzählt Tarjei Vesaas von der Freundschaft zweier elfjähriger Mädchen zu Beginn eines kalten norwegischen Winters. Unn kommt als Waise zu ihrer alleine lebenden Tante in einem namenlosen Dorf, weitab von den grossen Strassen des Landes. In der Schule bleibt sie seltsam distanziert, umgibt sich mit einer Hülle aus Traurigkeit und Unnahbarkeit. Aber genau deshalb fühlt sich Siss zu dem Mädchen aus der Fremde hingezogen, nähert sich vorsichtig an und trifft sich ein erstes Mal in ihrem neuen Zuhause, dem kleinen Haus der Tante.
Es ist schon dunkel, als sich Siss auf den Weg macht, voller Spannung, mit dem grossen Versprechen, eine Freundin zu finden. Siss wird freundlich begrüsst, auch von der Tante. Aber als die beiden Mädchen in Unns kleinem Zimmer sitzen, spürt Siss, wie sehr Unn damit ringt, etwas loszuwerden, ein Geheimnis zu teilen. Aber Unn gelingt es nicht, einzig Siss das Versprechen abzuringen, immer ihre Freundin zu bleiben, sich nie von ihr abzuwenden. Eine Begegnung, die beide Mädchen zu tiefst aufwühlt, weil sie eine Art der Nähe offenbart, die sie beide bisher nicht kannten.
Unn schafft es am nächsten Tag nicht, in die Schule zu gehen. Sie verlässt morgens warm eingepackt wohl das Haus der Tante, macht sich aber auf dem Weg zum See, zum Fluss, zum Wasserfall, der in den späten Herbstwochen zu einem Eisschloss wächst, einem beinah mytischen Gebilde aus Türmen, Zinnen, Hohlräumen und Spalten. Unn verliert sich nicht nur im Labyrith des Eisschlosses, sie verliert sich auch mehr und mehr in der Not, die schon lange, mit dem Tod ihrer Mutter, ihrer immer tiefer werdenden Einsamkeit, das Dunkel eines Abgrunds öffnete. Unn erfriert.
Was am Abend, nachdem Unns Tante erfährt, dass Unn nie in der Schule aufgetaucht war, als hektische Suche einer ganzen Dorfgemeinschaft beginnt, wird zum hoffnungslosen Tappen im Dunkeln, weil in genau dieser Nacht das grosse Schneien beginnt und alles, was eine Spur hätte sein können, zudeckt. Was der Schnee nicht zudeckt sind Siss’ Schuldgefühle, die Ahnung, viel mehr als eine Freundin verloren zu haben. Man bedrängt Siss, weil man nicht glauben will, dass Siss nicht mehr weiss, als das, was sie preisgibt. Siss zieht sich zurück, schliesst sich ein. So wie Unn im Eisschloss erfriert, so erfriert Siss in ihrer Einsamkeit, ihrer Angst, ihrer Trauer.

Es ist kalt in diesem Roman. Unn und Siss leben als Elfjährige erst an den Grenzen zur Rationalität, noch ganz in einer kindlichen Unmittelbarkeit. Dieser Roman lebt zum einen von der Dramatik der Geschichte, aber viel mehr von den inneren Bildern dieser zwei in sich gefangenen Mädchen. Es sind die Beschreibungen von Empfindungen. Tarjei Vesaas war weit über sechzig, als er diesen Roman schrieb. Aber ganz offensichtlich hat er viel von dieser kindlichen Sichtweise, diesen Empfindungen bewahren können. „Das Eis-Schloss“ ist mit aller Empathie geschrieben, aller Wärme geschrieben und beschreibt eine mytische Welt der Kälte und des Eises. Unglaublich atmosphärisch geschrieben, suggestiv und von einer Intensität, die man nur in kleinen Schlucken wirklich auskosten kann.
Dringend empfohlen!
Tarjei Vesaas (1897–1970) war der älteste Sohn eines Bauern in Vinje/Telemark, dessen Familie seit 300 Jahren im selben Haus lebte. Vesaas wusste früh, dass er Schriftsteller werden wollte, verweigerte die traditionsgemässe Übernahme des Hofes und bereiste in den 1920er und 1930er Jahren Europa. 1934 heiratete er die Lyrikerin Halldis Moren und ließ sich bis zu seinem Tod 1970 in der Heimatgemeinde Vinje auf dem nahe gelegenen Hof Midtbø nieder. Vesaas verfasste Gedichte, Dramen, Kurzprosa und Romane, die ihm internationalen Ruhm einbrachten. Er schrieb seine Romane auf Nynorsk, der norwegischen Sprache, die – anders als Bokmål, das «Buch-Norwegisch» – auf westnorwegischen Dialekten basiert. Abseits der Grossstädte schuf Vesaas ein dennoch hochmodernes, lyrisch-präzise verknapptes Werk mit rätselhaft-symbolistischen Zügen, für das er mehrmals für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Als seine grössten Meisterwerke gelten «Das Eis-Schloss», für das er 1964 den Preis des Nordischen Rats erhielt, und «Die Vögel«, das Karl-Ove Knausgård als «besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde» bezeichnete.
Hinrich Schmidt-Henkel, geboren 1959 in Berlin, übersetzt aus dem Französischen, Norwegischen und Italienischen u. a. Werke von Henrik Ibsen, Kjell Askildsen, Jon Fosse, Tomas Espedal, Louis-Ferdinand Céline, Édouard Louis und Tarjei Vesaas. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. (gemeinsam mit Frank Heibert) mit dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW und zuletzt 2018 mit dem Königlich Norwegischen Verdienstorden.
Tarjei Vesaas «Boot am Abend. Nimm meine Hand. Der wilde Reiter», Rezension auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Rolf Chr. Ulrichsen