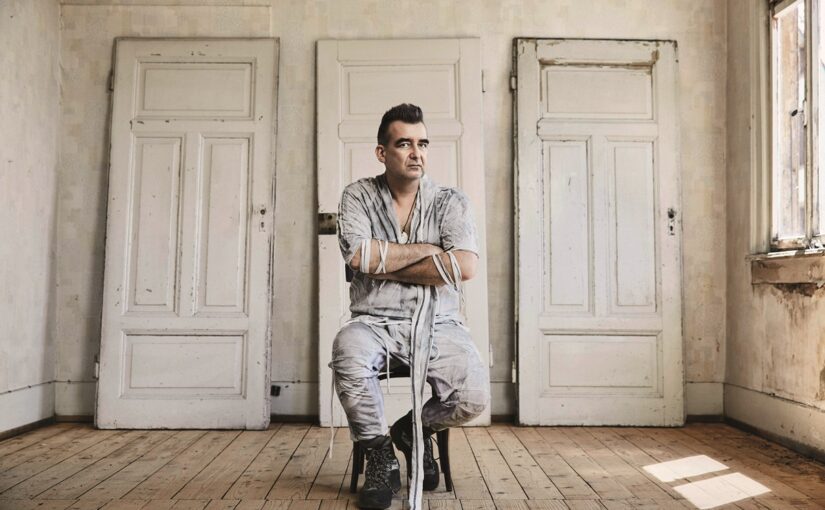Michael Stavarič erfindet sich mit jedem seiner Bücher neu. Er kennt keine Grenzen. Seine Fähigkeit, sich in beinahe kindliche Welten zu versetzen, seinen Blick auf die Welt von allen Konventionen zu befreien, macht Michael Stavaričs Literatur zu einer echten Tiefenerfahrung. Sein Roman „Die Schattenfängerin“ ist bestes Beispiel dafür.
„Die Schattenfängerin“ erzählt aus der Sicht von Stella, einer Jugendlichen, die zur jungen Frau wird, einem jungen Menschen, die den jugendlichen Blick bewahren, ihre ganz eigene Welt bewahren kann, obwohl es ihr das Schicksal nicht leicht macht. Michael Stavarič macht sich zur Stimme dieser jungen Frau, lässt seiner Erzählfreude freien Lauf, entkrampft und losgelöst. Da schreibt einer, der nicht einfach eine Geschichte wiedergeben will, nacherzählen. Michael Stavarič schöpft Neues, evoziert Bilder, die während des Lesens Fragen stellen, wichtige Fragen. „Die Schattenfängerin“ erzählt von Rätseln und lässt sie stehen, von einem rätselhaften Kind, das sich nach dem Tod seines Vaters auf den Weg macht. Das mag märchenhaft klingen, was bei „Die Schattenfängerin“ auch nicht falsch ist. Und doch bleibt der Roman ganz nah an der Welt.
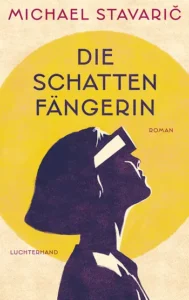
Stella wohnt mit ihrem Vater in einem Haus weg vom Dorf, auf einem Hügel. An ihr Grundstück grenzt nur dasjenige der Nachbarn, die dann nach Stella schauen, wenn ihr Vater wieder einmal weit weg auf Reisen ist, wenn er sich aufmacht, einmal mehr Zeuge einer Sonnenfinsternis zu werden, weit weg. Ein Umstand, den Stella zu akzeptieren gelernt hat, ohne zu verstehen, warum sie ihren Vater auf diesen Reisen nicht begleiten darf. Die Beziehung zwischem ihm und Stella, zwischen Vater und Tochter, ist eine beinah symbiotische. Stella geht nicht zur Schule, wird von ihrem Vater unterrichtet. Er zeigt ihr seine Welt, erklärt der immer hungrigen Stella all die Geheimnisse, die sich im Grossen und Kleinen auftun, wenn man bereit ist, hinzuschauen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Stella Pflanzenlexika, Anatomiebücher und juristische Werke wie einen Schatz hortet, Bücher aus der grossen Bibliothek ihres Vaters. Das Haus am Hügel ist das Tor zur Welt.
Doch eines Morgens wacht ihr Vater nicht mehr auf. Stella muss akzeptieren, dass ihr Vater eine Reise angetreten hat, von der er nicht zurückkommt. Stella ist fünfzehn, als es geschieht. Und nur weil Stella es schon immer gewohnt ist, auf eigenen Füssen zu stehen und ihr die Nachbarn auch in dieser Zeit fürs erste an ihrer Seite sind, darf sie bleiben, zwingen sie die Ämter nicht dazu, das Haus des Vaters verlassen zu müssen. Auf sich selbst gestellt, finanziell von ihrem Vater abgesichert, macht sich Stella auf, jenen Teil ihres Lebens zu erkunden, der ihr bisher verschlossen blieb. Der in vielen Kisten auf dem Dachboden ihres Hauses lagert. Hin zu ihrer Mutter, die seit vielen Jahren in einer Klinik vegetiert, von der ihr ihr Vater fast nichts erzählte, die in ihrem Leben kaum eine Rolle spielt. In ein Leben, das sich auch ausserhalb ihrer kleinen Welt abspielen muss. Auf den Friedhof, wo das Grab ihres Vaters ist, wo sie sich mit Kurti, dem Totengräber anfreundet und zur jüngsten Totengräberin des Landes wird. Und auf diese eine, erste, grosse Reise zur nächsten Sonnenfinsternis, jener Reise, zu der ihr Vater sie nie mitnehmen wollte, von der sie ahnt, das mehr zu fangen ist, als der lange Schatten der Sonne.
Es ist die Art des Erzählens, die fasziniert. Michael Stavarič scheint einer der wenigen Erwachsenen zu sein, die in sich den kindlichen Blick bewahren konnten, die unverbaute Sicht auf die Welt. Seine Art des Beschreibens erinnert an den Blick eines Autisten, der alles in sich aufnimmt, nicht filtern will und kann. Es gibt Stellen in diesem Buch, in denen sich Sinneseindrücke förmlich über mich ergiessen. Beschreibungen, die mir bewusst machen, wie gezielt, wie kausalisiert, wie ordnend mein Blick ist.
Ein wundersames Stück Literatur!
„Romane, wie sie Michael Stavarič schreibt, schreibt gegenwärtig sonst niemand.“ Frankfurter Rundschau
Interview
Der Buchmarkt ist voll mit Literatur, die sich mit Müttern und Vätern abmüht, Abrechnungen, Prozesse, Befreiungen, Konfrontationen… Dein Buch ist eine gegenseitige Liebeserklärung zwischen Tochter und Vater, auch wenn Schatten im Leben des Vaters geblieben sind. Gleichzeitig ist es ein Statement dafür, den eigenen Weg, den eigenen Blick zu finden, ohne Rücksicht auf Konventionen. Ein grosses Stück Michael Stavarič!?
Besser vielleicht: Ein weiteres Stück von Michael Stavarič auf seinem literarischen Weg. Selbstverständlich ist die Literatur voller Beziehungen und Befindlichkeiten, schließlich ist das der Faktor „Mensch“. Autor*innen schreiben über Dinge, von denen sie hoffen, dass sie bei Lesenden nicht auf taube Ohren stoßen; Vater-Tochter-Mutter-Sohn – es ist ein absolutes Grundmotiv in nahezu jedem Buch. Ich habe in der „Schattenfängerin“ versucht, ein positives Bild einer Beziehung zu zeigen (was eigentlich so gar nicht meiner literarischen Tradition entspricht), vor allem auch deshalb, weil ich dieses Buch nicht nur für Erwachsene, sondern auch Jugendliche schrieb. Zumindest schwebte mir vor, dass es auch Jugendliche lesen können sollten – und dementsprechend habe ich meine übliche Konzeption etwas geändert. Ich dachte auch, in diesen Zeiten brauchen wir alle eine positive Heldin. Und einen ungewöhnlichen Twist.
Dein Roman spielt in der Gegenwart, auch wenn die Welt von Stella entrückt scheint. Stella wächst auf in einer Welt, in der Neugier den Puls ausmacht. Stella betäubt sich nicht, ihr Vater lässt sich und seine Tochter nicht betäuben – das Gegenteil von dem, was in vielen Familien geschieht. Alles an deinem Schreiben ist ein Statement für die Neugier, kindliche, unregulierte Neugier. Schreiben als Spur deiner eigenen Neugier?
Weltoffenheit entgegen allen Widerständen, so könnte ich es für mich zusammenfassen. Die Neugier ist dabei ein unerlässlicher Motivationsfaktor, sich auf die Welt einzulassen, sich in ihr zu orientieren, die hellen und dunklen Momente zu erkennen. Und sich vielleicht selbst aktiv entscheiden, auf welcher Seite man stehen mag. Außerdem ist die Welt nicht einfach nur unsere Erde, hierzu zähle ich auch das Sonnensystem, ja den ganzen Kosmos. Und die Sonne ist nicht zuletzt auch der Angelpunkt in diesem Roman. Ich erkenne für mich immer mehr, dass es beim eigenen Schreiben auch darum geht, die Lücken zu füllen, die man selbst aufweist. Das Schreiben macht mich kompletter, wissbegieriger und neugieriger. Vermutlich eine Erfahrung, die ich auch an meine Protagonisten weitergeben möchte.
Und doch ist Stellas Familie alles andere als ein harmonisches Gefüge. Stellas Vater taucht für seine Reisen immer wieder einmal für Wochen ab und Stellas Mutter vergetiert in einer Klinik, von ihrem Mann aufgegeben, von der Medizin parkiert. Viele Schatten in deiner Geschichte. Schatten, denen Stella zu begegnen versucht. Du räumst nicht auf in deinem Roman. „Aufräumen“ scheint ein weit verbreitetes Erzählprinzip zu sein. Ein Konterroman?
In einem Leben (egal wer es lebt) geht es nun mal nicht ohne Zäsuren, Tragödien, Bewährungsproben etc. ab; Identitätsstiftung ist anders nicht zu haben, denn nur so können Persönlichkeiten entstehen. Oder ich bleibe in diesem Fall lieber dabei: Heldinnen. Ich verstehe ein „Nicht-Aufräumen“ als erzählerische Qualität, es scheint mir näher am Leben zu sein. Vieles lässt sich auch gar nicht schlüssig begründen, analysieren und zu Ende erzählen (und erklären!). Insofern ist es wohl ein Konterroman, weil die übliche Haltung wohl wäre: Ich erzähle alles zu Ende – und auch gleich mit, was der/die Leserin davon zu halten hat. Das machen viele Romane unserer Zeit. Aber ihnen fehlt dann (aus meiner Sicht) der Zauber …
Manchmal erinnert mich das Personal in deinem Roman an ein Theaterstück; Ein Kind an der Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein, eine Peter-Pan-Figur, der Totengräber Kurti, der Bürgermeister, der besorgte und mahnende Pfarrer… Wie hast du dich durch deine Ideen geschrieben? War da ein Plan oder sind die Personen während des Schreibens aufgetaucht?
Da hast du absolut recht. Theaterstück/Filmdrehbuch, etwas dazwischen. Ich habe es wirklich auch selbst so aufgefasst, insofern war ich die ganze Zeit über damit beschäftigt (beim Schreiben), Stella mit einer imaginären Kamera zu folgen. Oder wie ein Dramaturg/Regisseur die Handlung mit „Zurufen“ zu steuern. Alle prägenden Figuren in ihrer Kindheit sind Männer, insofern waren diese von Anfang an bewusst so konzipiert. Stella versucht sich nicht zuletzt auch im Umgang mit dem männlichen Prinzip.
Du hat deine Lust auf Fussnoten ausgelebt. Darin finden sich immer wieder Listen, Aufzählungen, Assoziationen. Texte, die mich mit einem Sternchen aus dem Lesefluss ziehen, die das Buch zwinkern lassen, die etwas von Stellas Lebensfreude, ihrem Blick auf die Welt zeigen. Wie kam es zu diesen literarischen Kringeln?
Du weißt ja, meine Romane sind oft von formalen Fragen geprägt, um nicht wieder mal zu sagen, Form vor Inhalt. In der Schattenfängerin habe ich mich aufs Erzählen konzentriert, wobei das Buch ja für jüngeres Publikum lesbar bleiben musste. Die Fußnoten sind gewissermaßen ein „formales Augenzwinkern“, wo ich diesen Hang zum Experimentellen kurz ausleben durfte. Minimal, aber doch. Schließlich würde wohl niemand in einem solchen Buch Fußnoten erwarten?
Michael Stavarič wurde 1972 in Brno (Tschechoslowakei) geboren. Er lebt als freier Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Wien. Studierte an der Universität Wien Bohemistik und Publizistik/Kommunikationswissenschaften. Über 10 Jahre lang tätig an der Sportuniversität Wien – als Lehrbeauftragter fürs Inline-Skating. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, darunter: Adelbert-Chamisso-Preis und Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Zuletzt erschien bei Luchterhand der Roman «Das Phantom».
Mehr von und über Michael Stavarič auf literaurblatt.ch
Beitragsbild © Yves Noir