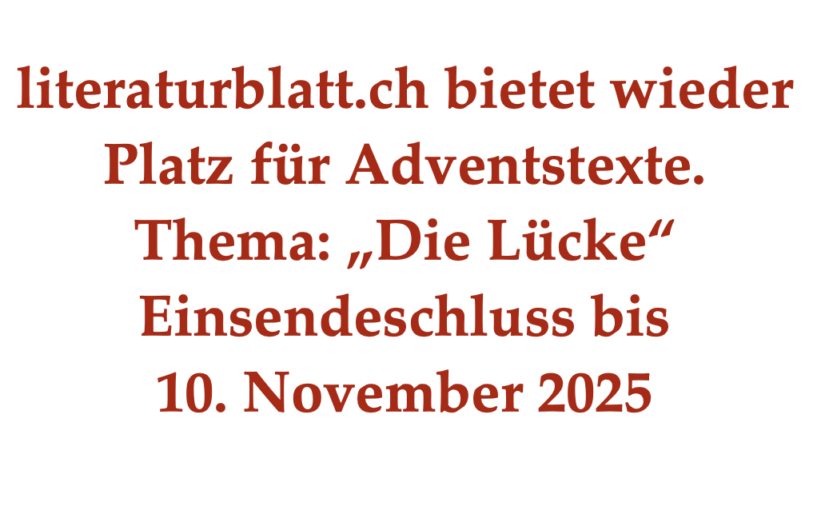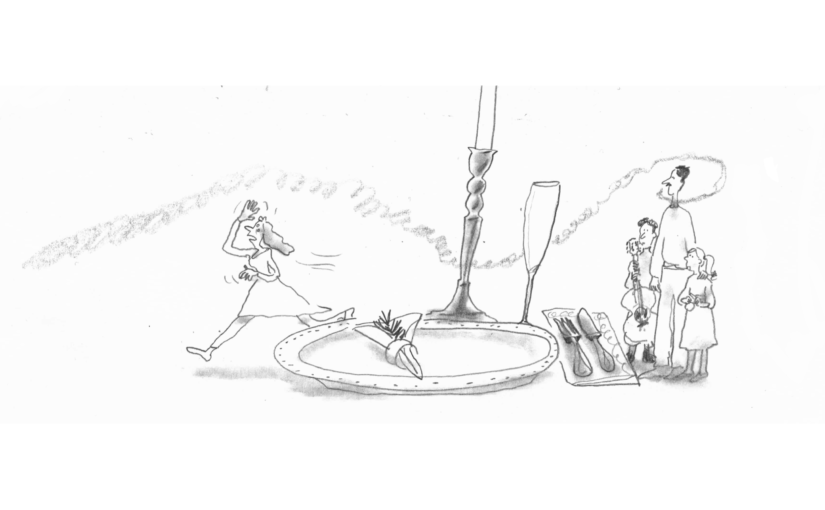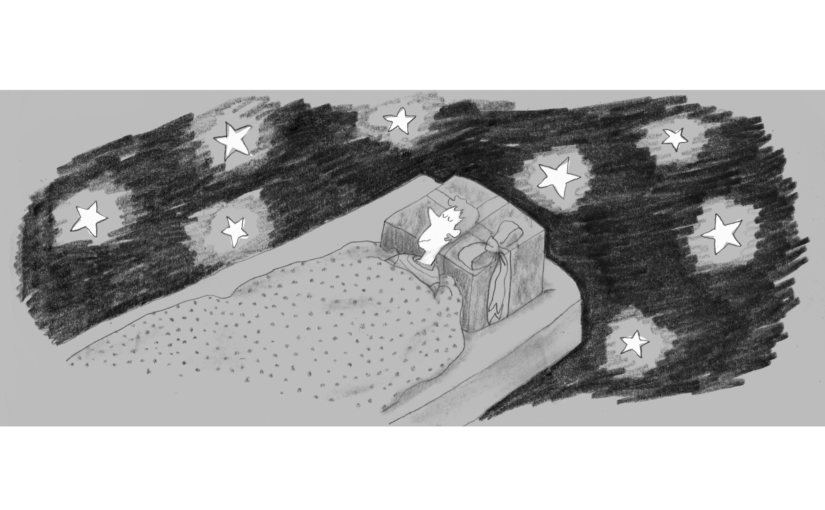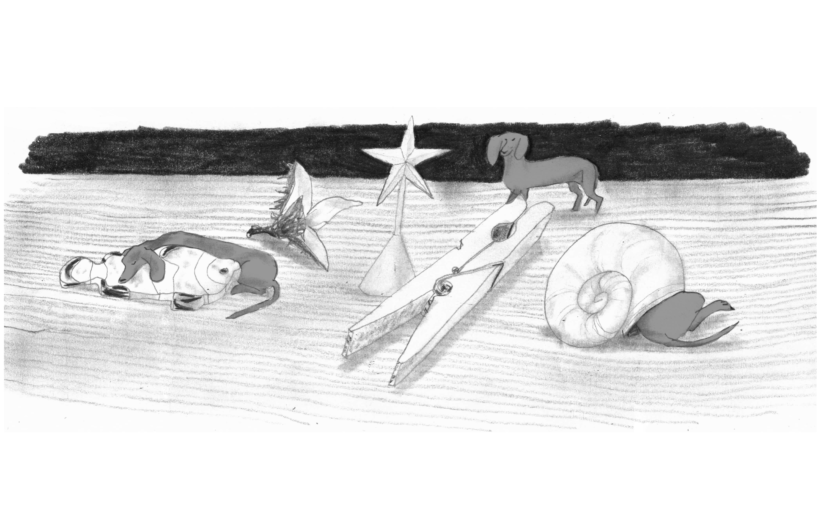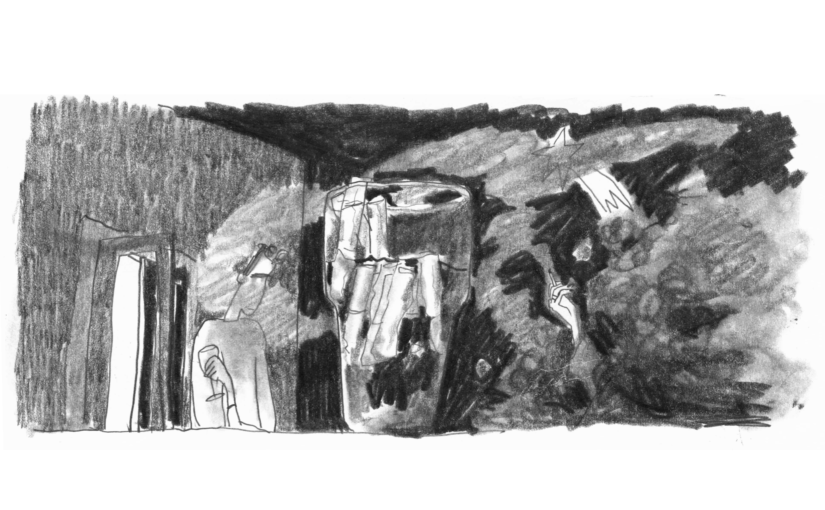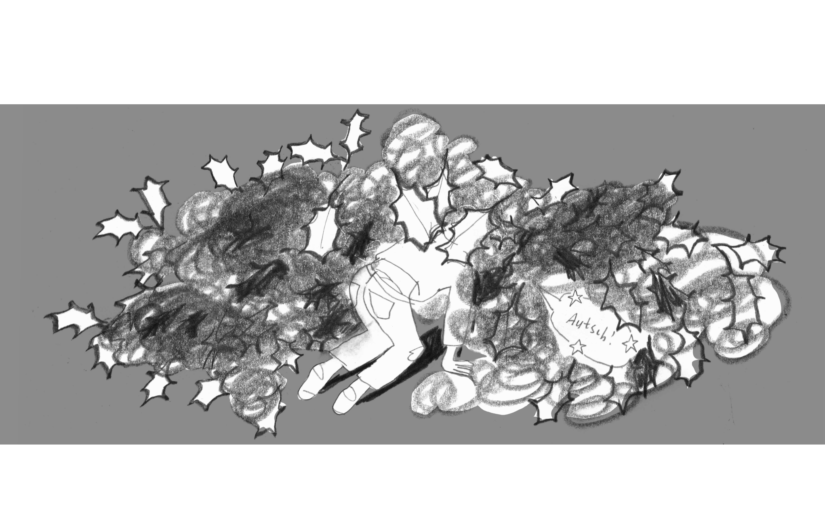- nicht mehr als 10000 Zeichen (inkl. Satzzeichen und Leerschläge)
- Textart ist frei.
- keine Garantie, dass der Text zu Veröffentlichung kommt
- bitte mit AutorInnenfoto (im Querformat, in geeigneter Auflösung) und Kurzvita
- keine Fotos von Texten, sondern Textdateien
- bitte an info[at]literaturblatt.ch
- Die ausgewählten, veröffentlichten Texte werden von Lea Le illustriert und stehen danach samt Illustration zur freien Verfügung.
Schlagwort: Tschuldigung
Heidi Engel «Goldene Herzen» – «Tschuldigung» 10
Seit einer Woche bereitet Josephine das Weihnachtsfest vor. Alles muss seine Richtigkeit haben. Paul, ihr Mann, legt großen Wert darauf.
Heute an Heiligabend wird mit ihrem Mann Paul und den beiden Kindern Maria und Thomas gefeiert. Am ersten Weihnachtstag mit ihren Eltern und Geschwistern und am zweiten Weihnachtstag mit Pauls großer Familie.
Im ganzen Haus duftet es nach Zimt, Orangen und frisch gebackenem Konfekt. Überall sind Nippes aufgestellt. Selbstgebastelte Sterne hängen von der Decke und an den Fenstern sind Klebebilder angebracht. Ab Mitte November bis Ende Dezember läuft beständig Weihnachtsmusik, dass einem die Ohren abfallen.
Nach dem Mittag geht Paul mit den Kindern auf dem Markt, um einen Tannenbaum auszusuchen. Das hat eine lange Tradition. Schon Paul ging mit seinem Vater auf Tannenbaumschau. Dieser wiederum mit seinem Vater. Das reicht weit zurück und Paul ist stolz darauf.
Josephine holt derweil den Schmuck vom Dachboden. Sie entscheidet sich für die goldenen Kugeln. Die Kugeln in Silber und Bordeaux bleiben wohl verstaut in ihren Kisten.
Die von Großvater gezimmerte Holzkrippe samt Holzfiguren und den Baumschmuck stellt Josephine im Wohnzimmer auf das Sofa.
Sie steckt gerade die letzte rote Kerze in den Kerzenhalter, als die Tür auffliegt und Maria hereinstürmt. Sie bringt Kälte und die ersten Schneeflocken mit. Alle befürchteten, dass es dieses Jahr erneut grüne Weihnachten geben würde.
»Mama! Wir haben einen riesen Baum ausgesucht. Du wirst staunen.« Ihre Wangen und die Nase sind rosig ab der Kälte.
Paul und Thomas bugsieren das Ungetüm ins Wohnzimmer.
»Eine Blautanne hatten wir noch nie. Das habt ihr toll gemacht.« Josephine drückt beide Kinder an sich und gibt Paul einen Kuss.
»Möchtet ihr eine heiße Schokolade, bevor ihr die Tanne schmückt?«
»Ou ja!« Die Kinder flitzen in die Küche und eine lachende Josephine folgt ihnen. Paul bleibt zurück und befreit die Tanne aus dem Netz.
Nach der Stärkung kehren sie lachend ins Wohnzimmer zurück. Alle bleiben sie am Türrahmen stehen und bestaunen die Tanne, deren Eleganz erst jetzt zum Tragen kommt. Paul kniet unter den Zweigen und justiert den Stamm im extra dafür vorgesehenen Ständer.
»Steht sie gerade?«, fragt er in die Runde.
»Perfekt!«, echot es im Chor.
Maria inspiziert die Kiste und rümpft umgehend die Nase. »Ich will nicht die goldenen Kugeln!« Sie verschränkt die Arme und stampft mit dem Fuß auf. »Ich will die Bordeauxfarbigen.«
»Entschuldige Maria, aber ich dachte, wir wechseln jedes Jahr die Farbe. Das hatten wir gestern besprochen. Mit der Zeit wird es langweilig, wenn wir immer dieselben nehmen.«
»Mir egal. Ich will Bordeaux.«
Josephine möchte über die Weihnachtszeit kein nörgelndes Kind. Zumal ihr Ältester bis jetzt noch keine Flausen im Kopf hat. Daher holt sie die gewünschten Kugeln.
Wenige Minuten später kehrt sie zurück.
»Die Farbe der Kerzen passt nicht zu den Kugeln.« Die fünfjährige Tochter stemmt die Hände in die Hüfte und schiebt die Unterlippe vor.
»Ich habe keine anderen. Tut mir leid. Wir müssen mit diesen vorlieb nehmen, ob du willst oder nicht.« Sie wirft hilfesuchend einen Blick zu ihrem Mann, doch der verlässt im selben Moment den Raum. Toll!
»Ich will Glitzer.«
»Du kannst sie mit deinen Zauberstiften anmalen.«
»Juhuu!« Hüpfend springt die Kleine davon, um die Stifte zu holen.
Glück gehabt, denkt sich Josephine.
Thomas hängt die Kugeln auf, welche Maria mittlerweile vergessen hat. Zu beschäftigt ist sie mit dem Bemalen der Kerzen. Zufriedene Minuten, bei denen das wohlige Weihnachtsgefühl in Josephine aufflammt. Leise verlässt sie das Zimmer, um sich einen Tee zu gönnen.
»Der Josef gehört nicht dahin. Da kommen die Könige. Mamaaaaa! Thomas macht alles falsch. Mamaaa!«
»Nein, das ist korrekt.«
»Was ist den nicht okay?« Josephine kniet sich zu den beiden Kindern hin. Die vorherige Idylle dauerte gerade mal eine Tasse Tee aufbrühen.
»Kuck doch.« Marias Patschhändchen zeigen auf den Josef.
»Ja, der steht nicht an den für ihn vorgesehenen Platz.« Sie blickt ihren Sohn an. Sein spitzbübisches Grinsen verrät ihn sofort. »Maria, du darfst die Figuren umordnen. Danach machen wir uns frisch und ziehen die neuen Kleider an.«
Um fünf Uhr stehen alle chic angezogen vor dem Weihnachtsbaum. Die Geschenke, welche mit Schleifchen und buntem Papier um die Wette glitzern, sind geschmackvoll unter dem Baum verteilt.
»Bevor wir die Geschenke öffnen, möchte ich, dass wir ein Lied singen. Oder trägst du, Maria, zuerst ein Stück mit der Blockflöte vor?«
»Ich will nicht!«
»Na gut, dann singen wir.« Josephine räuspert sich und stimmt ›stille Nacht, Heilige Nacht‹ an.
»Halt!«, ruft Thomas.
»Ich will mit meiner Gitarre ein Lied vortragen.«
»Gerne.«
»Dann spiele ich Blockflöte.«
Thomas stimmt die ersten Noten an und Maria fängt kurz darauf an. Natürlich nicht dasselbe Lied. Das wäre zu schön gewesen.
»Kinder, Kinder. Bitte eines nach dem anderen.«
»Ich zuerst!«
»Nein, ich. Mami hat mich zuerst gefragt.«
»Aber du wolltest nicht und nun bin ich dran.«
»Neeeeiiiiinn!«
Thomas zieht an Marias Haaren und sie fängt an zu weinen.
»Könnt ihr nicht an einem einzigen Abend ohne Streitereien auskommen?«, fragt Paul.
»Ich habe gar nichts gemacht«, meint Thomas. Der zwei Jahre älter als seine Schwester ist.
»Warum weint dann Maria?« Paul blickt von einem Kind zum anderen.
Er zuckt mit den Schultern.
»Was riecht hier verbrannt?« Ihr Mann streckt seine Nase in die Höhe und schnuppert. Umgehend ist der Streit vergessen.
»Oh nein!« Josephine eilt in die Küche. Ein bissiger Rauch empfängt sie. Sie hält sich den Ärmel vor Mund und Nase. Derweil öffnet sie mit der freien Hand den Backofen und zieht den Braten – wenn man es noch so nennen darf – heraus.
»Mist!« Mit verschränkten Armen steht sie vor dem Kohlenstück.
»Und was essen wir nun?« Paul ist zu ihr getreten.
»Entschuldige. Das ist mir noch nie geschehen.« Josephine fährt sich durch die Haare. »Wir müssen uns wohl mit den Beilagen begnügen.« Sie versucht, zu lächeln, was eher einer Grimasse gleichkommt.
»Aber der Braten hat Tradition.«
»Meinst du, das weiß ich nicht?«, gibt sie schroff zurück.
»Du brauchst mich nicht anzuschnauzen.«
»Entschuldige bitte. Ich …«
»Mamaaaaaa! Der Baum brennt.«
Wie von Taranteln gestochen, rennen sie ins Wohnzimmer. Während sie das Sofa passieren, greift Josephine reflexartig zur Decke und wirft sie über den Baum. Dieser verliert sein Gleichgewicht und fällt zu Boden. Abgebrochene Kerzenstücke und Kugelteile schauen unter der Decke hervor.
»Meine schönen Kerzen sind kaputt«, schreit Maria. »Du hast die Kerzen und die Kugeln kaputt gemacht.« Ihre Augen füllen sich erneut mit Tränen. Unglaublich, was das Kind an Augenpipi produzieren kann.
»Entschuldige, aber sonst hätte das Wohnzimmer Feuer gefangen. Hättest du das gewollt?«
»Und was ist mit den Geschenken?«, will Thomas wissen.
»Paul, schau bitte nach.« Josephine ist zu aufgewühlt.
Die Worte lösen ihn aus seiner Starre. Er hebt die Decke an und holt die Pakete hervor.
»Sind alle ganz. Zum Glück.«
»Gut.« Josephines Herzschlag beruhigt sich. Immer wird an ihr herumgenörgelt, obwohl sie den gesamten Haushalt zusammenhält. Sie fühlt sich leer. Würde sich am liebsten ins Bett verkriechen. Aber sie muss stark bleiben. Stark für zwei Kinder und ein großes.
»Ich habe Hunger. Wann gibt es zu essen?«, will Thomas wissen.
»Ich habe auch Hunger«, jammert Maria.
»Was gibt es denn nun? Der Braten ist verkohlt. Nur Beilagen ist langweilig«, zetert Paul.
»Pizza?«
»An Heiligabend?« Thomas sieht sie mit großen Augen an.
»Warum nicht?«
»Was ist mit der Tradition?«, will ihr Mann wissen.
»Die holen wir Morgen und Übermorgen nach.«
Die Tanne steht wieder an ihrem Platz. Die versengte Seite nach hinten gekehrt und diesmal ohne Kerzen. Davor ist eine Decke ausgebreitet. Darauf steht der Salontisch mit vier Fußschemeln.
Josephine legt gerade die Teller und das Besteck auf den Tisch, als es klingelt. Die Kinder eilen zur Tür. Pizza an Heiligabend, wann gab es das denn?
»Würdest du bitte die Rechnung begleichen?«
»Was?«
»Die Rechnung.«
»Natürlich.« Paul erhebt sich und geht zur Tür.
Die Kinder tragen stolz die Kartonschachteln ins Wohnzimmer.
»Riech mal Mama.«
»Lecker.«
Die Pizzen sind gegessen. Nun warten die Geschenke, die während des Essens von neugierigen Kinderaugen taxiert wurden.
»Ich zuerst!«
»Nein, ich zuerst.«
»Kinder! Zuerst die Mama. So wie wir es besprochen haben.«
Perplex sieht Josephine zu ihrem Mann. Noch nie durfte sie als Erste ein Geschenk auspacken. Selbst an ihrem Geburtstag haben die Kinder für sie die Präsente ausgepackt.
Thomas überreicht ihr eine kleine Schatulle. »Mama, ich möchte mich bei dir bedanken und entschuldige mich, dass ich nicht immer lieb zu dir bin.«
Josephines Augen glänzen. Sie öffnet die Schatulle und entnimmt einen goldenen Anhänger in der Form eines T.
»Vielen lieben Dank mein Schatz. Lass dich drücken.«
»Nun ich!« Maria legt ihr sorgfältig eine selbstgebastelte Schachtel aus Papier in die Hand. »Mami. Danke, dass du mir das Essen kochst und die Wäsche machst. Und mich badest und mir vorliest.«
Josephine bekundet Mühe, die Tränen zurückzubehalten.
»Und ich versuche, nicht mehr böse zu werden. Entschuldige.«
»Mein Schatz.« Sie drückt den kleinen Wonneproben an sich.
»Du hast mein Geschenk noch nicht geöffnet!«
»Sofort.«
Zum Vorschein kommt erneut ein goldener Anhänger. Aber diesmal als M.
Die Tränen bahnen sich ihren Weg. Glücklich schließt sie die Kinder in die Arme.
»Mein Liebling.« Paul kniet vor sie hin. Die Kinder zwischen ihnen. »Ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich zu wenig unterstütze und du den Haushalt alleine meistern musst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Auch wenn ich es nicht immer zeige. Ich hoffe, du weißt das ganz tief in dir drinnen.« Er räuspert sich. »Kinder, darf ich kurz die Mama umarmen? Ihr dürft nachher wieder.«
Murrend schälen sie sich aus Josephines Armen.
»Mein Liebling. Als kleine Aufmerksamkeit möchte ich dir diese Kette umlegen.« Er öffnet eine größere Schatulle. Zum Vorschein kommt eine goldene Kette mit zwei Anhängern, J und P, sowie fünf kleinen Herzen.
»Würdest du mir bitte die beiden Geschenke der Kinder überreichen?«
Paul fädelt die Anfangsbuchstaben und die Herzen geschickt auf. Am Ende ist ein Herz, ein Buchstabe, ein Herz, ein Buchstabe und so weiter aufgereiht. Paul legt Josephine die Kette an, zieht sie in eine feste Umarmung und küsst sie zärtlich.
»Danke«, haucht sie, immer noch um Fassung ringend ab der Überraschung.
»Ich liebe dich mein Liebling.«
»Ich dich auch.«
 Heidi Engel, 1984 geboren, ist verheiratet und hat ein Kind. Aktuell arbeitet sie als Leiterin Netze Gas und Wasser. Bisher hat Heidi Engel kein Buch veröffentlicht. Ihr erster Roman ist momentan bei BoD zur Bearbeitung. Die Veröffentlichung erfolgt noch im 2023.
Heidi Engel, 1984 geboren, ist verheiratet und hat ein Kind. Aktuell arbeitet sie als Leiterin Netze Gas und Wasser. Bisher hat Heidi Engel kein Buch veröffentlicht. Ihr erster Roman ist momentan bei BoD zur Bearbeitung. Die Veröffentlichung erfolgt noch im 2023.
(Alle Texte zum Thema «Tschuligung» sind Einsendungen nach einem Aufruf auf dieser Webseite. literaturblatt.ch begründet eine Nichtberücksichtigung der Texte nicht.)
Illustration © leale.ch
Silvia Ittensohn «Flimmern an Weihnachten» – «Tschuldigung» 9
Bitte lösen Sie vorsichtig die Hülle. Streichen Sie sie sanft glatt. Entnehmen Sie ihr drei bis fünf silbrig leuchtende Bänder. Merci! Betrachten Sie das Glitzern meiner Robe. Wie ich mich dankbar an einem grünen Ast herunterlehne. Erlöst von der Düsterheit eines Dachbodens. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie sich nicht allzu sehr blenden von meinem Kleid. Sein Glanz verkörpert auch Trübes. Keine übermäßige Eitelkeit. Aber einen üblen Umgang mit ‚Christbäumen‘ am 25. Dezember 1944.
Ja, ich weiß. Zum Leben gehört eine Vorder- und Rückseite. Drehen Sie also die Hülle mit der Gebrauchsanweisung um. Sehen Sie die bunte Landschaft mit Rentierschlitten, vorangetrieben von einem rundlichen Weihnachtsmann, sekundiert von einem Engel, über dem der Schriftzug ‚Eislametta‘ schwebt? Betrachten Sie das mir vertraute Milieu. Dann nach dem Entnehmen mein Glitzerkleid. Sein metallisches Leuchten. Denken Sie an die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts. An Tänzerinnen mit Bubiköpfen. An ihre mit Silberfäden durchwirkten Roben. An ihr Flimmern im Takt von Charleston beim Wechsel von X- zu O-Beinen. Oder an Liza Minnellis ‚Cabaret‘-Auftritt im Kit Kat Club in Berlin 1931, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Metallisch glänzen für kriegerische Zwecke, das tat ich zu meinem Bedauern 1944. Sonst glitzere ich jedes Jahr zwischen dem 24. und 25. Dezember nach dem Motto: gib und nimm. Lass strahlende Blicke auf Dir ruhen und spiegle sie dankbar zurück. Reziprok leuchten, darin steckt mein Glückselixier! Derart schaukle ich beseelt auf immergrünem Ast. Lasse mich sanft an ihm hinuntergleiten, meine Seele baumeln und vergesse die restlichen 350 bis 358 Tage im Dunkel eines Briefchens.
Nicht nur meine papierene Behausung, auch mein Name hat zwei Seiten. Er ist genauso ambivalent wie mein Bildnis. Wer in Italien nach mir ruft, verlangt eine zweischneidige Klinge aus Metall oder Blech. Wer mich auf Deutsch anspricht, – in abgehacktem Tonfall mit der Betonung auf „T“ – rattert meinen Namen militärisch scharfklingig herunter: „la-me-ta“. Wer ihn in sonorem Singsang wie ein Mantra wiederholt, betont den rituellen Charakter. Betont meine alljährliche Wiederkehr zur Weihnachtszeit: „la-me-ta, la-me-ta, la-me-ta!“. Nur im Singular, da klingt er lapidar: ‚Lametta“. Sich reimend auf „die mit zwei Saitn, wett ma“. Schon nach Geburt auf endlosem Band, als Teil eines Aluminiumblechs, offenbarte ich zwei Seiten. Ein Schweizer Industrieller hatte mich, ein Jahrhundert bevor Charleston getanzt wurde, in der deutschen Grenzstadt Singen vom Stapel einer Walze gelassen. Eine Seite rau, die andere glänzend, wett ma. In den Fünfziger und Sechziger Jahren sah man mich von der glänzendsten Seite. Man stöberte auf Weihnachtsmärkten nach ‚Brillant Eislametta‘ oder Qualitäts-Stanniol-Lametta‘, zögerte zwischen silbrig, goldig oder metallblau. Nahm mich wie ein Juwel in die Hände. Legte mich nach Ende der Weihnachtsfeier „schön gebügelt in eine Schachtel“ zurück.
Danach sank mein Renommee in den Keller. Das bügelt sich nicht schön. Meine raue Seite kam zum Vorschein. Im Ersten Weltkrieg geriet mein Name in Gefangenschaft. In die einer Verballhornung. Man verspottete die „Lametta auf der Brust“ von Offizieren, ihren Narzissmus, das „Klimpern der Lametta bei jeder Körperdrehung“. Das war das Vorspiel meiner Schandtat. Das Endspiel fand im Zweiten Weltkrieg statt. 1942 probierte Luftwaffenchef Hermann Göring unseren Kampfeinsatz. Wir Lametta gruppierten uns in sogenannten Düpeln, röhrenförmigen Stangen, um feindliche Radargeräte zu verwirren. Damit begann unser Kampf gegen sogenannte „brennende Christbäume“: gegen Leuchtkerzen, die auf deutsches Gebiet abgeworfen wurden. Von weitem sahen sie wie glitzernde Tannenbäume aus. Dank unserem Flimmern zerstreuten wir diese Sondierungsraketen, behinderten so auch feindliche Bombenabwürfe. Ebenso bot uns ab 1943 die gegnerische Seite auf. Im Auftrag der Alliierten in Wolken-Kommandos. Wie Cumuli regneten wir Metallpapierschnitzel vom Himmel herunter. Dass auch meine Geburtsstadt Singen mehrfach – am schwersten ausgerechnet an Weihnachten – bombardiert wurde, hatte unter anderem mit unserer erfolgreichen Behinderung der deutschen Flugabwehr zu tun. So gelang es am 25. Dezember 1944 den Alliierten in einer Großoffensive, 18 amerikanische Bomber und 90 Sprengbomben auf meine Geburtsstadt abzuwerfen, wobei 37 Menschen starben, 58 verletzt wurden.
Nebst meinen widersprüchlichen Kriegsdiensten kam zu Weihnachten noch der zivile Einsatz. Weihnachtsgut war Mangelware. Aber als Sammelgut von Kriegstrümmern greifbar. So barg man auch mich aus Überbleibseln von Stanniol-Streuwolken. Und platzierte mich neben andere Trümmerteile oder kleine Panzer auf grüne Äste. Mein Glanz war nun ohne Gloria. Umständehalber. Ja. Nein. Luftwaffenchef Hermann Göring konnte es nicht lassen. Er hatte als sogenannter „Lametta-Heini“ nicht nur eine Schwäche für Orden und prunkvolle Uniformen. Unter festlich geschmücktem Baum stimmte er auch dieses Loblied auf mich an:
„Rechts Lametta, links Lametta,
Und der Bauch wird imma fetta,
Und in Preußen ist er Meester –
Hermann heißt er!“
„Tsssssch….“, zischt mich ungeduldig die Wunderkerze an. Sie nimmt mir den Stab ab: „Du hast genug geredet, ttsssschschschsch … ich habe ja nur zwei Minuten Zeit.“ In der Tat, nur allzu schnell versprüht sie ihre Funken aus Aluminium, Titan und Magnesium. Ich überlasse ihr eilig die Bühne auf dem geteilten Ast. Mein letztes Wort nach ihrem „Tssccch…“ bleibt im Hals stecken: „Tsch‘uldigung.“
 Silvia Ittensohn, Fachlektorin für Interkultur, Philosophie und Politik, journalistisch tätig. Nach Lizenziat und Lehrerausbildung Deutschlehrerin für
Silvia Ittensohn, Fachlektorin für Interkultur, Philosophie und Politik, journalistisch tätig. Nach Lizenziat und Lehrerausbildung Deutschlehrerin für 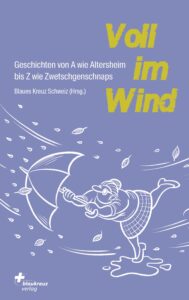 Fremdsprachige im Migrationsbereich. Initiierte nach einem Master in Interkultureller Kommunikation einen lokalen Kultur-Verein Schweiz-China. Seit ihrer Pensionierung schrieb sie eine historisch-fiktionalisierte Broschüre zur Geschichte der «SP-Frauen Schweiz». Im Blaukreuzverlag wurde ihre Kurzgeschichte ‚Zurück in die Zukunft – mit dem Trottinett‘ publiziert. Derzeit schreibt sie Kürzestgeschichten und Kurzgeschichten. Seit knapp einem Jahr arbeite sie an einem lokalhistorischen Roman.
Fremdsprachige im Migrationsbereich. Initiierte nach einem Master in Interkultureller Kommunikation einen lokalen Kultur-Verein Schweiz-China. Seit ihrer Pensionierung schrieb sie eine historisch-fiktionalisierte Broschüre zur Geschichte der «SP-Frauen Schweiz». Im Blaukreuzverlag wurde ihre Kurzgeschichte ‚Zurück in die Zukunft – mit dem Trottinett‘ publiziert. Derzeit schreibt sie Kürzestgeschichten und Kurzgeschichten. Seit knapp einem Jahr arbeite sie an einem lokalhistorischen Roman.
Illustration © leale.ch
Guy Krneta «Ds gröschte Gschänk» – «Tschuldigung» 8
Am Morge vo Heiligaabe het dr euter Sohn gseit, uf eis Gschänk fröi’r sech bsungers. Öb’s öpis sig, won’r sech gwünscht heig, ha ne gfragt. Vo wäm dass’r’s überchöm, ha ne gfragt. U vo won’r überhoupt wüss, dass’r’s überchöm, ha ne gfragt. Aber är het glachet wi eine, wo meh weiss aus angeri.
Am Aabe si ungerem Boum vrschidnigi Gschänk gläge. U hingerem Boum es grosses Päkli, wo em jüngere Sohn ufgfauen isch. Für wän das Päkli sig, het’r wöue wüsse. Aber i ha gseit, das gsäch’r de, itz müess’r haut no chli Geduud ha bis zur Bescheerig.
Bir Bescheerig isch’s dr jünger Sohn gsi, wo aus erschts sini Päkli het wöue vrteile, won’r gmacht het gha im Chindergarte. När hei d Ching d Päkli übercho vo den Erwachsnige. U em Schluss isch’s dr euter Sohn gsi, wo sini Päkli vrteilt het.
Was mit däm grosse Päkli sig hingerem Boum, het dr jünger Sohn gfragt, wo aui angere Päkli si vrteilt gsi. Das gsäch’r grad, het dr euter Sohn gseit, itz gäb’s nämlech non en Überraschig. U när het’r das grosse Päkli hingerem Boum füregno.
Das Gschänk, het dr euter Sohn gseit, mach är öper ganz Bsundrigem: Tschuudigung, sich säuber. U när het’r’s aafa uspacke. Es isch guet iipackt gsi, ire Chischte, mit viu Papier drumume, und usecho isch am Schluss es Chüssi. Won’r säuber het gfärbt u gnäjt gha ir Schueu. Über Wuche. Mir hei ne globt u das Chüssi beschtuunt.
Aber dr jünger Sohn het gfragt, öb me das überhoupt dörf, sich säuber öpis zur Wienachte schänke. Wüu we me das dörf, tschuudigung, de mach är das nächschts Jahr o.

Guy Krneta, 1964 geboren in Bern, lebt in Basel. Krneta war Dramaturg und Co-Leiter an verschiedenen Bühnen in Deutschland und der Schweiz. Er ist Mitbegründer des Spoken-Word-Ensembles «Bern ist überall» und initiierte u.a. das Schweizerische Literaturinstitut in Biel. Krneta schrieb zahlreiche Theaterstücke und Bücher, die mit Preisen ausgezeichnet wurden.
«Die Perücke», Roman, Der Gesunde Menschenversand; Alles oder nichts. Alles fürs Theater macht die Regisseurin Rike. Kompromisslos widmet sie ihm ihr ganzes Leben. Nichts mehr vom Leben erwartet die junge Esther. Kompromisslos bringt sie sich um. Beiden gerecht zu werden versucht ein Ich-Erzähler. An der Seite Rikes wird er vom Regieassistenten zum Autor. Als Freund Esthers schaut er hilflos zu, wie sie verzweifelt.
Guy Krneta hat aus einem Stück Lebens- und Theatergeschichte einen bewegten und bewegenden Roman geschrieben.
Illustration © leale.ch
Eva Christina Zeller «Sag mir, wie du Weihnachten feierst» – «Tschuldigung» 7
Es ist geschafft. Jedes Jahr habe ich die gleiche Angst vor der Geburt des Herrn. Dabei liebe ich heilige Abende. Theoretisch. Die Geburt in einem warmen, duftenden Stall, die Tiere als Zeugen, eine junge Maria, ein überforderter Josef, alles Zutaten zu einer tollen Geschichte.
Ich stelle die Bestandteile dieser archaischen Geschichte jedes Jahr wieder neu auf, wenn ich die alte, geschnitzte Krippe, die mir meine Eltern vererbten, vom Dachboden hole und sie aufbaue. Wesentlich bei meiner geschnitzten Krippe sind zwei Figuren, die sonst selten vorkommen: eine schwarze Katze, die einen Buckel macht, und ein böser, kläffender Köter. Jedes Jahr stelle ich die Katze oben auf das Dach des Stalls und den Köter unten vor die Krippe auf den Boden.
Sie zeigen mir, dass es damals schon Spannungen gab, die nicht in der Geschichte vorkommen.
Meine Mutter wollte immer, dass wir wenigstens an Weihnachten Zusammenhalt beweisen. Aber schon der gemeinsame Abgang zur Kirche wollte nicht klappen. Am Ende saßen wir alle in verschiedenen Bänken. Meine alte Tante saß bei den Schwerhörigen in der ersten Reihe, meine vielen Brüder, wenn sie überhaupt dabei waren, standen irgendwo ganz hinten an der Wand und meine Mutter setzte sich etwas aufgelöst und hektisch mit mir an der Hand dorthin, wo es eben noch einen Platz gab. Nur mein Vater nahm seinen angestammten Platz auf der Kanzel ein, wie jedes Jahr.
Jedes Jahr waren wir keine geschlossene Familie. Und jedes Jahr wünschte sich meine Mutter eine. Nein, ich wünschte sie mir, denn da pochte diese sehnsüchtige Erinnerung in mir an den Weihnachtsglanz, als ich ein kleines Kind war und Weihnachten noch keinen Schatten kannte.
Damals dachte ich noch, später machst du es besser. Als meine Kinder ganz klein waren, da versuchte ich es noch. Mein Mann und ich luden für die ersten Abendstunden meine Freundin Kristin mit ihrer kleinen Tochter Carla ein. Ihr Mann musste derweil mit seiner ersten Frau und seinen schon größeren Kindern feiern. Mit tat Kristin leid, die klaglos akzeptierte, dass die erste Familie an diesem Abend Priorität genoss, weil das Alte, Überkommene am Heiligen Abend scheinbar immer Vorrang hat. Außerdem war ich es gewohnt, dass man immer jemanden einlädt, der sonst allein wäre. Ich täuschte mich auch darüber hinweg, dass in meiner kleinen Familie auch schon Zentrifugalkräfte am Werk waren.
Als mein Mann auszog und mit seiner Freundin feierte, entging meine ältere Tochter im ersten Jahr der Entscheidung, bei wem sie feiern wollte. Sie fuhr zu den Großeltern. Mit meiner kleinen Tochter fand ich Weihnachtsasyl bei Freunden.
In den Jahren danach drehte sich der Wind. Mein Mann war zwar nicht mehr da, aber dafür hatte sich Kristins Mann Thomas für seine zweite Familie entschieden und feierte mit uns und den Mädchen. Er gab den Josef. Wir zwei Marien sangen mit drei Mädchen und unsere zwei Kätzchen holten die Glaskugeln vom Christbaum. Ein ausbalanciertes Idyll. Wir feierten abwechselnd ein Jahr bei mir, ein Jahr bei ihnen.
Wer gehört zu deiner heiligen Familie? Sag mir, wie du Weihnachten feierst, und ich sage dir, wer du bist.
An diesem Abend zeigt sich, wer zusammengehört. Und für einige Stunden versuchen die Menschen unter dem Baum oder vor der Krippe zu vergessen, wie prekär, zerbrechlich und angeknackst die Verhältnisse sind und welche Balanceakte und Auseinandersetzungen nötig waren, um die Figuren der Krippe nachzustellen.
Letztes Jahr war alles anders, meine Kinder feierten mit ihrem Vater und ich ging allein in die Kirche. Ich überlegte mir lange, welchen Platz ich wählen sollte. Dort hinten bei den Brüdern? In der ersten Reihe bei der toten, schwerhörigen Tante? An der Hand meiner toten Mutter, auf der Seitenempore? Auf die Kanzel zu meinem toten Vater durfte ich nicht. Aber sie waren alle da und ich hatte plötzlich Frieden geschlossen mit den Zentrifugalkräften in meinen Familien. Ich spannte Sehnsuchtsfäden durch die Kirche und dachte an den Stall, in dem auch keine perfekte Familie zusammenstand – war nicht die ›heilige Familie‹ auch schon eine Patchwork-Familie? –, und ich dachte an meine Krippe, an den kläffenden Köter und die Katze auf dem Dach mit dem Buckel.

Eva Christina Zeller schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und lebt in Tübingen, direkt am Neckar, unweit des Hölderlinturmes. Für ihr literarisches Schreiben erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Thaddäus-Troll-Preis, den Preis der Akademie Schloss Solitude und das Venedig-Stipendium des Kulturstaatsministeriums. Aufenthaltsstipendien führten sie nach Irland, auf eine Insel im Åland-Archipel, nach Farö, Gotland, an den Genfer See, Venedig
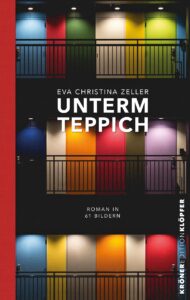 „Unterm Teppich“ Roman in 61 Bildern, Alfred Kröner Verlag: Die Miniaturen erzählen Schlüsselerlebnisse eines weiblichen Ichs von der Kindheit bis ins mittlere Frauenalter, die sich zu einer Lebensgeschichte zusammensetzen. Was ist das Leben eines Menschen im eigenen Rückblick? Eine in tiefgelegenen Kammern des Gedächtnisses aufbewahrte, manchmal verschüttete Sammlung von Augenblicken, Glücksmomenten, traumatischen Erlebnissen, plötzlichen Einsichten, Verletzungen, die das erinnernde Ich wie Perlen auf eine Kette reiht – und dabei nicht selten verfälscht. Die 61 Bilder Eva Christina Zellers folgen der Chronologie des Lebens. Das Erwachen des Bewusstseins, die Erfahrung der eigenen Sexualität, väterliche Übergriffe – all dies sind erste Impressionen aus dem Leben eines Mädchens in einer Pfarrerfamilie, die prägend für alles Weitere sind: Pubertät, Erwachsenwerden, erste Beziehungen, Krisen, Begegnungen.
„Unterm Teppich“ Roman in 61 Bildern, Alfred Kröner Verlag: Die Miniaturen erzählen Schlüsselerlebnisse eines weiblichen Ichs von der Kindheit bis ins mittlere Frauenalter, die sich zu einer Lebensgeschichte zusammensetzen. Was ist das Leben eines Menschen im eigenen Rückblick? Eine in tiefgelegenen Kammern des Gedächtnisses aufbewahrte, manchmal verschüttete Sammlung von Augenblicken, Glücksmomenten, traumatischen Erlebnissen, plötzlichen Einsichten, Verletzungen, die das erinnernde Ich wie Perlen auf eine Kette reiht – und dabei nicht selten verfälscht. Die 61 Bilder Eva Christina Zellers folgen der Chronologie des Lebens. Das Erwachen des Bewusstseins, die Erfahrung der eigenen Sexualität, väterliche Übergriffe – all dies sind erste Impressionen aus dem Leben eines Mädchens in einer Pfarrerfamilie, die prägend für alles Weitere sind: Pubertät, Erwachsenwerden, erste Beziehungen, Krisen, Begegnungen.
Illustration leale.ch
Ruth Loosli «Sopran oder Alt?» – «Tschuldigung» 6
44,44, sagte der Mann an der Kasse und schaute überrascht. Ein interessanter Betrag, fügte er an. Ich stand in einem Bioladen in Konstanz und zückte meine Geldbörse, während ich ihn anschaute. Dass er diese Zahlen interessant genug fand, um sich zu äussern, liess mich innehalten. Sein Gesicht war schmal, es hatte etwas Römisches, die Augen strahlten verhaltene Wärme aus.
In der Geldbörse hatte ich Kleinnoten und eine letzte Visitenkarte mit Namen und Telefonnummer. Ich schob ihm einen 20 Euroschein zu mit der Visitenkarte, als wären die zwei Blätter verschweisst.
Er guckte kurz, legte den dicken Schein in die Kasse, nickte mir zu, seine Augen blieben freundlich, seine Mundwinkel zuckten leicht.
Dass ich einem wildfremden Mann soeben meine Telefonnummer gegeben hatte, überraschte mich.
Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, glücklich geschieden, lebe gerne allein.
So what, dachte ich und vergass die Sache.
In meinem Bauch lag wenig später ein minimaler Teil eines Kalbes, das über Mittag als Gulasch serviert wurde mit Spätzle und Gemüse; so stand es auf der Karte und ich wollte unbedingt auf den See schauen. Für einen guten Platz muss man mitbezahlen, dachte ich und dankte dem Kalb, dass es mir Energie spendete.
Nach dem Essen und weiteren kleinen Einkäufen fuhr ich zurück nach Winterthur. Sommerlich warme und zu trockene Herbsttage folgten, danach schlich sich der Nebel in die Gassen. In mein Gemüt. 55 Jahre und zu oft allein.
Trotzig schmückte ich den kleinen Nadelbaum, der auf dem Balkon steht und sich bestimmt nicht auf den alljährlichen Glimmer freut. Hier ein Holzpferdchen an einer goldenen Schnur, dort ein Engelchen mit Posaune: Alles vor wenigen Jahren auf einem Seconhand-Weihnachtsbasar erstanden. Der ganze frühere Schmuck liegt beim Ex in einer Kiste auf dem Estrich.
Noch ein Esel, dachte ich, den hänge ich neben den Hirten.
Fertig.
Ich schenkte mir einen Cynar ein, goss Orangensaft dazu und betrachtete mein Werk.
Da läutete das Telefon. Es war am 19. Dezember.
Eine fremde Nummer leuchtete auf. Normalerweise nehme ich keinen Anruf einer fremden Nummer entgegen.
Hallo, sagte ich.
Eine männliche Stimme sagte hastig:
Tschuldigung, hier ist 44, 44 mein Name ist Joshua.
Ich musste mich setzen, doch das sah er natürlich nicht.
Eine Hitze schob sich vom Kopf in den Bauch in die Beine. Er. Ich sah ihn vor mir, seine warmen Augen, seine Mundwinkel.
Am 24. Dezember sass Joshua in meiner Stube, legte ein flaches Paket unter den Baum und betrachtete den Engel mit der Posaune.
Machst du Musik, fragte er.
Meine Gitarre ist kaputt, leider, sagte ich.
Aber ich singe oft für mich allein.
Er schaute mich an, näherte sich meinem Gesicht und fragte: Sopran oder Alt?
Von da an hatte ich einen Freund. Er hat eine großartige Singstimme. Er hilft nur manchmal aus im Bioladen in Konstanz. Trotzdem hat uns an jenem Tag eine Zahlenkombination zusammengeführt und mein Mut, ihm meine Telefonnummer zu geben. Der Zug trägt uns in 56 Minuten von einem Ort zum anderen. Dazwischen liegt allerdings eine Grenze. Wir sind am Überlegen, wie wir diese in schlechten Zeiten überwinden könnten.
Das Geschenk war übrigens in braunes Packpapier eingeschlagen und enthielt ein Buch. Es waren Gedichte von Rumi, einem Sufi-Mystiker aus dem 12. Jahrhundert.
„Das Leben ist kurz wie ein halber Atemzug – pflanze nichts als Liebe», stand als Widmung darin. Dein Joshua

Ruth Loosli ist 1959 in Aarberg geboren und im Berner Seeland aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und hat drei Kinder. Seit 2002 lebt und arbeitet Ruth Loosli in Winterthur, wo sie sich in verschiedenen literarischen Projekten engagiert. Neben dem Schreiben von Prosa und Lyrik gestaltet sie auch Schreibbilder. 2023 wurde Ruth Loosli für ihren Lyrikband «Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» mit einem Preis der Stadt Zürich geehrt.
 «Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.
«Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.
Illustration © leale.ch
Béatrice Bader «Anna» – «Tschuldigung» 5
Die kühle Nachtluft legt sich wie eine Decke um Annas Knie. Sie sitzt in vor dem offenen Fenster und beobachtet, wie die Schneeflocken auf dem Balkongeländer landen. Sie setzen sich nahe zusammen, als wollten sie verhindern, dass eine von ihnen frieren muss.
So nahe wie die Schneeflocken auf dem Geländer drängen sich die Gedanken in Annas Kopf. Eigentlich weiss sie genau, was zu tun ist. Auch jetzt, gerade in diesem Moment. Doch wie immer fühlt sie sich durch ihre Gedanken wie eingewickelt als sässe sie in einem Fadengespinst. Am Ende eines jeden Fadens sitzt ein Hund in Dackelgestalt wie an einer Leine. Da es viele davon gibt und jeder in seine Richtung rennt, verwickeln sich die Leinen in Anna Kopf ineinander zu einem unlösbaren Knoten. Nur manchmal gelingt es ihr, eine der Leinen zu lösen und ihr und dem daran hängenden Dackel zu folgen. Dies ist dann einer jener seltenen Glücksmomente, in denen Anna ganz bei sich ist und ihrem Weg folgenden kann, wenn auch nur für eine kurze Weile. Denn schon kommt der nächste Gedankendackel angerannt, will gestreichelt werden und verlangt ein lustiges Spiel, indem er an Annas Gedankenfaden zieht wie ein Hund an seiner Leine. Anna versucht dann wie immer dem Ziehen zu folgen, doch dabei verwickelt sie sich selber bis zur schieren Unbeweglichkeit. Und schon ist der Tag wieder vorüber, die Abendschatten tropfen vom Himmel wie zäher Brei. So wartet Anna auf den neuen Tag, weil sie weiss, damit bekommt sie eine neue Chance ihrer inneren Welt zu begegnen, um aufs Neue Bilder und Worte daraus zu schöpfen.
Dabei fühlt sich Anna wie ein Tagedieb. Das Wort Entschuldigung formt sich in ihrem Kopf, erst kaum hörbar, ganz klein und leise. Doch je mehr Stunden von der Tages- zur Abendseite rollen, umso lauter wird das Wort in ihrem Kopf. ENTSCHULDIGUNG dafür, dachte sie, dass ich heute wieder nichts Richtiges gemacht habe. Sie fühlt ein Ziehen an einem ihrer Gedankenfäden, versucht dem zu folgen, verliert sich in den tanzenden Schatten an der Zimmerwand, welche von der Abendsonne beleuchtet wird. Zu spät, denkt Anna, zu spät, um jetzt noch etwas Richtiges anzufangen.
Anna hat sich in ihrem Zimmer ein kleines Reich errichtet. Überall liegen Fundstücke und Sammelgegenstände. Anna liebt jedes einzelne Ding, versucht immer wieder eine neue Ordnung. Das gibt ihr das Gefühl, etwas Richtiges zu tun, ja sogar etwas Wichtiges. Wenn sie sammelt, verlieren ihre Spaziergänge das Gefühl von Nichtstun, was ihr immer ein schlechtes Gewissen macht. Was sie findet, fügt sie zuhause in ihre Sammlung ein. Um eine Übersicht zu behalten, hat Anna an den Wänden kleine Zettel aufgehängt, darauf verzeichnet sie den genauen Fundort mit seinen Koordinaten, Tag und Jahr und Zeit. Sie nummeriert die Zettel, damit sie weiss, wie gross ihr Reich inzwischen ist. Am Abend zündet sie die Kerzen an, die sie überall in ihrer Wohnung, die aus zwei kleinen Zimmern besteht, verteilt hat. Der Kerzenschein taucht alles in ein warmes Licht und lässt die hübsch angeordneten Dinge in einem Glanz leuchten, der niemand ausser ihr wahrnehmen kann. In diesen Momenten sind Annas innere Welt und ihr warm leuchtendes kleines Reich eins. Auch die am Ende ihrer Gedankenfäden angebundenen Dackel liegen zusammengerollt da und beobachten Anna aus schlafschweren Augen. Ein Wind, der zum Fenster hereinbläst, lässt die Kerzenflammen zittern und die Schatten über Wand und Zimmerdecke tanzen. Er wirbelt die gesammelten Federn im Zimmer herum, bis sie sich wie die Schneeflocken vor Annas Fenster eng beieinander niederlassen, bis sie alles unter sich bedecken, die Stuhllehne, den Tisch, den Zimmerboden. Jede einzelne Feder ein ungenutzter Tag, zusammen sind sie eine Decke von Wochen und Monaten vergangener Zeit. Entschuldigung, flüstert Anna, legt sich mitten auf den Fussboden und deckt sich mit der Federdecke zu. Sie schliesst die Augen und lässt im Kopf die Dackel von ihren Gedankenfädenleinen. Morgen, denkt sie. Morgen ist erster Weihnachtstag, da mache ich etwas Richtiges.
 Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.
Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.
Illustration © leale.ch
Raphael Schweighauser «Jeux d’esprit» – «Tschuldigung» 4
Sie wäre fast soweit, würde Mutter meinen. Würde die Tür hinter mir schliessen. Die lila Kugeln ihrer Kette würden mit jeder Bewegung lustig klacken. Ich durchliefe eine Wand aus schwerem Parfüm und kaltem Nikotin, hinein in die zu warme Stube. Würde vergessen, meine Schuhe auszuziehen, weshalb Mutter betonen würde, sie hätte stundenlang geputzt. Mutter würde mein Kinn halten, nach links und rechts drehen. Würde meinen, dass ich mich ruhig hätte rasieren können. Dass ich aussehen würde wie ein Mufti. Ich würde sagen, dass man das so tragen würde, dass etwas länger modern wäre. Ich würde die Schuhe ausziehen, mich auf das graumelierte Sofa setzen, zu Vater, der einen Tennismatch schaut.
Er würde mir zunicken. Würde fragen, ob ich denn keine Zeit gehabt hätte, mich zu rasieren. Dass er sich nicht sorgen solle, würde ich meinen, das Kamel wäre draussen angebunden. Was das denn zu bedeuten hätte, würde Vater wissen wollen und dann fragen, wie es beim Schaffen so liefe. Ich würde antworten «gut», und dabei nicken. Was er aber nicht sehen könnte, weil er den Aufschlag verfolgen würde. Ich würde Mutter fragen, ob ich ihr helfen könnte. Dass aber alles bereit wäre, würde sie meinen. Würde dann mit zwei Gläsern Weisswein auftauchen und mir eines in die Hand drücken. Ich würde es zögerlich nehmen, während Vater breitbeinig mit seinen Arbeiterhänden einen grossen Schluck Weizenbier nehmen würde.
Wie es denn so beim Schaffen liefe, würde sie wissen wollen. Und ich würde antworten «gut» und dabei nicken. Sie würde sich ein Stapel Chips Provençale in den Mund schieben, dabei die Handfläche unter den Mund halten. Würde dann Vater anstupsen, weil er sich am Gespräch beteiligen sollte. Was Vater aber nicht bemerken würde, weil auch der zweite Aufschlag zu weit links aufkäme. Worauf ich an meinem Weisswein nippen würde, der zu warm wäre. Mutter würde zittrig eine Zigarette anzünden, die Parisienne Jaune würde dabei mit jedem Zug in ihrem Mundwinkel auf und ab wippen. Dann würde sie kräftig daran ziehen. Ihre Kette würde dabei aufgeregt klacken, zu ihren Gesten applaudieren. Bevor sie wieder in die Küche gehen und nach dem Essen schauen müsste.
Der Tennismatch würde sich ziehen, weil beide sehr gut oder gleich schlecht spielen würden. Vater würde es hin und wieder kommentieren, mit jedem Schluck Bier häufiger. Würde manchmal aufschreien, was der Seich solle. Behaupten, er hätte ganz klar auf links gezielt, backhand. Ich würde nicken, meinen Blick zwischen Fernseher, Glastisch und meinem leeren Weinglas hin- und her wechseln, meinem sicheren Dreieck. Würde die Beine übereinanderschlagen wollen und es dann doch nicht tun, weil Vater dabei wäre. Würde irgendwann aufstehen, meinen, ich würde Mutter helfen wollen. Würde mir dann in der schmalen Küche Wein einschenken und die Flasche in den Kühlschrank stellen.
Würde sehen, dass Mutter draussen die ausgetrockneten, farblosen Hortensien inspizierte, mit einer frischen Zigarette in der Hand. Sie würde mir versichern, dass sie dieses Jahr besonders prächtig gewesen seien. Ich würde kurz heraustreten, die kalte Luft geniessen und auf dem Gartentischchen ein Trinkglas entdecken, gefüllt mit in Regenwasser ertränkten Zigarettenleichen. Dann würde mich Mutter wieder hinein scheuchen, weil es doch gleich Essen gäbe.
Ich würde mich an den Birkenholztisch setzen, mit meinem Weinglas, dass bereits wieder zur Hälfte geleert sein würde. Ich würde Mutters Bewegungen aus der Küche hören, das Öffnen und Schliessen der Backofentüre. Würde sie fluchen hören, wo denn der Weisswein wäre, «Nundefahne nomol!» Würde den Kommentator aus dem Fernseher und Vater aus der Stube hören. Während vor mir die rote Kerze bereits auf das weisse Tischtuch tropfen würde. Mutter würde Saucen auf den Tisch stellen und Mineralwasser in PET-Flaschen.
Vater würde seinen Platz einnehmen, während der Fernseher weiterliefe. In einer halben Stunde käme ein Fussballmatch, würde er meinen und dabei den Rotwein entkorken. Ich würde den getrockneten Bund Hortensienblüten beiseiteschieben, um Platz zu schaffen. Schliesslich würde Mutter mit dem Filet Wellington kommen, es präsentieren und sogleich zerschneiden, es auf unsere Teller hieven, mit der braunen Sauce bedecken. Wer denn jetzt wieder die Hortensien verschoben hätte, würde Mutter wissen wollen. Vater würde allen Rotwein einschenken. Abgelenkt vom Applaus der Kugeln, der Parfumwerbung aus dem Fernseher, «femme fatale, c’est moi!» und der tropfenden Kerze würde ich es verpassen, Vater vom Rotweineinschenken abzuhalten.
Ich würde ihm schliesslich erklären müssen, dass ich noch fahren müsste und dass Rotwein nicht so meins wäre. Er würde meinen, ich sollte nicht so tun. Den Weissen hätte ich auch hinuntergespült. Und würde fragen, seit wann ich denn keinen Rotwein trinken würde. Ich würde es bereuen, erklären zu müssen, dass ich Roten noch nie gemocht habe. Weshalb Vater fragen würde, weshalb ich immer so kompliziert sein müsste. Ich wäre dann wieder vorsichtig genug, darauf nicht zu antworten. Stattdessen würde ich im Kartoffelstock herumstochern. Was Mutter bemerken und meinen würde, was das denn sollte, ob ich nicht warten könnte. Wo ich denn aufgewachsen wäre, würde sie meinen. Ich würde die Gabel zur Seite legen und die roten Wachsflecken auf dem Tischtuch fixieren. Vater würde anstossen wollen und das Glas heben.
Und überhaupt, was gäbe es sonst Neues, würde Mutter wissen wollen. Ob ich eine Freundin hätte. Ich würde dann den Kopf schütteln. Aber weil Vater sein Filet Wellington in noch mehr Sauce ertränken würde, könnte er es nicht sehen. Er würde sagen, ich sollte meiner Mutter antworten. Dass es eine ganz normale, eine legitime Frage wäre, würde er meinen. Weil er das Wort legitim in der Arena sagen hörte und es gebildet tönte. Ich würde sagen, dass ich eben keine Freundin hätte. Weshalb Mutter meinen würde, es hätte sie doch nur wundergenommen. Dass sie doch noch fragen dürfte. Weshalb ich immer so privat wäre, würde sie meinen. Ihre Stimme würde sich überschlagen, höher und schriller werden. Nie würde ich von mir erzählen, würde sie meinen, dass ich sie beide ausschliessen würde. Sie würde behaupten, ihr wäre der Appetit vergangen, mir die Schuld geben, dass sie jetzt doch noch eine rauchen müsste, obwohl sie heute keine mehr rauchen wollte.
Sie würde aufstehen, eine Zigarette anzünden, im Staccato daran ziehen. Sie würde in den brachliegenden Garten schauen, zu den toten Hortensien. Vater wäre bereits wieder in der Stube und würde den Anpfiff schauen. Auf dem Tisch wäre die Kerze zur Hälfte abgebrannt. Das Filet Wellington würde kalt sein. Sauce, Erbsen und Kartoffelstock würden ungekostet danebenliegen. Ich würde aufstehen, die Schuhe anziehen. Würde das Geschenk nicht unter die geschmückte Nordmanntanne in Rot-Gold legen, sondern auf das kleine Tischchen im Gang, neben Schlüsselbund und Rechnungen. Kurz warten, ob ich vielleicht noch Mutters Stimme oder Vaters Rufe hören würde. Würde das Lexikon an ungesagten Wörtern hinunterschlucken. Würde dann die Türe öffnen und hinausgehen. Ich würde draussen stehen, meinen Atem sehen und von der nächtlichen Ruhe überfordert sein. Ich würde zum Auto gehen, den Motor starten, auf leeren Strassen nach Hause fahren.
Wenn ich jetzt auf die runde Türklingel drücken würde.
 Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.
Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.
Illustration © leale.ch
Christine Bonvin «Sprachlos» -«Tschuldigung» 3
Wer hätte das gedacht? Niemand. Wirklich niemand kann sich vorstellen, dass der Samichlaus vor einer Fünfjährigen verstummt.
Tinas Einfallsreichtum kannte beinah keine Grenzen. Ständig hatte sie Ideen, spann Geschichten im Kopf und überraschte die Erwachsenen mit ihren Gedankengängen. Unter anderem holte sie sich Inspiration aus den Globibüchern. Zum Beispiel band sie eines Tages ein Portemonnaie an einen unsichtbaren Faden, legte es auf die Straße vor dem Haus und versteckte sich hinter dem Gartenzaun. Ein Mann bückte sich, um nach dem Geldbeutel zu greifen, aber Tina zog ruckzuck am Faden und brachte das gute Stück in Sicherheit. Der verdutze Mann hörte ein Kichern im Busch.
Wenn sie nicht zu Streichen aufgelegt war, hörte sie Märchen ab Tonband. Mit Vorliebe das der Gebrüder Grimm „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“. Ihre Eltern sorgten sich manchmal, ob der Unbekümmertheit und fantasievollen Ausflügen ihrer Tochter, ließen sie aber gewähren. Nur ab und zu hoben sie den Mahnfinger und sagten: „Wenn du nid brav bisch, chunnt de Samichlaus, steckt dich in Sack und nimmt dich mit in Schwarzwald. I sim Waldhüsli muesch du hälfe schaffe und chasch kein Schabernack meh anstelle.“
Tina beeindruckte das nicht. Ein Plan begann zu wachsen. Sie konnte sich prima vorstellen, wie es wäre, in einer Hütte im Wald zu wohnen, mit dem Nikolaus und seinem Esel. Ob der Mann wohl auch eine Frau hatte?, fragte sie sich. Denn ihre Mutter beklagte sich immer wieder darüber, dass Tinas Hosen Löcher hatten, auf die sie Flicken nähen musste. Aber vielleicht besaß der Samichlaus ja selbst eine Nähmaschine und konnte damit umgehen. Und sonst wäre es auch egal. So wichtig waren ihr die Klamotten nicht.
„De Samichlaus chunnt morn, aber muesch kei Angscht ha. Er bringt dir sicher öppis mit“, verkündete die Mutter anfangs Dezember. Tina freute sich. Für sie war es unvorstellbar, dass jemand, der den Kindern Geschenke brachte, nicht lieb war. Diejenigen, die eine Fitze bekamen, hatten es wohl verdient, denn sonst würden sie ja keine bekommen – oder? Und weil sie neugierig war, wie es im Schwarzwald sein würde, packte sie ihre Siebensachen in einen Plastiksack. Eine Unterhose, ein Unterhemd, Socken, einen Pulli, die Lieblingshose und ihren Stoffdackel Seppli. Sie sagte niemanden etwas und lernte brav das Sprüchli auswendig, das der Vater ihr beibrachte:
Was isch das für es Liechtli,
was isch das für en Schii?
De Chlaus mit de Laterne
lauft grad de Wald durii.
Siin Esel, de hät glade,
er rüeft I-a, I-a!
Hüt dörf ich mit mim Meischter
emal is Schtedtli gaa.
Im Sack da häts vill Nüssli,
au Tirggel, Zimetstern,
die träg ich, au wänn’s schwer isch,
für d‘ Chinde schüli gern.
Ihre Gedanken schweiften immer wieder zum drolligen Esel, den sie füttern und streicheln wollte und dem Häuschen im tiefen, dunklen Tannenwald. Das würde ein Erlebnis. Sie freute sich riesig. Sie konnte es kaum erwarten. Um sich abzulenken und die Zeit zu vertreiben, ging sie in den Garten. Dort stand ein Stechpalmenstrauch. Sorgfältig zupfte sie ein paar der stacheligen Blätter ab. Sie plante eine kleine Überraschung für ihren Bruder. Er hatte sie ausgelacht, als sie ihren Vers auswendig gelernt hatte.
„Du bringsch sicher keis Wort use, wenn de Chlaus da isch. Dänn vergoht dir din Uebermuet. Und will du immer so frech bisch mit mir, nimmt er dich sicher mit.“
Sie hatte ihm wortlos einen Tritt ans Bein versetzt. Nun schlich sie unbemerkt in sein Zimmer, platzierte die stacheligen Blätter auf der Matratze seines Bettes, formvollendet versteckt unter dem Leintuch. Es schauten nur die Spitzen aus dem Laken am Fußende. Moritz würde eine picksende Überraschung erleben, wenn er sich hinlegte. Aber er hatte es verdient, kleine Schwestern auslachen, war nicht nett. Vor dem Nikolaus brauchte sie keine Angst zu haben, der war unterwegs. Der spähte jetzt bestimmt nicht durch das Fernrohr, um Mädchen zu beobachten, wie sie ihren Brüdern Streiche spielten. Außer er hätte die Engel angestellt. Dieser Gedanke verunsicherte sie ein wenig. Aber sie würde es ihm später überzeugend erklären, falls er sie darauf ansprach.
Endlich läutete die Türglocke und Tina hörte ein Glöcklein bimmeln. Jetzt war er da, der große Moment. Sie rannte zur Türe und begrüßte den rotgekleideten Mann mit dem weiß gelockten Bart und den wallenden Haaren überfreundlich: „Sali Samichlaus, mir händ scho uf dich gwartet.“
„Guete obig, Tina. Danke für de fründlich Empfang. Ich freue mich uf de Besuch be dir und dinere Familie.“
„Und wo hesch de Esel?“, fragte Tina.
„De het sich leider de Fueß verstucht. Er ruht sich dehei us. Ich bin mit em Auto unterwägs.“
„Oh, de Armi!“
Die Eltern führten den Samichlaus in die Stube. Er setzte sich in Vaters Sessel. Unter seiner Brille durch schaute er die beiden Kinder prüfend an. Moritz trat hinter Tina. Es war, als wolle er sich ein wenig verstecken.
„So, ihr zwoi. Sind ihr au immer brav gsi?“
„Meischtens“, antwortete die Kleine, ohne lange zu überlegen.
„Denn wott i emol luge was i do ine stoht!“, brummte der Claus in seinen Bart.
Er öffnete das dicke, rote Buch und schaute streng zu Moritz.
„Du hilfsch de Eltere viel im Garte. Und i de Schuel schaffsch fliessig. Aber du söttisch dini Schwöster weniger ärgere.“
Moritz nickte beschämt. Der Claus griff in seinen Sack und zog ein Geschenk daraus.
„Ich ha dir öppis mitbrocht. Aber zerscht wotsch mir sicher es Versli uf säge?“
„Sami niggi näggi, hinderem Ofe steggi, gib mir Nuss und Biere, denn chummi wieder führe“, ratterte der Junge runter. Er ging einen Schritt auf den Samichlaus zu, nahm das Säckli entgegen und stand schnell wieder hinter seine Schwester.
„Und jetzt, chumm ich dra?“, fragte sie ungeduldig.
„Jo, ich luge emol, was über dich im Buch stoht.“
Der Claus runzelte die Stirn.
„Du bisch es liebs Chind, füetterisch immer s Büsi und tusch abtische nach em Äße. Du hesch aber öppe emol Flause im Chopf und chunsch z spot zum Zmittag, ohni d’Händ z wäsche.“
„Das isch nid so schlimm, Samichlaus. Weisch, de Papi seit immer, es bitzeli Dräck sig gesund.“
Der Nikolaus schmunzelte in seinen Bart.
„Ich chumme aber trotzdem mit dir in Schwarzwald. Ich hälfe dir bim Säckli mache. Und de Esel möchti au streichle. Mini Sache han i scho packt.“
Der Samiclaus öffnete und schloss den Mund, ohne etwas zu sagen. Er schaute das Kind verwirrt an. Sie stand strahlend und erwartungsvoll vor ihm und wartete auf seine Antwort. Die Eltern und der Bruder standen wie versteinert da.
„Tschuldigung. I ha di glaub nid rächt verstande. Du wottsch mitcho?“
„Jo. Ich mache au kei Arbet. Im Gägeteil, ich hälfe dir. Wenn du nid chasch Chleider flicke, isch das glich, denn laufi mit verrissene Hose ume.“
Langsam kam der Mann zur Besinnung.
„Dis Mami, de Papi und din Brüder würdet dich sicher vermisse, wenn du furt gingsch.“
„I chumme jo wieder hei. Und sie händ scho lang gseit, dass i emol zu dir dörf.“
Er öffnete den Jutesack und meinte: „Jo, wenn du meinsch. Denn muesch aber i de Sack ine. Das i dich cha mitneh.“
Tina griff zu ihrem Plastiksack, den sie hinter den Sessel gestellt hatte, und stieg in den Jutesack.
„Tschüss, zäme“, winkte sie den verdutzten Eltern zu.
Diese schauten sich und den Claus fragend an. Was jetzt? Spätestens beim Raustragen würde sich das Kind anders besinnen, dachten sie und gaben sich entsprechende Handzeichen. Aber sie täuschten sich gewaltig.
Mit dem Bündel über den Schultern schritt der Nikolaus verunsichert bis zur Türe, öffnete sie und wartete auf eine Reaktion. Es kam keine. Er trug den Sack bis zum Auto, legte ihn hinten in den Kofferraum und rührte sich nicht von der Stelle.
Die Mutter zog ihren Mann am Arm und flüsterte: „Du muesch öppis mache. Das dörf doch nid wohr si.“
Dieser meinte geduldig: „Wart emol ab.“
Tina lag im Sack, mit ihren Reisesachen. Sie freute sich auf den Esel und die Hütte im Tannenwald. Müdigkeit überkam sie und sie fiel in einen tiefen Schlaf.
Unterdessen überlegten die Eltern und der ratlose Samichlaus, was zu unternehmen sei. Es gab nur eine Lösung. Sie trugen den Sack wieder ins Haus. Tina war unendlich enttäuscht, als sie auf dem Sofa im Elternhaus erwachte. Ihr Traum vom Ausflug in die Schwarzwaldhütte hat sich in Luft aufgelöst. Warum der Nikolaus nie mehr zu Besuch kam, erfuhr sie erst Jahre später.

Christine Bonvin ist im Aargau aufgewachsen, lebt aber seit vielen Jahren in Sierre im Wallis. Als Betriebswirtschafterin setzte sie ihre Energien ein, um eine Firma aufzubauen. Die Geschichten schlummerten in einer Schublade, bis es Zeit war sie herauszuholen. Nebst drei Krimis wurden auch ein Freizeitführer und zahlreiche Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht.
Illustration © leale.ch
Katharina Michel-Nüssli «Die Rache» – «Tschuldigung» 2
«Tschuldigung», sagte er und verschwand. So zerbrach ihre Teenagerliebe. Jana war siebzehn und hatte ihrem Jugendfreund soeben gestanden, dass sie schwanger war. In diesem Moment zerbrach auch ihre Kindheit, die Unschuld hatte sie schon früher verloren. Als Dorfschönheit war sie es gewohnt, umschwärmt zu werden. Daumen rauf oder runter. Sie bekam, was sie wollte. Die attraktivsten Jungs. Sie hatte viele Neiderinnen. Bereits fühlte sie deren Spott ihren Rücken hinaufkriechen. Ihre Leibesfülle würde sie nicht verbergen können. Die Schule hatte ihr als Treffpunkt und Laufsteg gedient. Dort wurde ihr die Anerkennung zuteil, die sie sich so sehnlich von ihrem Vater gewünscht, und die er ihr ebenso beharrlich verweigert hatte. Mit guten Noten konnte sie nicht brillieren, da fehlten ihr gewisse geistige Fähigkeiten und das Interesse, das sie lieber auf andere Gebiete lenkte wie Mode oder Schwärmereien für die angesagten Film- und Musikgrössen.
Am Ende der Schulzeit fand sie in der nahen Kleinstadt eine Anstellung in einem gut besuchten Café an der Einkaufsgasse. Trotz Überredungskünsten der wohlmeinenden Lehrerschaft mochte sie keine Ausbildung antreten. Es lockten das schnelle Geld und die Selbständigkeit. Der Lohn war mässig, doch besserte sie ihr Gehalt mit Trinkgeldern auf. Ihr charmantes Wesen lockerte manchen Geldbeutel. Dass sie nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, kümmerte sie wenig. Die Welt lag ihr zu Füssen, besonders in letzter Zeit, als sich ein junger Banker namens Kenny besonders grosszügig gab. Typ Sonnyboy im Anzug. 25 Jahre alt. Eines Tages lud er sie zum Apero ein. Dann zum Abendessen. Dann ins Kino. Schliesslich zu sich nach Hause. So nahm die Geschichte ihren Lauf.
Das Kind wurde geboren, ein süsses Mädchen, wie konnte es anders sein. Rosanna wurde der Grossmutter in Obhut gegeben und wuchs vorwiegend bei ihr auf. Jana verlor ihre vertraglich nicht abgesicherte Stelle. Das Arbeitslosenamt schickte sie in ein Programm für Jugendliche ohne Ausbildung, wo sie rudimentäre Schulkenntnisse aufarbeitete und bald eine Praktikumsstelle in einem Coiffeurgeschäft antreten konnte. Sie stellte sich so geschickt an, dass ihr ein Ausbildungsplatz an selbigem Ort angeboten wurde. Sie sagte zu. Mit der Berufsschule bekundete sie einige Mühe, doch schaffte sie die Lehre und trat hinaus in eine solidere Selbständigkeit als zuvor. Sie zog in eine grössere Stadt und arbeitete im Salon eines renommierten Haarkünstlers. Regelmässig traf sie ihre Tochter, die bereits den Kindergarten besuchte. Am liebsten nahm sie die Kleine an Jahrmärkte und auf Einkaufstouren mit. Ersteres, weil das Kind das Karussellfahren liebte und sich nach Herzenslust mit Zuckerwatte verschmierte, Letzteres, weil Jana sie selber einkleiden wollte. Der Geschmack ihrer Mutter schien ihr zu altbacken. Ihre Tochter sollte sich nicht schämen müssen.
Am Martinimarkt, als Rosanna vergnügt ihre Runden auf einem Einhorn drehte, meinte Jana, an der Glühweinbar Kenny zu entdecken. Seit dem abrupten Abschied hatte sie ihn nicht mehr gesehen, da er fortan das Café mied, in welchem sie damals arbeitete. Auch später gab es keine Begegnungen mehr. «Entschuldigung, wenn ich dich anspreche; bist du Kenny?», hörte sie sich sagen. Befremdet musterte er sie. Er hatte sich verändert. Die Haare schon leicht ergraut und auch nicht mehr so dicht, das fiel ihr sofort auf. Die Augen blau wie eh und je, doch ohne die frühere Leidenschaft. Dass sie sich viel mehr verändert hatte, war ihr nicht bewusst. Rot gefärbte Haare, Side Cut und Piercing in Nase, Zunge und Augenbraue. «Schon möglich», brummte er und wendete sich ab. Seine Kumpane, geschleckte Anzugträger allesamt, schienen sich zu amüsieren. «Seltsamer Frauengeschmack … Nutte …», klang in ihren Ohren nach. Verdammte Aasgeier, dachte sie und suchte ihre Tochter, die schon vom Karussell heruntergestiegen war und weinend nach ihrer Mama rief.
Es ging auf Weihnachten zu, der Salon lief auf Hochtouren. Man brezelte sich auf fürs Fest, der perfekte Haarschnitt musste her. Jana wollte soeben in die Mittagspause gehen, da sah sie ihn. Kenny betrat strahlend das Geschäft und liess sich von Jasmin zum Stuhl in der Herrenabteilung geleiten. Jana stupfte sie an und zog sie hinter das Gestell mit den Pflegeprodukten. «Überlass mir diesen Kunden», raunte sie. «Ich erkläre dir später, warum.» Jasmin zuckte mit den Schultern und liess ihre Kollegin gewähren.
«Bitte den Nacken sauber ausrasieren und oben etwas mehr stehen lassen.» Jana machte sich ans Werk. Obwohl sie es zu vermeiden suchte, begegneten sich ihre Blicke im Spiegel. Sie war sicher, dass er sie erkannt hatte. Umso besser, dachte sie und führte den Rasierer immer weiter hinauf, bis sie seinen Scheitel erreicht hatte. «Was machst du da!», entsetzte er sich. Und weil sie nicht aufhörte, sprang er auf und entledigte sich seines Umhangs. «Das bezahle ich nicht!», empörte er sich und steuerte dem Ausgang zu. Sie stellte sich vor ihn hin und sagte: «Tschuldigung!»
 Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.
Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.
Illustration © leale.ch