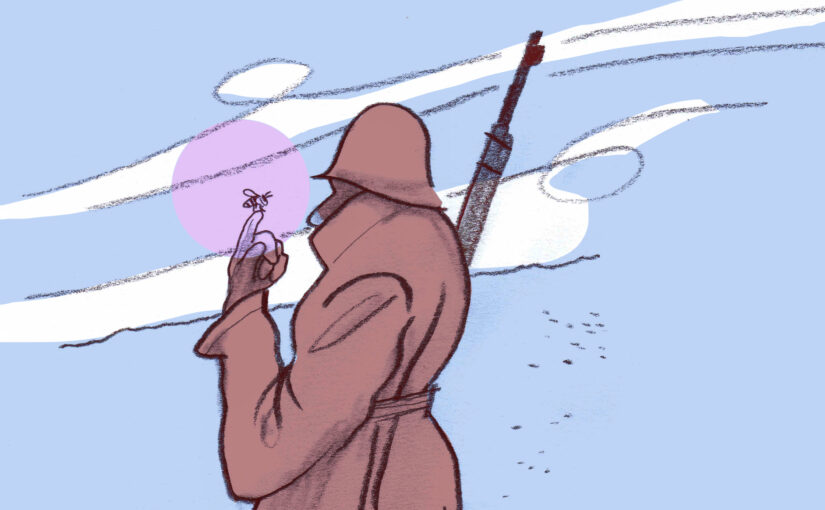Sie hat die Geschichte gegen Ende ihres Lebens an jedem Heiligen Abend ihrer jüngsten Enkelin wiedererzählt. Da lebte sie schon seit Jahren allein, manchmal einsam, oft aber umringt von Besuch, in dem kleinen Haus auf dem Hügel, das sie in den späten Dreißigerjahren auf dem Grundstück gemeinsam mit ihrem Mann gebaut hatte, den sie letztlich um 13 Jahre überlebte.
Sie hat die Geschichte gegen Ende ihres Lebens an jedem Heiligen Abend ihrer jüngsten Enkelin wiedererzählt. Da lebte sie schon seit Jahren allein, manchmal einsam, oft aber umringt von Besuch, in dem kleinen Haus auf dem Hügel, das sie in den späten Dreißigerjahren auf dem Grundstück gemeinsam mit ihrem Mann gebaut hatte, den sie letztlich um 13 Jahre überlebte.
„Wir haben uns das Grundstück urbar gemacht“, sagte sie, wenn sie davon sprach, wie sie und ihr Mann, der dahergelaufene Katholik, der Tagelöhner im Granitsteinbruch, der mit anderen wandernden Gesellen zu Mitte der Dreißigerjahre aus Niederbayern ins protestantisch geprägte Oberfranken gekommen war, weil es dort, anders als im Bayrischen Wald, zumindest noch Arbeit gab. Die jungen Männer schliefen auf einer Tenne im Dorf, abends bekamen sie ihren Lohn und konnten etwas essen.
Das Dorf ist klein, bis heute, es liegt am Ende einer Straße, die von der nächstgrößeren Ortschaft aus durch den Wald dorthin führt. Bis heute kennt dort jeder jeden. Das war auch damals so. Es war nur eine Frage der Zeit, dass sie ihn kennenlernte, vielleicht dauerte es länger, bis sie sich verliebte, aber es geschah. Er, der schön singen konnte und einen wilden, strahlenden Humor hatte, dazu dunkle Haare, die verschmitzten dunklen Augen einer Amsel. Sie wurde schwanger. Sie wusste es zuerst, sie sprach nicht darüber, zuerst nicht, auch nicht, als sie bei einer Tante einige Dörfer weiter zu Besuch war, die Tante erzählte, ein Mädchen aus dem Dorf habe sich in einen Katholiken verliebt, sie werde ihn heiraten. Die Tante sagte: Pfui Teufel. Sie aber, mit dem winzigen Fötus im Bauch, sagte später immer: „Als ich das hörte, wusste ich, wie über mich gedacht werden wird.“
Das Kind wuchs. Sie gestand die Schwangerschaft und die Verliebtheit den Eltern. Der Vater, der sich schon ausgerechnet hatte, dass sie den reichsten Bauernsohn aus dem Nachbardorf heiraten sollte, war außer sich, aber immerhin pragmatisch genug, dem ungeliebten Tagelöhner ein Bett im Haus für so lange zu gewähren, bis später das Grundstück oberhalb des Dorfes gerodet, das Wurzelwerk aus dem Acker gezogen, das Fundament des kleinen Hauses mit dem Satteldach, mit den Schrägen in den drei kleinen Zimmern des ersten Stocks, mit dem ausgemauerten Keller, fertig war.
Da war die erste Tochter schon geboren. Sie kam im Dezember 1936 zur Welt. Im Oktober zuvor war die Trauung vollzogen worden. Es gibt bis heute ein Foto davon. Man sieht die beiden vor einem dunklen Vorhang im Photoatelier der Kreisstadt, sie trägt ein dunkles Kleid, das den schon recht sichtbaren Bauch kaschiert, er einen dunklen, schlecht sitzenden Anzug. Ihre Eltern waren an diesem Tag auf dem Feld, Kartoffeln graben, seine Mutter schon seit Jahren tot, am Heiligen Abend im Stall des Hofes von einer Kuh beim Melken zwischen die Rippen getreten, sein Vater zwar noch am Leben, aber die Reise zur Eheschließung hatte er nicht angetreten.
Nach dem Vollzug der Eheschließung, auch das gehörte zu ihrem festen Geschichtenrepertoire, hatte ihre Patentante den beiden Brautleuten einen Kaffee gekocht, danach waren sie wieder heimgelaufen. Was sie wohl miteinander geredet haben? Waren sie wenigstens für Momente ausgelassen, weil jung und sie guter Hoffnung?
Als das Haus auf dem Hügel fertig war, zogen sie hin, es blieben ihnen zwei Jahre dort, die er tagsüber arbeitend im Steinbruch verbrachte. An den Abenden und am Sonntag legte er einen prachtvollen Obstgarten an, er wusste, wie man Bäume veredelt, ein Birnbaum vor dem Haus trug, nachdem er ihn gepfropft hatte, zweierlei Sorten Birnen, er schaffte Bienen an, damit die Bäume bestäubt wurden.
Dann kam der Krieg. Er wurde gleich nach dem 1. September des Jahres 1939 eingezogen. Sie blieb zurück mit der knapp Dreijährigen. Wovon sie lebte, davon sprach sie später nicht mehr. Es wird auch dank der Unterstützung der Eltern möglich gewesen sein, die sich gegen die Hochzeit gewandt hatten.
Die Jahre gingen ins Land, der Krieg dauerte an. 1939 war sie 26 Jahre alt, eine junge Frau, die gut nähen, kochen, tanzen konnte, die gerne lachte, bis ihr das Lachen verging. Sie sah in der Nachbarstadt den Pfarrer, der von SA-Männern durch die Straßen getrieben wurde, um den Hals ein Pappschild: „Ich bin das allergrößte Schwein, ich lass‘ mich auch mit Juden ein!“. Sie sah von ihrem Grundstück auf dem Hügel am Ende des Dorfes die unten auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfs im Tal vorbeigetriebenen Trosse von Inhaftierten, die nach Flossenbürg getrieben wurden. Als sie es zum ersten Mal sah, sagte sie zu ihrer Mutter, man müsse diesen Menschen doch wenigstens Wasser bringen und erhielt zur Antwort: „Anna, versündige dich nicht, du hast ein kleines Kind!“ Sie verdunkelte die Fenster ihres etwas abseits liegenden Dorfes und hörte BBC. Später sagte sie oft diesen Satz: „Wir haben es alle wissen können, wir haben es alle gewusst.“
Hin und wieder kamen Briefe aus dem Feld. Harmlose Briefe, man wusste um die Zensur und war vorsichtig in der Wahl der Worte.
Im Frühjahr 1944 erhielt ihr Mann Heimaturlaub. Er kam aus Russland, hatte die Schlacht von Stalingrad überlebt, durfte auf dem Hof seiner Schwiegereltern bei der Aussaat helfen, die in dieser kalten, kargen Mittelgebirgsgegend spät anberaumt worden war.
Was sie in dieser Zeit miteinander sprachen, bleibt ihr Geheimnis.
Einige Wochen später schrieb sie ihm: „Alois, wir erwarten ein zweites Kind“. Der Brief kam zurück, ein „Vermißt“-Stempel war ihm aufgestempelt worden.
Weihnachten 1944, so hat sie es wieder und wieder erzählt, war bitterkalt, die Gegend war tief verschneit. Um die Mittagszeit am Heiligen Abend packte sie etliche Päckchen mit selbstgebackenen Keksen, sie zog sich und die kleine Tochter warm an und lief mit ihr durch den Wald in den Nachbarort, wo im Lazarett zahlreiche Verwundete zur Versorgung untergebracht waren. An sie verteilte sie die Päckchen.
Wenn sie die Geschichte erzählte, vergaß sie nie zu erzählen, wie sehr sich die Männer freuten und wie sehr sie sich wünschte, ihr Mann möge noch leben und etwas zu Weihnachten bekommen.
Sie ging nachher mit ihrer Tochter in den Gottesdienst, dann liefen sie durch den Wald wieder nachhause. Das Angebot der Mutter, doch im Elternhaus im Dorf zu feiern, hatte sie ausgeschlagen. Sie habe ihre eigene Familie, sagte sie, und so erzählte sie es immer wieder, sie habe sich dessen bewusst sein und bleiben wollen und sei erst am nächsten Tag hinunter gegangen ins Dorf
Wenn sie, die weniger fromme als weltliche, aber doch tief ihrem Glauben Verbundene die Geschichte erzählte, immer nur am Heiligen Abend, sagte sie: „Weihnachten 1944 war mein einsamstes und traurigstes Weihnachten, aber ich wusste in diesem Moment, dass ich so nah bei Gott war, wie man es im Leben sonst kaum sein kann.“ Sie hatte die Tochter ins Bett gebracht, saß am Fenster ihres kleinen Wohnzimmers und schaute hinaus in die Weite, man hatte einen wunderbaren Ausblick aus diesem Fenster, hinunter zu den Lichtern des Dorfes, hinter dem das Tal in eine bewaldete Hügelkette überging, und in Schneenächten erleuchtete der Schnee die Dunkelheit in eine paradoxe Helligkeit.
Bis ins Jahr ihres Todes verbrachte sie seitdem Jahr um den Heiligen Abend dort, in diesem kleinen Wohnzimmer. Nie nahm sie später für diesen Abend Einladungen ihrer Kinder an, weder von der älteren, die damals mit ihr unter einem Dach lebte, noch von der jüngeren Tochter, die am 27. Januar 1945, also einen Monat nach diesem besonderen Tag, in einer eiskalten Winternacht auf die Welt kam.
Im Sommer 1949, die jüngere Tochter spielte draußen vor dem Haus, kam der Mann unverhofft und unangekündigt aus russischer Gefangenschaft zurück. Ein fremder, abgemagerter Mann, so erzählte die jüngere Tochter, sei den Hügel hinan nähergekommen, er sei wortlos an ihr vorbei durch die offene Haustür in die Küche gegangen und habe gesagt: „Ich habe Hunger,“ vom Essen, das ihm hingestellt wurde, aß er, bis seine Frau es ihm entschieden wegnahm.
Als sie die Geschichte der jüngsten Enkelin erzählte, die dank einer frisch erworbenen Fahrerlaubnis von Weihnachten 1991 an immer in den Nachmittagsstunden des Heiligen Abends zu ihrer Großmutter fuhr, um die Geschenke der Familie zu bringen, saßen die zwei immer am gleichen Platz auf dem einen der zwei Sofas in dem kleinen Wohnzimmer. Sie saßen nebeneinander, sie tranken Tee, die Geschichte wurde erzählt, es gab kaum Varianten im Text. In der Stube war es warm. Der Großvater war 1982 an den Spätfolgen des Kriegs, gestorben, der ihm große Teile seines Magens gekostet und Gelenkrheumatismus eingebracht hatte.
Wenn sie die Geschichte von Weihnachten 1944 erzählt hatte, wenn der Tee ausgetrunken war, sagte sie: „Es ist schön, wenn man nicht allein ist an Weihnachten, aber es ist auch gut, es zu lernen, dass es so sein kann. Du fährst jetzt wieder zu den Deinen, und ich weiß, wie es geht.“ Ihr Lächeln war weich, ihre Umarmung herzlich wie immer.
Als sie im Juli 1995 starb, war die Kirche zu klein, um die Trauergemeinde aufzunehmen. Die Leute standen im Vorraum der Kirche und die gesamte Kirchentreppe hinunter bis auf den Dorfplatz.
Für meine Großmutter Anna Klessinger (1913-1995), meinen Großvater Alois Klessinger (1912 -1992) und meine Mutter Rita, geborene Klessinger, die am 27. Januar 1945 auf die Welt in die Ungewissheit gekommen ist. Und für alle Schwangeren, alle Mütter, Väter und Kinder, die aufgrund eines Krieges voneinander getrennt worden sind, und zur Stunde nichts voneinander wissen.
 Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.
Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.