Ulrike Edschmid schreibt keine epischen Romane. Ihre Texte sind eingedampfte Literaturkonzentrate, obwohl auch sie in den etwas mehr als hundert Seiten fast ein ganzes Leben erzählt; die Geschichte einer Frau, die ihre Grenzen auslotet, auch darüber hinaus.
Eine ältere Frau wird über Jahre zur Therapeutin einer jungen, traumatisierten Frau. Obwohl die Patientin jede Woche einmal in ihrer Praxis sitzt, dauert es Jahre, bis die junge Frau zaghaft zu sprechen beginnt, erst nachdem sich die beiden lange Zeit über Augenzeichen verständigten. Die junge Frau trägt ein tiefsitzendes Trauma mit sich herum, eine offene und doch unsichtbare Wunde.
Sie war nicht die Tochter, die ihre Mutter sich wünschte, und würde es auch nie sein. Sie schaffte es nicht, einen Mann an sich zu binden, sie würde keine Kinder haben, keine Familie, und sie hatte keinen Beruf. Sie war nichts, nichts als eine Enttäuschung.
Ulrike Edschmid erzählt aber in erster Line das bewegte Leben der Therapeutin. Was macht uns zu dem, was wir sind? Wir sind alle in der einen oder anderen Weise verwundet. Nur haben die einen das Glück, dass sich die Wunden schliessen und man mit den Narben leben kann. Die Erzählerin wird nach Barcelona gerufen, ans Sterbebett ihrer Freundin, die in der Stadt bis kurz vor ihrem letzten Gang ins Spital Traumatherapeutin war. Die junge Frau wird die letzte Patientin der krebskranken Therapeutin. Die Geschichte erzählt eine namenlose ehemalige Mitbewohnerin und Freundin der Kranken. Sie versucht zu verstehen, warum die Freundin schlussendlich jenen Beruf ausübte und zu der wurde, die sie war. Die letzte Patientin, die junge traumatisierte Frau, heisst im Buch, in den Therapieprotokollen nur N., N. wie Niemand. Wann ist man jemand? Was braucht es, damit wir gesehen werden?
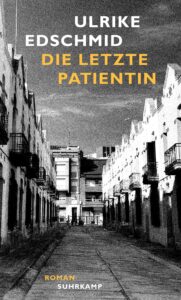
Als die sterbenskranke Therapeutin jung war, schien alles offen, dem Leben der jungen Frau keine Grenzen gesetzt. Der Einzug damals in der WG war eine Flucht, eine Flucht vor der Enge in ihrer Familie. Die Frauen freunden sich an, obwohl sich ziemlich bald abzeichnet, dass die Lebensentwürfe der beiden Frauen unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die Erzählerin bleibt, bricht die Freundin auf eine Jahrzehnte dauernde Reise auf. Eine Reise mit geographischen Markierungen, über Barcelona, von dort über Mexico City und Guatemala nach Costa Rica, Bolivien, Paraguay und Argentinien. Keine Suche nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Suche nach Liebe und Geborgenheit. Es reiht sich Verliebtheit an Verliebtheit, Mann an Mann, Leben an Leben. Aber sie findet nicht, wonach sie sucht, was sie nicht einmal zu formulieren im Stande wäre.
Sie fürchtet sich vor ihrer eigenen Rastlosigkeit, der sie einzig entgehen könne, wenn sie ständig die Orte wechsle und sich nicht mit dem nächsten Tag beschäftige.
Eine Getriebene, eine Suchende, eine Unruhige. Bis sie nach langer Zeit nach Barcelona zurückkehrt und dort eine Praxis eröffnet. Sie, die fast ein ganzes Leben brauchte, um festen Boden unter den Füssen zu finden, will jenen den Boden zurückgeben, die den ihren verloren. Sie, die Bindung und zu offensichtliche Nähe genauso schlecht ertragen konnte wie Einsamkeit und Alleinsein, sitzt Menschen gegenüber, denen es äusserst schwer fällt, einen Platz in der Gesellschaft, im Funktionieren zu finden.
Wann wird man vom Niemand zum Jemand? Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Masse fast alles tut, um einmal an der Oberfläche zu schwimmen. Man setzt alles daran, um seiner selbst ein Zeichen zu setzen. Während die einen eingeschlossen sind in Fremdverschuldetes, finden andere den Abzweiger nicht, um aus den Hamsterrädern der Gegenwart zu springen.
Heilung beginne, sagt sie, wenn eine Sprache gefunden werde für das, was als gestaltloses Dunkel unaussprechlich und in seiner formlosen Existenz nicht zu fassen, nicht zu begreifen, nicht zu benennen und nicht zu beweisen ist.
Ulrike Edschmids Roman ist mit klarem Strich gezeichnet, fast unterkühlt und doch mit Leidenschaft. „Die letzte Patientin“ ist ein Manifest gegen die scheinbare Normalität. Es gibt sie nicht. Es geht Ulrike Edschmid aber auch nicht um Versöhnung mit biographischer Unruhe. Sie protokolliert einen Weg, Stationen des Wachsens, die lange Suche einer mutigen Frau, dass die Antworten nicht im Gegenüber liegen. Ein starkes Buch!
Ulrike Edschmid, 1940 in Berlin geboren, studierte u.a. an der Deutschen Film- und Fernsehakademie und arbeitete als Lehrerin. Für ihre autobiographisch grundierten kurzen Romane wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. 2013 mit dem Preis der SWR-Bestenliste für ihr Lebenswerk.
Beitragsbild © Lukas Hemleb/Suhrkamp Verlag

