Heute feiert der Schriftsteller Urs Faes seinen 75. Geburtstag. Dass der Telegramme Verlag zu diesem Anlass ein Essay über das Werk dieses stillen Meisters herausgibt, ist löblich. Dass der Verfasser dieser Schrift Markus Bundi ist, mit Sicherheit einer der profunden Kenner hiesiger Dichtkunst, ist für all jene, die Urs Faes bereits schätzen, ein Glück, für alle anderen eine grosse Geste zur Einladung.
Seit mit «Sommerwende» 1989 Urs Faes dritter Roman erschien, ist dieser Hausautor bei Suhrkamp. Etwas, was nur wenigen vergönnt ist. Und dass in der Insel-Bücherei mit «Paris. Eine Liebe» und «Raunächte“ zusätzlich zwei literarische Preziosen erschienen sind, adelt den Autor, in einer Zeit, in der es für Schreibende nicht mehr selbstverständlich ist, sich in einem Verlag «zuhause» fühlen zu können. Urs Faes ist weder ein Autor der grossen Töne und auch keiner der reisserischen Themen. Keiner seiner vielen Romane wurde zum Kassenschlager, weil seine Bücher leise Töne anschlagen, kaum je plottorientiert sind und erst mit aufmerksamer Lektüre die Türen zu den angelegten Resonanzräumen öffnen.
Vor wenigen Wochen erschien bei Telegramme nun von Markus Bundi «Einer wie Lenz im Labyrinth». Freundlicherweise gestattete der Verlag literaturblatt.ch das erste Kapitel des Essays hier zu veröffentlichen. Als Leseangebot für all jene, die mit Markus Bundi durch den Faes’schen Kosmos reisen wollen und ein Geburtstagsblumenstrauss für den Autor:
***
Ich bin unschuldig geboren,
aber irgendetwas ist schiefgegangen,
ich weiss nicht, wie das passiert ist.
Amélie Nothomb
«Wer am Rande der Tanzbühne steht, tanzt mit allen.» – Das schreibt Steffen dem Ich-Erzähler des Romans Und Ruth (2001). Oder schreibt Steffen das dem Ich-Erzähler im Roman – oder gar in den Roman?
Man sollte in einem Essay nicht mit solch einer Spitzfindigkeit anheben, die, weil sie gleich zu Beginn in den Fokus gerückt wird, womöglich nicht nur einer intellektuellen Pedanterie geschuldet ist, sondern darüber hinaus eine Komplexiät in sich birgt, der Leserinnen und Leser, wenn überhaupt, sich lieber behutsam annähern wollten als schon beim zweiten Satz zum Nachdenken genötigt zu werden. Nun, auch nach reiflicher Überlegung ist mir kein besserer Einstieg in den Sinn gekommen; denn in Urs Faes’ Erzählen geht es immer um Perspektiven, seine Prosa handelt explizit oder implizit von den Bedingungen der Möglichkeit des Erzählens. Das gilt zum Beispiel für die Differenz zwischen Erzählinstanz und Fokalisierungssubjekt:
Aber eine erzählte Kindheit, schrieb Steffen, ist nie eine kindliche Kindheit, weil ein Kind nie seine Kindheit beschreibt, sondern als Kind lebt. Und wenn es seine Kindheit erzählt, ist es kein Kind mehr und seine Kindheit folglich eine erfundene Kindheit, die einer so erfindet, wie er als Kind gern gewesen wäre, es aber bestimmt nicht gewesen ist.
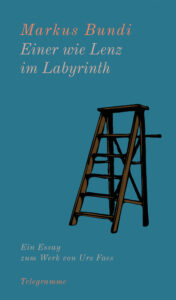
Eine Schlüsselstelle aus dem Roman Und Ruth. Zum Ausdruck kommt nicht nur das zentrale Thema in Faes’ Gesamtwerk, das Erinnern, sondern auch die grundlegende Schwierigkeit im Umgang mit Erinnerungen. Die Ausführungen Steffens verweisen auf die Unmöglichkeit der Wiedergabe von Wirklichkeit, und sie handeln von der Suche nach einem Anfang: Wo sollte einer mit Erzählen beginnen, wenn nicht bei seinen Kindheitserinnerungen?
Dieser Frage ging Urs Faes bereits in seinem ersten Roman Webfehler (1983) nach. Der Titel ist Programm, nein, er ist Schicksal, wann immer man einen Schöpfer mitdenkt – und auf den Menschen angewandt: die Bedingung für jedwede Tragödie. Wer einst im Orient dem Handwerk des Teppichknüpfens nachging, achtete tunlichst darauf, einen Webfehler zu begehen – denn nur einer war unfehlbar, und das war kein Mensch. Ob wir nun, Shakespeare folgend, solcherweise Stoff sind, aus dem die Träume gemacht sind – welche Textur auch immer von uns sichtbar wird –, oder auch nur des menschlichen Treibens gewahr werden, der Makel, das Ungenügen, der Fehler ist stets offensichtlich, uns von vornherein eingeschrieben: »Es geht nicht mit den Menschen. Wir sind eine Fehlkonstruktion.« Das denkt sich Anne, eine der beiden Hauptfiguren des Romans. Und Bettina, die andere Protagonistin aus Webfehler, ergänzt:
Als hätte sich, früh und unbemerkt, in das Gewebe, das ich wurde, ein Webfehler eingeschlichen. Äusserlich ist er nicht zu sehen und fällt vielleicht gerade darum so schwer ins Gewicht. Es muss ein Webfehler sein, der nicht zu korrigieren ist, es sei denn, man zerstört das ganze Gewebe, löst es auf in die vielen Einzelfäden und setzt es neu zusammen.
Bereits in Faes’ erstem Roman sind mehrere Leitmotive zu einem Ariadnefaden versponnen. Das Bewusstwerden vom Verstricktsein in Geschichten, in kleine wie in große, führt direkt oder indirekt zu einem Schuldbewusstsein, das wiederum Abwehrreaktionen – Projektionen wie Substitutionen – hervorruft. Alkohol und Medikamente werden zu Brandbeschleunigern. Verstrickungen und Ausweglosigkeit führen zur Überzeugung, es müsse sich um einen Webfehler handeln, »der nicht zu korrigieren ist«. Eines der trefflichsten Sinnbilder für die Situation, in der vielleicht jeder Mensch schicksalhaft steckt, findet sich ebenfalls im ersten Roman, als Anne das Zimmer der Freundin inspiziert, und zwar in Form einer Blechfigur:
Am besten gefiel Anne unter all den Spielsachen ein Turner, der am hohen Reck ein Kürprogramm drehte: Handstand vorwärts und rückwärts. Felge, Kippe, nur den Absprung schaffte er nicht, blieb, wenn das Uhrwerk, das seine Bewegungen lenkte, abgelaufen war, an der Stange hängen.
Im Reckturner an der Stange, wie ihn Anne vorfindet, wie sie ihn sieht und versteht (wie Faes die Szene umsetzt), finden wir ein Paradebeispiel dafür, wozu Literatur imstande ist, uns nämlich ein Bild zu geben – oder mit dem altgriechischen Wort: eine Idee. Da hängt einer an der Stange, bleibt bei der Stange ein Leben lang, ganz egal, ob seine Zeit für das Programm – notabene handelt es sich um ein Kürprogramm – begrenzt ist. Er bleibt hängen. Gehen die Scheinwerfer an, reckt er sich, turnt, vollführt seine Kunststücke; ist die Zeit abgelaufen, wird er erneut auf Stand-by gesetzt.
Im Gegensatz zum Hamsterrad, das sich als Symbol für das Leistungsprinzip und den Konformitätszwang einer Gesellschaft etabliert hat, steht am Anfang nicht der Bewegungsimpuls eines Subjekts; der Turner an der Stange wird in Bewegung gesetzt, ungefragt. Er ist jeder Spontaneität und jeder Möglichkeit zur Selbstverwirklichung beraubt, von Beginn weg an die Stange gebunden – als wäre es der Lebensnerv. Oder doch ein hölzernes Eisen? So zeichnet Faes das Menschenleben in seinem ersten Roman denn auch weniger als ein Abstrampeln, sondern vielmehr als ein fortgesetztes Drehen um ein Zentrum, zu dem die Distanz jedoch stets dieselbe bleibt. Das Kreisen kostet das Subjekt zwar (Lebens)Energie, es dürfte früher oder später zur Erschöpfung führen, als Suchbewegung aber, zur Klärung der Sinnfrage, der eigenen Identität, bleibt es ergebnislos. Einmal in Bewegung versetzt, dreht sich jede und jeder im Kreis.
Der Frage nach dem Webfehler ging Urs Faes in seinem zweiten Roman Bis ans Ende der Erinnerung (1986) erneut nach, der, nebenbei erwähnt, einer Ruth gewidmet ist. Der Protagonist Moss leidet an einer Krankheit, die lange nicht genauer bezeichnet wird, die sich aber im Verlauf seiner Flucht als Pubertät herausstellt – oder genauer: als das Scheitern daran, aus der Pubertät herauszuwachsen, erwachsen zu werden. Es handelt sich um eine sehr hartnäckige Krankheit, die den Protagonisten Paul im Roman Alphabe des Abschieds (1991) ebenso befallen hat: »Noch immer staunte er, schien eingehüllt in den Kokon seiner Kindertage wie in einen Traum: nur nicht erwachsen werden.« Moss hinwiederum muss sich vorwerfen lassen, »jedem Zoll« seiner Kindheit nachspüren, sie in »tausend Farben« ausmalen zu wollen. Diese Spurensuche allerdings folgt einem Motiv:
Vielleicht bilde ich mir ein, dass man nur vergessen könne, wenn man versuche, jenen magischen Punkt zu finden, von dem alles ausgegangen sei.
Darin kommt die philosophische Hoffnung zum Ausdruck, letztlich den Kosmos zu verstehen, Prinzip und System, Ursprung und Entwicklung; wie schon René Descartes nach der einen »unerschütterlichen Gewissheit« fahndete, nach dem archimedischen Punkt, von dem aus die ganze Welt auszuhebeln sei, und schließlich im Zweifeln fündig wurde. Und nehmen wir für einen Moment Friedrich Dürrenmatt, den vielleicht wichtigsten Schweizer Autor des vergangenen Jahrhunderts, dazu, so stoßen wir in dessen Labyrinth (1981) auf folgendes Fazit: »Ohne das Wagnis von Fiktionen ist der Weg zur Erkenntnis nicht begehbar.« – Es könnte gut als Motto für Faes’ schriftstellerisches Schaffen stehen.
Moss, inzwischen in Gewahrsam der türkischen Polizei, scheint tatsächlich jenen »magischen Punkt«, den er dann als seinen »tiefsten Punkt« bezeichnet, den Ursprung aller Heimatlosigkeit, zu finden:
Ich sah mich als Kind, fünf- oder sechsjährig, spät in der Nacht durch das Haus meiner Eltern gehen, immerzu nach den Eltern rufend, die nicht da waren, ich irrte durch die Räume des grossen alten Hauses, öffnete die Türen, machte Licht, leer das Schlafzimmer der Eltern, die Betten unberührt, leer das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer des Vaters, keine Spur, kein Lebenszeichen, ich rief in den Korridor hinaus, ins Treppenhaus, ich tappte vom Erdgeschoss über die Holztreppe in den ersten Stock, vom ersten in den zweiten Stock, wo nur unbewohnte Zimmer waren, die als Stapelraum dienten für altes Bettzeug und Kleider, die nicht mehr gebraucht wurden, für Stoffreste, die Mutter verarbeitete, es roch nach Mottenkugeln und Kampfer. Ich öffnete alle Türen, drehte die Lichtschalter an, Licht gegen die Gespenster, die ich unter Betten, Truhen, Schränken vermutete, hinter Vorhängen und Wäschestapeln, in Schubladen und Nachttöpfen; mit jedem Zimmer, das ich leer fand, wuchs das Entsetzen, das Gefühl des Ausgesetztseins, schutzlos ausgeliefert zu sein den lauernden Dämonen der Nacht, den Mördern und Dieben, den Fabelwesen und Geistern. Ich lehnte das Ohr lauschend gegen die Tür, die in den Estrich führte, glaubte ein Wischen und Kratzen zu hören, rannte zurück in den ersten Stock, stellte einen Stuhl ans Fenster, öffnete, kletterte auf den Fenstersims, schrie und schrie, hinaus in die Nacht, als müsste ich anschreien gegen die Welt, gegen das Entsetzen, gegen die Verlorenheit, ich schrie weiter, als in den Nachbarhäusern längst die Fenster geöffnet worden waren und erstaunte Gesichter zu mir aufblickten, ich heulte weiter, als die Eltern mich in die Arme nahmen und zu trösten versuchten. Und über Jahre blieb diese Angst, allein zurückgelassen zu werden: meine früheste Kindheitserinnerung.
Vier Sätze, die ersten drei im Sekundenstil gestaltet – als eine Erinnerung, in der jeder Schritt und jedes Geräusch, jede einzelne Empfindung aufbewahrt ist, sich für immer eingeprägt hat. Es sind insbesondere solche Textpassagen, die den Schriftsteller Faes schon in jungen Jahren als versierten Epiker auszeichnen, immer dann das Erzähltempo verlangsamend, wenn es gilt, eine Situation so präzise wie möglich und dem Gemütszustand der Figur entsprechend zu vergegenwärtigen. So dient der vierte Satz vornehmlich der Bestätigung des Leseeindrucks, eines Mitgehens und Mitfühlens, das vor allem eines evoziert: Angst. Die Angst, als Kind zurückgelassen und abgehängt zu werden, plötzlich allein dazustehen.
Die Szene erinnert nicht zufällig an ein Mädchen, das viel zu früh mit einem wesentlich älteren Baron vermählt, ihrer Jugend beraubt, an einem fremden Ort und von ihrem Mann alleingelassen, des Nachts von Angstträumen heimgesucht wird. Wenn Moss’ »früheste Kindheitserinnerung« in die oberen Stockwerke führt, Vorhänge in den Blick geraten und alsbald ein vermeintliches »Wischen und Kratzen« zu hören ist, dann sind wir im norddeutschen Kessin, sprich in Theodor Fontanes Roman Effi Briest (1894/95) angelangt, exakt in jener Beklemmung Effis, als sie mitten in der Nacht ebensolche Geräusche vernimmt, sich dazu Bewegungen der Vorhänge im Stockwerk über ihr vorstellt, erst träumend, dann wachend nachgerade in Panik gerät und aus ihrer Angst nicht mehr allein herauszufinden vermag.
Das Herausgerissenwerden aus der Idylle und der damit einhergehende Verlust der jugendlichen Unschuld – das ist der Anfang von Effis Leidensgeschichte; und es ist zugleich in mehreren Variationen die Ausgangssituation der Romane von Urs Faes. Anspielungen auf Fontanes Effi Briest finden sich in Faes’ Œuvre mehrfach; zuweilen explizit (etwa in Und Ruth) oder dann implizit, wie in der eben betrachteten Szene aus Bis ans Ende der Erinnerung. Die Empfindungen des Alleingelassenwerdens sind das eine, das andere aber sind die damit einhergehenden Vorstellungen. In Effis Worten: »Aber Einbildungen sind das schlimmste, mitunter schlimmer als alles.«

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Seine Romane «Paarbildung» und «Halt auf Verlangen» standen auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.
Markus Bundi, 1969 geboren, studierte Philosophie, Literaturwissenschaften und Linguistik an der Universität Zürich und lebt heute in Neuenhof AG. Er arbeitete zehn Jahre auf einer Zeitungsredaktion und unterrichtet seit 2005 an der Alten Kantonsschule Aarau Philosophie und Deutsch. Er hat mehrere Romane, Erzählungen, Gedichtbände und Essays veröffentlicht; zuletzt den Roman «Die letzte Kolonie» (2021) und «Der Vater ist der Vater» (2021) zu Heinrich von Kleist. Als Herausgeber betreute er u.a. DIE REIHE im Wolfbach Verlag, und er verantwortet die Werkausgabe von Klaus Merz.
Beitragsbilder © Sandra Kottonau / Literaturhaus Thurgau

