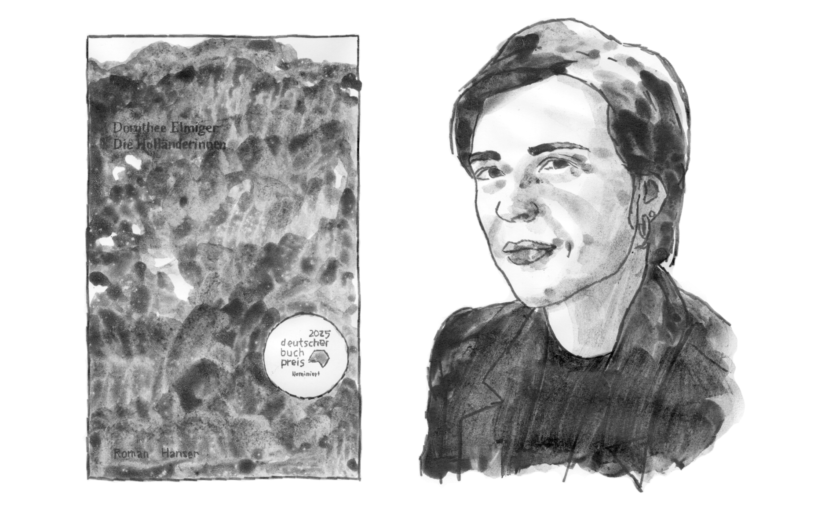Wenig überraschend, aber dafür überzeugend, steht Dorothee Elmiger im Blitzlicht auf der Bühne zum Schweizer Buchpreis. Für einmal werden sich alle Kommentare einig sein. Der Preis ist verdient!
 Sie habe sich sehr lange geweigert, zu erzählen.
Sie habe sich sehr lange geweigert, zu erzählen.
Das sind erstaunliche Worte einer Schriftstellerin.
Vielleicht denken Sie, ich rede jetzt von jener Schriftstellerin, die in dem Roman Die Holländerinnen in einer Poetikvorlesung von ihrem Scheitern im Erzählen spricht.
Ja, auch diese fiktive Schriftstellerin misstraut der Sprache. Aber genauso tut es Dorothee Elmiger. Sie ist es, die das Erzählen nach eigenen Aussagen verweigert habe. Aber Dorothee Elmiger wäre kaum Schriftstellerin, wenn sich das Erzählen nicht doch aufgedrängt hätte.
In Die Holländerinnen schickt sie eine zusammengewürfelte Theatergruppe, angeführt von einem exzentrischen Theatermacher, in den mittelamerikanischen Urwald. Die Truppe folgt den Spuren zweier verschollener Studentinnen. Doch hier wird kein Kriminalfall gelöst. Stattdessen erlebt die Reisegruppe, wie im Dickicht des Dschungels jeder rote Faden ausfranst und abreist und wie das vertraute Erzählen unmöglich wird.
Nicht erzählen können – ein Horror-Szenario, nicht nur in der Literatur. «Der Horror liege naturgemäss ausserhalb der Sprache», heisst es im Roman. Es grenzt also an Verzweiflung, dass sich die Theatergruppe grauenerregende Geschichten erzählt, um den Schrecken zu bannen. Es sind Geschichten ohne Pointen und ohne Erkenntnis von verendenden Ziegen, einem brutal gebändigten Pferd oder verschwundenen Menschen. Dorothee Elmiger umkreist die Gewalt, zu der unsere Gesellschaft fähig ist und sie beschwört das Unheimliche, das sich jeder Darstellung entzieht.
Zurück bleibt das beklemmende Gefühl, dass die Bedrohung lauert. Es ist ein Gefühl, das für unsere Gegenwart steht. Somit gelingt Dorothee Elmiger das Meisterstück, mit Sprache, die Wirklichkeit spürbar zu machen, indem sie «nicht» aufzeigt und «nicht» erzählt.
Das muss man sich als Schriftstellerin erst einmal trauen.
Auch mutig in der Gegenwartsliteratur: der Konjunktiv I. In der indirekten Rede schildert eine Erzählinstanz, wie die Schriftstellerin darüber spricht, was jemand gesagt habe, was anderen widerfahren sei. Was in der Theorie verschachtelt klingt, erzeugt beim Lesen einen Rausch.
Und: der Konjunktiv öffnet Assoziations-Räume – ganz ähnlich den Nachtaufnahmen zweier verschollener Frauen: Wie haben sich die Dinge tatsächlich zugetragen? Könnte alles ganz anders gewesen sein? Mit der Möglichkeitsform tastet sich die Autorin an die Grenzen dessen, was Sprache fassen kann.
Zu Hilfe kommen herbeizitierte Wegbegleiter: Adorno und Horkheimer, Benjamin und Bernhard, Herzog und Coppola. Dorothee Elmiger tritt klug und mit einer Spur Ironie in Verbindung mit dem Kanon. Aber ist ihr Roman deshalb nur Lektüre für Fachleute aus Germanistik, Soziologie und Filmwissenschaft?
Nein. Denn ob mit oder ohne Rückgriff auf intellektuelle Traditionen ist dieser Roman vor allem eines: extrem spannend. Die Holländerinnen zu lesen, ist ein sinnliches Erlebnis. Die «Furcht», die «atmosphärische Störung» und das «Gefühl, es sei etwas aus dem Lot geraten» spüren wir Leserinnen und Leser körperlich.
Über Die Holländerinnen wurde in den letzten Monaten viel gesagt und viel geschrieben. Vor allem lobendes. Es hiess aber auch, in diesem Roman stecke wenig Zuversicht. Dem möchte ich widersprechen: Dorothee Elmiger durchbricht das runde, schlüssige Erzählen. Damit schafft sie Grund zur Hoffnung, dass wir der Wirklichkeit näherkommen, wenn wir das Geschichtenerzählen hinterfragen, neudenken und weiterentwickeln.
Liebe Dorothee Elmiger, ich gratuliere Ihnen im Namen der ganzen Jury herzlich zum Schweizer Buchpreis.
Tim Felchlin, November 2025
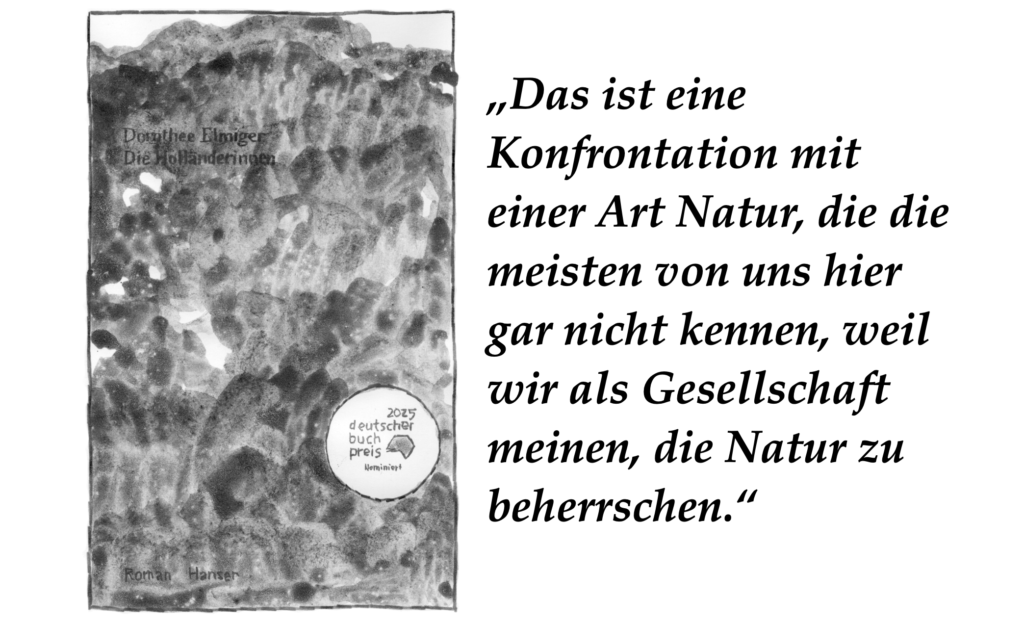
Illustrationen Lea Le / literaturblatt.ch