Nicht nur das Blau ihrer Augen machte Alina zu etwas Besonderem. Vielleicht die Tatsache, dass sie nicht in die Familie hineingeboren wurde, in der sie aufwächst, aber ganz sicher die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die allen andern verborgen bleiben. „Was Alina sah“ ist ein perfektes Stück Erzählkunst.
Alexandra Lavizzari schreibt seit bald vier Jahrzehnten Erzählungen und Romane. Ob historisch oder ganz im Jetzt, Alexandra Lavizzari taucht tief ein. Genauso in der Geschichte um Alina, ein Mädchen, eine junge Frau, die die Fähigkeit hat, hinter die Dinge zu sehen, die das Unglück kommen sieht, die das Leid anderer in sich aufsaugt und den Schmerz zu ihrem eigenen macht, mit ihren tiefblauen Augen nicht nur ihre Gegenwart bezaubert, sondern durch die Zeit hindurchsehen kann. Vielleicht ist genau diese Fähigkeit auch die von Schreibenden; durch das Erzählen ein Leben zum eigenen werden lassen. Erzählen, als ob es das eigene Leben wäre. Und uns Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, mitzuleben, so sehr, dass man zwischen zwei Buchdeckeln ins Geschehen eingreifen möchte.
Judith bekommt eine kleine Schwester. Alina ist nicht ihre tatsächliche Schwester, nicht einmal ihre Halbschwester. Weil Judiths Mutter wegen „Unterleibsproblemen“ nicht noch einmal schwanger werden sollte und sich die Eltern ein Einzelkind nicht vorstellen will, eine Monopolstellung in der Familie undenkbar ist, fahren die Eltern eines Tages weg und kommen mit Alina zurück. Die Stunde des Teilens hatte für mich geschlagen. Alinas Start ins Leben ist ein ganz anderer als der von Judith. Judiths Eltern, gut situiert, ohne wirtschaftliche Sorgen, der Vater hat gar Zeit für das kostspielige Hobby des Erfindens, ist Alinas Ort ihrer Geburt eine öffentliche Toilette. Alina kommt aus dem Heim in ihr neues Zuhause, ein Zuhause, das nie ganz ihr Zuhause sein würde, ein Nest, in dem sie sich immer fremd fühlt. Nicht weil es an der Liebe ihrer neuen Eltern oder an der Zuwendung von Judith gefehlt hätte, sondern weil Alina schon als kleines Mädchen spürt, dass nicht nur ihr Herz in einem anderen Takt pulst. Ihr Inneres sieht Dinge, die allen anderen verborgen bleiben, sie trägt einen Schmerz mit sich herum, von dem andere nicht einmal etwas erahnen.
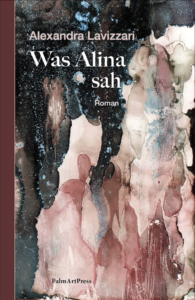
Zum ersten Mal wird es spürbar, als die kleine Alina den Tod eines befreundeten Nachbarn voraussieht, man ihre Prophezeiung aber viel mehr als schlechtes Omen sieht, als Störung einer Ordnung, als eklatante Einmischung in den Lauf der Dinge. Während Alina in ihren schulischen Leistungen alles andere als reussiert, müssen nicht nur die Eltern erfahren, dass ihre Adoprivtochter ein verborgenes Leben führt. Erst sind es Gelegenheitsjobs, organisierte Hilfen, die ihr Taschengeld aufbessern, später mehr und mehr Abwesenheiten, die die Familie mit Sorge erfüllen und Judith, die Erzählerin zur pflegeleichten, beinah unsichtbaren Nebensache machen. Während es sich in der Stadt mehr und mehr herumspricht, dass Alina den besonderen Blick hat, drohendes Unglück sehen kann, wird auch mehr und mehr klar, wie sehr die werdende Frau darunter zu leiden hat. Vor allem dann, wenn das Unglück doch eintritt und Alina nicht verhindern kann, was sie mit ihrem Blick durch Zeit und Raum hindurch schon einmal miterleben muss.
Niemand kann Alina helfen, auch Judith nicht. Auch ihre Eltern nicht, die alles Erdenkliche tun, um Alina vor sich selbst zu schützen. Während Alina mehr und mehr zum Medium wird, sich das Geld auf ihrem Bankkonto sammelt, Vater mit seiner Erfindung eines zusammenklappbaren Wohnwagens nicht nur wegen Alinas Geschichte immer wieder ins Stocken gerät und die Mutter sich in ihren anerzogenen Selbstverständlichkeiten bedroht sieht, verliert sich Alina im Bann ihres Blicks.
Man kann „Was Alina sah“ durchaus als Parabel darüber lesen, was mit Menschen geschieht, die über ganz spezielle Fähigkeiten verfügen. Was von aussen wie ungerechtfertigtes Übermass an Glück erscheint, kann für die Betroffenen zur lebensbedrohenden Bürde werden. Aber Alexandra Lavizzaris Roman ist einfach gut erzählt. In einer Unverkrampftheit, wie man sie sonst viel eher im Angelsächsischen antrifft. Ein Roman, der mit Bildern spielt, die mitreissen. Ein Buch, das nicht loslässt. Köstlich und mit viel Können!

Alexandra Lavizzari, 1953 in Basel geboren, Studium der Ethnologie mit anschliessendem zweijährigem Praktikum am Rietberg Museum, Zürich. Sie lebte von 1980-2000 in Nepal, Pakistan und Thailand und ist nun, nach einem längeren Aufenthalt in Italien, mehr oder weniger in Südwestengland ansässig, wo sie sich neben dem Schreiben auch als Kunstmalerin betätigt. 1999 erschien bei Zytglogge ihr erstes literarisches Werk, die Novelle ‚Ein Sommer‘. Es folgten viele Romane und Erzählungen, auch biografische Essays über Künstlerinnen und Schriftstellerinnen.
Beitragsbild © privat

