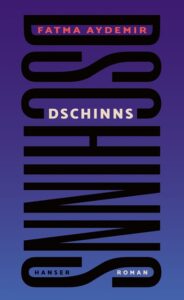Herta Müller wird wie eine Königin in den mit viel Marmor ausstaffierten Raum im ehrwürdigen Hauptgebäude der Uni Zürich geleitet. Ein krasser Gegensatz für eine Frau, die vor ihrer Vertreibung aus Rumänien ganz unten war, verraten und einsam, von einem kollektiven Verleumdungs- und Lügenapparat systematisch in die Enge getrieben.
Wird man verfolgt und mit dem Tod bedroht, wenn man «gestorben werden kann», wird man sich bewusst, dass das Leben ein Geschenk ist, sagte Herta Müller im Gespräch über ihr neustes Buch «Eine Fliege kommt durch einen halben Wald», organisiert durch das Zentrum für literarische Gegenwart Zürich. Leben wird subversiv, weil das Leben selbst in Frage gestellt wird. In einem totalitären Staat, in jedem totalitären Staat wird bewusstes Leben zu einem politischen Leben. Und so trägt jede Frage, die Herta Müller in ihren Büchern oder in Gesprächen zu beantworten versucht, eine starke politische Komponente. Leben wird automatisch zu einem politischen Leben, das sich permanent gegen den Wall an Verboten stemmen muss. Man kann verweigern und ausblenden, bis man dann doch irgendwann konfrontiert wird und sich für die eine oder andere Seite entscheiden muss. «Eine Fliege kommt durch einen halben Wald» ist eine Sammlung von Essays und Reden, die zusammen mit dem titelgebenden «Monolog» zur niedergeschriebenen Auseinandersetzung mit staatlich inszenierter Unterdrückung werden, dem immer wiederkehrenden Thema der Autorin.

Herta Müller, Verfolgte, Bestrafte und Drangsalierte wurde schon vor ihrer Flucht nach Deutschland eine Einsame, eine Ausgeschlossene, eine von Lügen und Neid Eingeschlossene. Unvorstellbar, dass die Frau, die auch über ein Jahrzehnt nach ihrem Nobelpreis Säle füllt, einst ihren Arbeitsplatz als Übersetzerin in einer Maschinenfabrik wegen Verleumdung und strategischen Verdächtigungen räumen und diesen ins Treppenhaus der Firma verlegen musste, um ihre Arbeit nicht ganz zu verlieren. Totalitäre Systeme, ob Rumänien damals oder all die totalitären Staaten heute, bedienen sich stets der Lüge, der Fälschung, der Verdrehung. Man wird effizient zum Einzelnen gemacht, Lüge wird zum System. Die Behauptung, sie sei Staatsfeindin, Schwarzmarkthändlerin und prostituiere sich, wird Mittel zum Zweck. Gelogenes und Erfundenes wird Teil eines Unrechtssystems. Fatal ist, dass damit selbst die Wahrheit Schatten bekommt. Man ist sich nie sicher, ob man auf Wahrheit oder Lüge trifft. Und diese permanente Verunsicherung erzeugt Angst.
Verfolgung wurde in den Jahren in Rumänien zu einem dauernden Kampf, den die Autorin immer in Isolation und Angst abdrängte, umgeben von Opportunisten, besonders schmerzhaft dann, wenn selbst die Familie, die Eltern zum langen Arm des Staates wurden.
«Eine Fliege kommt durch einen halben Wald» ist ein Buch, das Beklommenheit auslöst, eine Beklommenheit, von der sich die Autorin nicht lösen will und kann, eine Beklommenheit, die angesichts der globalen Probleme noch vertieft. Verfolgung, grassierender Antisemitismus, offensichtlicher Opportunismus und Rassismus schlagen Wellen wie noch nie, erzeugen ein gefährliches, mehr und mehr explosives Gemisch mit unabsehbaren Folgen. Herta Müller macht Bilder von Unsäglichem, ohne Klischee, ohne Angegriffenheit. Seltsam genug, dass sich nicht nur die Literatur der Sprache bedient, auch die Politik, selbst die Diktatur. Darum ist Sprache stets Politik, Literatur Stellungnahme. Im Gespäch beschwört Herta Müller, dass gerade deshalb viel mehr über Literatur diskutiert werden müsste. Man ist verpflichtet, sich selbst zu erzählen, mündig zu werden. Ein Prozess, der nie zu Ende sein kann, für den die Nobelpreisträgerin noch immer schreibt und lebt.
Wenn ich schreibe, muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was mich von innen bedrängt. Ein Zustand, der die Angst stets miteinschliesst. Schreiben ist der Drang, sich nicht verlieren zu wollen, ein Kampf gegen die Hässlichkeiten.
Herta Müller wurde 1953 im deutschsprachigen Nitzkydorf im Banat in Rumänien geboren. Sie studierte in Temeswar rumänische und deutsche Literatur. Sie arbeitete nach dem Studium in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin. Weil sie sich weigerte, ihre Kollegen für den rumänischen Geheimdienst Securitate zu bespitzeln, verlor sie ihre Stelle, fand danach nur noch Aushilfstätigkeiten und geriet selbst ins Visier der Securitate. Es folgten Verhöre und Hausdurchsuchungen und die Verleumdung. 1987 konnte sie nach Berlin ausreisen, wo sie heute noch lebt. Ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt wurden ihr der Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museum Berlin sowie der Internationale Brückepreis der Europastadt Görlitz/Zgorzelec verliehen und sie wurde in den Orden Pour le mérite aufgenommen. 2009 erhielt sie den Literaturnobelpreis.
Rezension zu «Die Lüge ist ein Klettertier«
Rezension zu «Der Beamte sagte«
Beitragsbild © Gallus Frei (anlässlich einer Lesung der Autorin an der Uni Zürich, November 2023)
(Das war der 1498. Beitrag auf literaturblatt.ch.)


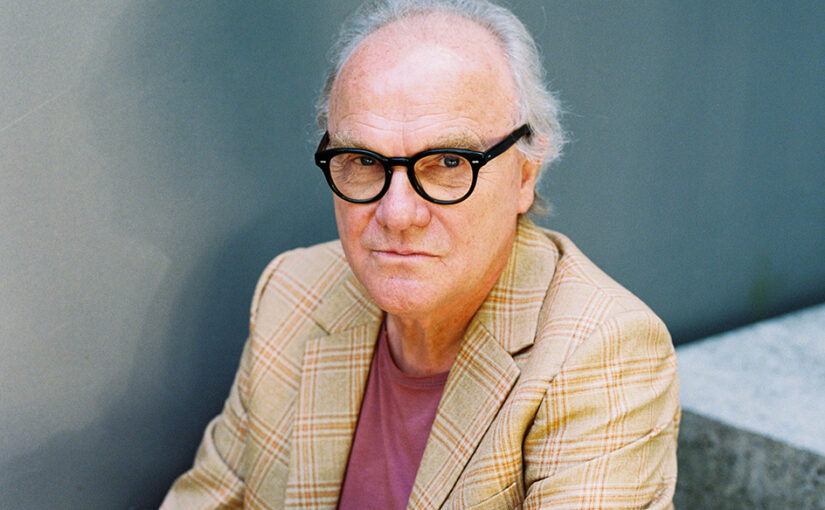


 Monika Helfer lebt zusammen mit ihrem Mann Michael Köhlmeier im vorarlbergischen Hohenems eine symbiotische Lebens- und Schreibgemeinschaft in einem mit Efeu bewachsenen Haus, in dem alles der Familie, den Erinnerungen und dem Schreiben gewidmet ist. Monika Helfer und Michael Köhlmeier, beide beim gleichen Verlag, werden auch vom gleichen Lektor betreut, leben dort das Leben von zwei von Sprache Beseelten.
Monika Helfer lebt zusammen mit ihrem Mann Michael Köhlmeier im vorarlbergischen Hohenems eine symbiotische Lebens- und Schreibgemeinschaft in einem mit Efeu bewachsenen Haus, in dem alles der Familie, den Erinnerungen und dem Schreiben gewidmet ist. Monika Helfer und Michael Köhlmeier, beide beim gleichen Verlag, werden auch vom gleichen Lektor betreut, leben dort das Leben von zwei von Sprache Beseelten. Zentral in diesem Buch ist aber die Geschichte einer Freundschaft, der Freundschaft zwischen Moni und Gloria. Sie beide wachsen im Vorarlbergischen auf, Monika in einem kleinbürgerlichen Haushalt, in einer von Arbeit und Strebsamkeit geprägten Familie, Gloria in einer Villa zusammen mit ihrer Mutter, einer Frau, die sich mit aller Selbstverständlichkeit in ihrem Luxus bewegt, auch wenn die beiden in diesem grossen Hauses nur drei Zimmer mit Leben füllten.
Zentral in diesem Buch ist aber die Geschichte einer Freundschaft, der Freundschaft zwischen Moni und Gloria. Sie beide wachsen im Vorarlbergischen auf, Monika in einem kleinbürgerlichen Haushalt, in einer von Arbeit und Strebsamkeit geprägten Familie, Gloria in einer Villa zusammen mit ihrer Mutter, einer Frau, die sich mit aller Selbstverständlichkeit in ihrem Luxus bewegt, auch wenn die beiden in diesem grossen Hauses nur drei Zimmer mit Leben füllten.




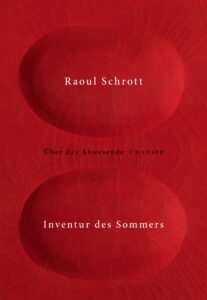

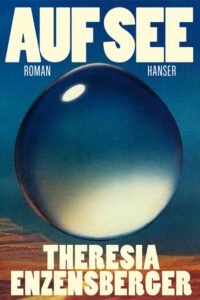

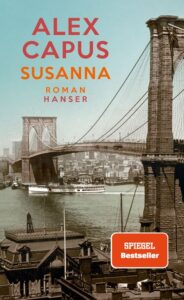

 Gastbeitrag von Elodie Kolb
Gastbeitrag von Elodie Kolb

 Gastbeitrag von Yasemin Sarikus
Gastbeitrag von Yasemin Sarikus